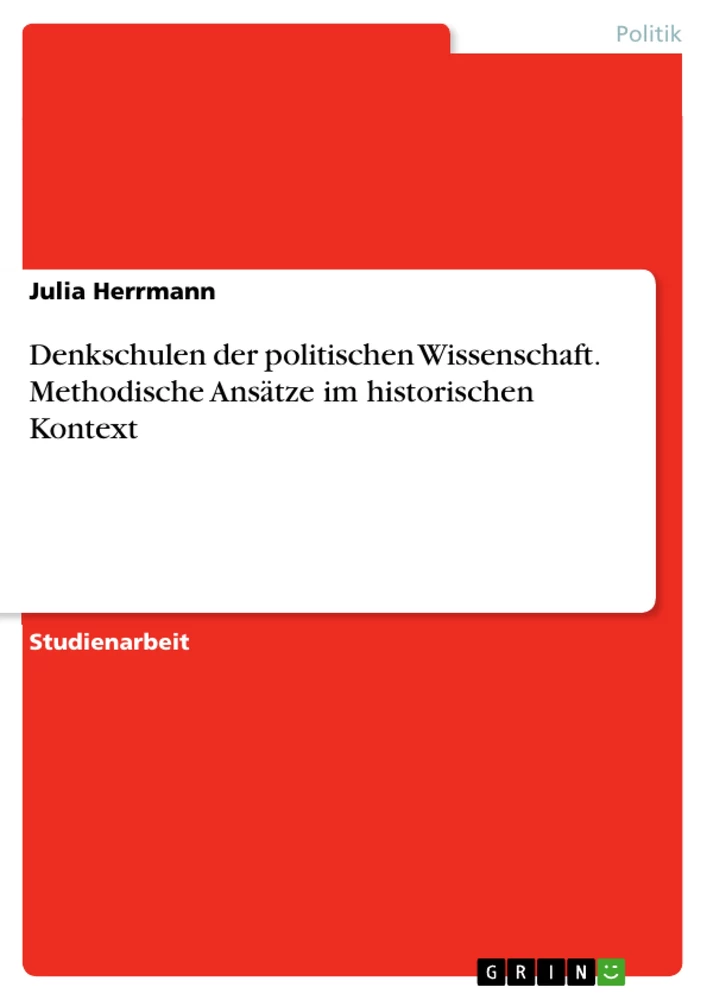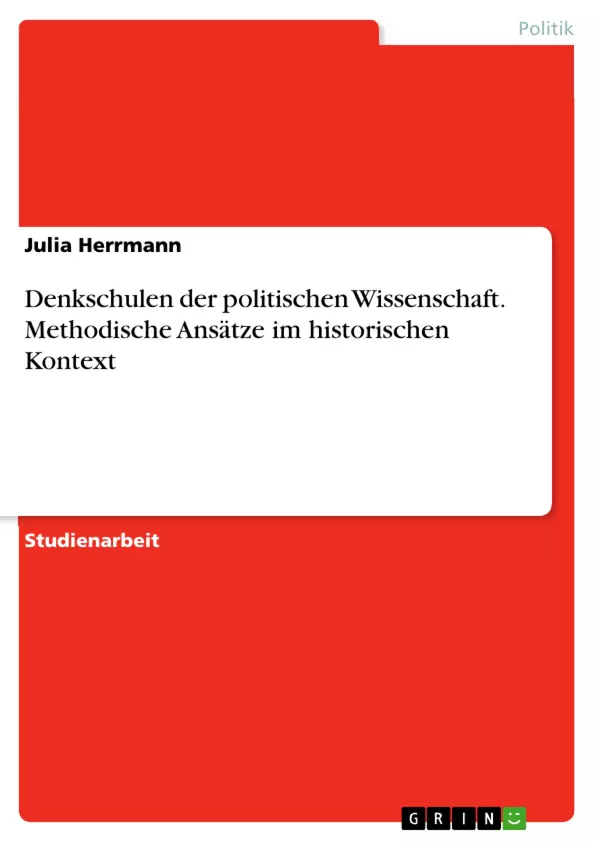Ziel der Arbeit ist es, den grundsätzlichen Charakter der politischen Wissenschaft herauszuarbeiten und anhand von Beispielen darzustellen, wie verschiedene Denkschulen mit dieser Aufgabe umgegangen sind.
Zuerst einmal möchte ich anhand verschiedener Definitionen, ein allgemeines Bild der Wissenschaft darstellen, um mich dann mit den Kriterien dieser auseinanderzusetzen. Ein besonderes Augenmerk wird anschließend auf das Thema Methoden gelegt, die zur wissenschaftlichen Erkenntnis führen. Hier werden zuerst die Unterschiede zwischen qualitativen und quantitativen Methoden untersucht, um sich anschließend mit der Deduktion und Induktion auseinander zu setzen. Im Weiteren wird anhand des Kritischen Rationalismus, des Werturteilsstreits und des Positivismusstreits gezeigt, wie verschiedene Denkschulen mit den Problemen bei der genauen Charakterisierung von Wissenschaft umgegangen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Was ist Wissenschaft?
- Kriterien von Wissenschaft und Forschung
- Methoden
- Qualitative und Quantitative Methoden
- Deduktion und Induktion
- Die eine Wissenschaft
- Wissenschaftsverständnis im historischen Kontext
- Karl Popper: Kritischer Rationalismus
- Werturteilsstreit
- Positivismusstreit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der wissenschaftlichen Betrachtung der Wissenschaft selbst und untersucht, wie verschiedene Denkschulen mit der Definition und den Kriterien von Wissenschaft umgegangen sind.
- Definition und Abgrenzung von Wissenschaft
- Kriterien wissenschaftlicher Forschung
- Unterschiede zwischen qualitativen und quantitativen Methoden
- Deduktion und Induktion als wissenschaftliche Vorgehensweisen
- Wissenschaftsverständnis im historischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung
Die Einleitung stellt die Problematik der Definition von "Wissenschaft" im Kontext der wissenschaftlichen Praxis heraus, insbesondere in der Ernährungswissenschaft. Das Ziel der Arbeit ist es, die grundlegenden Charakteristika von Wissenschaft zu beleuchten und verschiedene Denkschulen anhand von Beispielen zu analysieren.
2. Was ist Wissenschaft?
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Definitionen von Wissenschaft und hebt die Bedeutung von Erkenntnisstreben und der Verwendung von Methoden hervor. Es werden auch wichtige Aspekte wie die Abgrenzung von anderen Gebieten (z.B. Religion, Politik) und die Wertfreiheit von Wissenschaft diskutiert.
2.1 Kriterien von Wissenschaft und Forschung
Hier werden die wichtigsten Kriterien für verlässliche Wissenschaftsforschung, wie Empirie, Systematik, begriffliche Exaktheit und Ehrlichkeit, erläutert. Außerdem werden Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität eingeführt.
2.2 Methoden
Dieses Kapitel fokussiert auf die verschiedenen Methoden in der wissenschaftlichen Forschung. Es werden die Unterschiede zwischen qualitativen und quantitativen Methoden sowie die Deduktion und Induktion als zwei wichtige wissenschaftliche Denkweisen behandelt.
3. Die eine Wissenschaft
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob es eine einheitliche Wissenschaft gibt oder ob verschiedene Wissenschaften unterschiedliche Herangehensweisen und Kriterien benötigen.
4. Wissenschaftsverständnis im historischen Kontext
Hier werden verschiedene Denkschulen und ihre Sicht auf Wissenschaft vorgestellt, darunter der Kritische Rationalismus, der Werturteilsstreit und der Positivismusstreit. Es werden die Debatten und die unterschiedlichen Perspektiven dieser Denkschulen auf die Charakterisierung von Wissenschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Wissenschaft, wissenschaftliche Forschung, Methoden, qualitative und quantitative Methoden, Deduktion, Induktion, Kritischer Rationalismus, Werturteilsstreit, Positivismusstreit, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Ernährungswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die grundlegenden Kriterien von Wissenschaft?
Zu den zentralen Kriterien gehören Empirie, Systematik, begriffliche Exaktheit, Ehrlichkeit sowie Objektivität, Reliabilität und Validität.
Was ist der Unterschied zwischen Induktion und Deduktion?
Induktion schließt von Einzelfällen auf allgemeine Gesetze, während Deduktion von einer allgemeinen Theorie auf den Einzelfall schließt.
Was besagt der Kritische Rationalismus von Karl Popper?
Er geht davon aus, dass wissenschaftliche Theorien nie endgültig bewiesen, sondern nur widerlegt (falsifiziert) werden können.
Worum ging es im Werturteilsstreit?
Im Kern ging es um die Frage, ob Wissenschaft wertfrei sein muss oder ob Wissenschaftler auch politische und ethische Wertungen vornehmen dürfen.
Gibt es eine einheitliche Methode für alle Wissenschaften?
Die Arbeit untersucht, ob es „die eine Wissenschaft“ gibt oder ob verschiedene Disziplinen (wie die Ernährungswissenschaft) unterschiedliche Herangehensweisen benötigen.
- Quote paper
- Julia Herrmann (Author), 2019, Denkschulen der politischen Wissenschaft. Methodische Ansätze im historischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937278