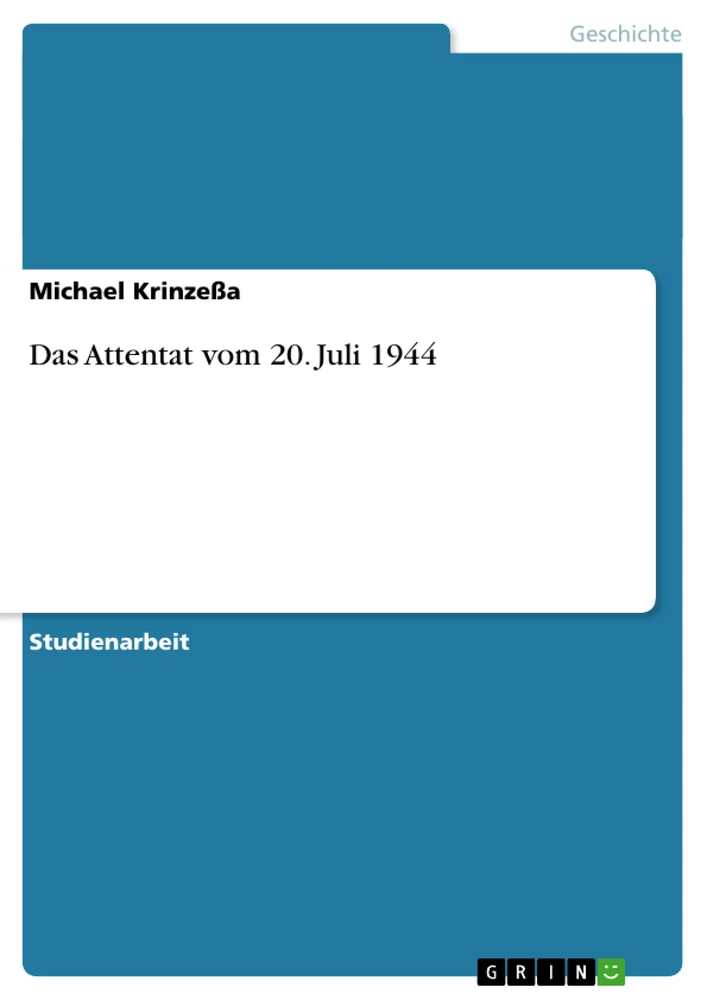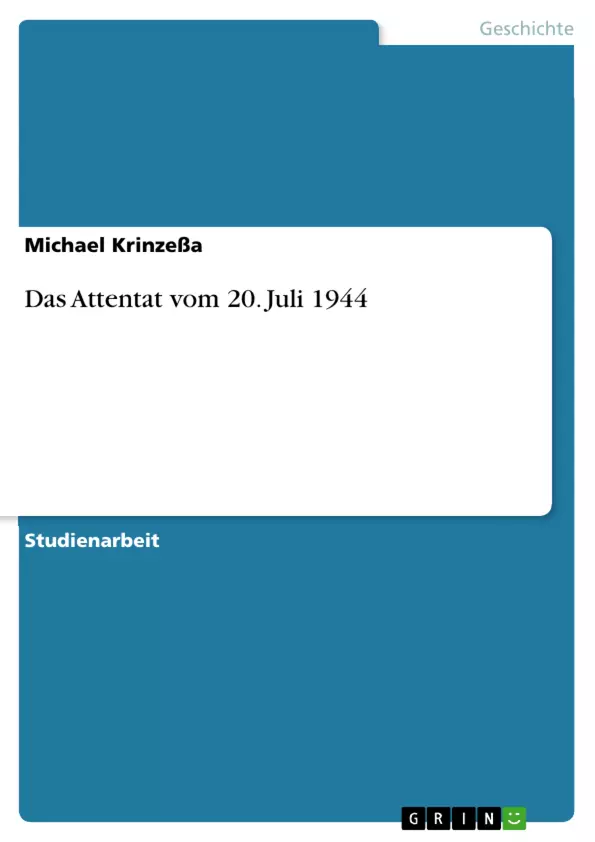Am 21. Juli 1944 richtete Reichsmarschall Göring aus dem Führerhauptquartier eine Ansprache an die Soldaten der Luftwaffe, in der das Attentat auf Adolf Hitler am vorherigen Tage auf das schärfste verurteilt. Außerdem ordnete er an, daß gegen mögliche Sympathisanten der Attentäter ohne Rücksichtnahme vorzugehen sei. Er wies nochmals ausdrücklich auf die Macht der Vorsehung hin, die den "Führer" angeblich vor dem Tode bewahrte. Diese Rede, die in der Dokumentensammlung von Herbert Michaelis und Ernst Schraepler auch als Ergebenheitskundgebung für Hitler tituliert wird, war die Reaktion Görings auf den gescheiterten Staatsstreich. Er beabsichtigte damit, seine Solidarität mit Hitler zu bekunden. Henning von Tresckow, ein führender oppositioneller Offizier, idealisierte das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 als positives Zeichen vor der Welt und vor der Geschichte. Er sah den Sinn des Umsturzversuchs weniger in seinen praktischen Zwecken, als in der Tatsache, daß die deutsche Widerstandsbewegung dieses Wagnis und seine daraus resultierenden Konsequenzen einging. Doch die Realität offenbarte eine Tragödie, denn in Deutschland begann eine "Hetzjagd" der nationalsozialistischen Schergen nach vermeintlichen Widerstandskämpfern. Eine große Zahl unschuldiger Menschen fand so den Tod.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ereignisse vor dem 20. Juli 1944
- 2.1. Die Entwicklung des militärischen Widerstandes im Dritten Reich
- 2.2. Die Phase vor dem Umsturzversuch und dessen Notwendigkeit
- 3. Die Ereignisse am 20. Juli 1944 und ihre Konsequenzen
- 3.1. Das Scheitern des Staatsstreiches
- 3.2. Die Konsequenzen des nationalsozialistischen Staatsapparates auf den Umsturzversuch
- 4. Zusammenfassung
- Bibliographie
- Biographie des Oberst Claus Graf Stauffenberg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den militärischen Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime und kulminiert in der Darstellung des Attentats vom 20. Juli 1944 und des darauffolgenden gescheiterten Umsturzversuchs. Die Analyse umfasst die Vorgeschichte des Attentats, die Ereignisse des Tages selbst und die unmittelbaren Folgen der Aktion für die beteiligten Personen und das Regime.
- Entwicklung des militärischen Widerstandes im Dritten Reich
- Motivationen und Ziele der Widerstandskämpfer
- Planung und Durchführung des Attentats vom 20. Juli 1944
- Das Scheitern des Staatsstreichs und die Reaktion des NS-Regimes
- Die Konsequenzen des Attentats für die beteiligten Personen und das Dritte Reich
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den Kontext des Attentats vom 20. Juli 1944, indem sie Göring's Reaktion auf das Ereignis und die gegensätzlichen Perspektiven von Göring und Henning von Tresckow beleuchtet. Sie hebt die Tragödie des gescheiterten Umsturzversuchs und die anschließende Verfolgung von vermeintlichen Widerstandskämpfern hervor. Die Arbeit kündigt die Struktur an: die Darstellung der Entwicklung des militärischen Widerstandes, der Planung und Durchführung des Attentats sowie die Analyse der Konsequenzen. Der Reichtum an verfügbaren Quellenmaterialien wird ebenfalls erwähnt.
2. Ereignisse vor dem 20. Juli 1944: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des militärischen Widerstandes gegen das NS-Regime, von seinen Anfängen bis hin zu den unmittelbaren Vorbereitungen des Attentats. Es beleuchtet die verschiedenen Gruppierungen im Widerstand, ihre Motivationen und Strategien, sowie die Herausforderungen und Schwierigkeiten, denen sie begegneten. Die Analyse konzentriert sich auf die Faktoren, die letztendlich zum Umsturzversuch führten, inklusive der zunehmenden Erkenntnis der katastrophalen Lage Deutschlands im Krieg und der moralischen Ablehnung der NS-Ideologie.
3. Die Ereignisse am 20. Juli 1944 und ihre Konsequenzen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Ablauf des Attentats vom 20. Juli 1944 und den darauffolgenden Umsturzversuch. Es analysiert die Gründe für das Scheitern des Staatsstreichs, die Reaktionen des nationalsozialistischen Regimes auf das Attentat und die daraus resultierenden Konsequenzen, insbesondere die brutale Verfolgung und Hinrichtung der beteiligten Widerstandskämpfer und ihrer Unterstützer. Die Analyse umfasst die verschiedenen Aspekte des Scheiterns, von der fehlenden Unterstützung durch Teile der Wehrmacht bis hin zur effizienten und schnellen Reaktionsfähigkeit des NS-Apparats.
Schlüsselwörter
Attentat vom 20. Juli 1944, Militär Widerstand, Drittes Reich, Nationalsozialismus, Staatsstreich, Claus Graf Stauffenberg, Widerstandsgruppen, Konsequenzen, Volksgerichtshof, Hitler.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Militärischer Widerstand gegen das NS-Regime und das Attentat vom 20. Juli 1944"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht über den militärischen Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime in Deutschland, mit besonderem Fokus auf das Attentat vom 20. Juli 1944 und den gescheiterten Umsturzversuch. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die Entwicklung des militärischen Widerstandes im Dritten Reich, die Motivationen und Ziele der Widerstandskämpfer, die Planung und Durchführung des Attentats vom 20. Juli 1944, das Scheitern des Staatsstreichs und die Reaktion des NS-Regimes, sowie die Konsequenzen des Attentats für die Beteiligten und das Dritte Reich. Die Ereignisse vor und nach dem 20. Juli 1944 werden detailliert analysiert.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Ereignisse vor dem 20. Juli 1944 (mit Unterkapiteln zur Entwicklung des militärischen Widerstandes und der Phase vor dem Umsturzversuch), die Ereignisse am 20. Juli 1944 und ihre Konsequenzen (mit Unterkapiteln zum Scheitern des Staatsstreichs und den Konsequenzen des NS-Staatsapparates), Zusammenfassung, Bibliographie und eine Biographie von Oberst Claus Graf Stauffenberg.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument untersucht den militärischen Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime und den gescheiterten Umsturzversuch vom 20. Juli 1944. Die Analyse umfasst die Vorgeschichte des Attentats, die Ereignisse des Tages selbst und die unmittelbaren Folgen für die Beteiligten und das Regime.
Wer sind die zentralen Figuren im Dokument?
Eine zentrale Figur ist Oberst Claus Graf Stauffenberg, der Hauptorganisator des Attentats. Weitere wichtige Personen werden im Kontext des militärischen Widerstandes und der Reaktionen des NS-Regimes behandelt, darunter Hermann Göring und Henning von Tresckow.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Attentat vom 20. Juli 1944, Militärwiderstand, Drittes Reich, Nationalsozialismus, Staatsstreich, Claus Graf Stauffenberg, Widerstandsgruppen, Konsequenzen, Volksgerichtshof, Hitler.
Welche Quellen werden im Dokument verwendet?
Das Dokument erwähnt den Reichtum an verfügbaren Quellenmaterialien, jedoch werden die spezifischen Quellen nicht im FAQ aufgeführt. Eine detaillierte Bibliographie ist Teil des Dokuments.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse der Thematik in strukturierter und professioneller Weise. Es ist besonders relevant für die Forschung zum militärischen Widerstand im Dritten Reich und dem Attentat vom 20. Juli 1944.
- Citation du texte
- Magister Artium Michael Krinzeßa (Auteur), 1996, Das Attentat vom 20. Juli 1944, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9374