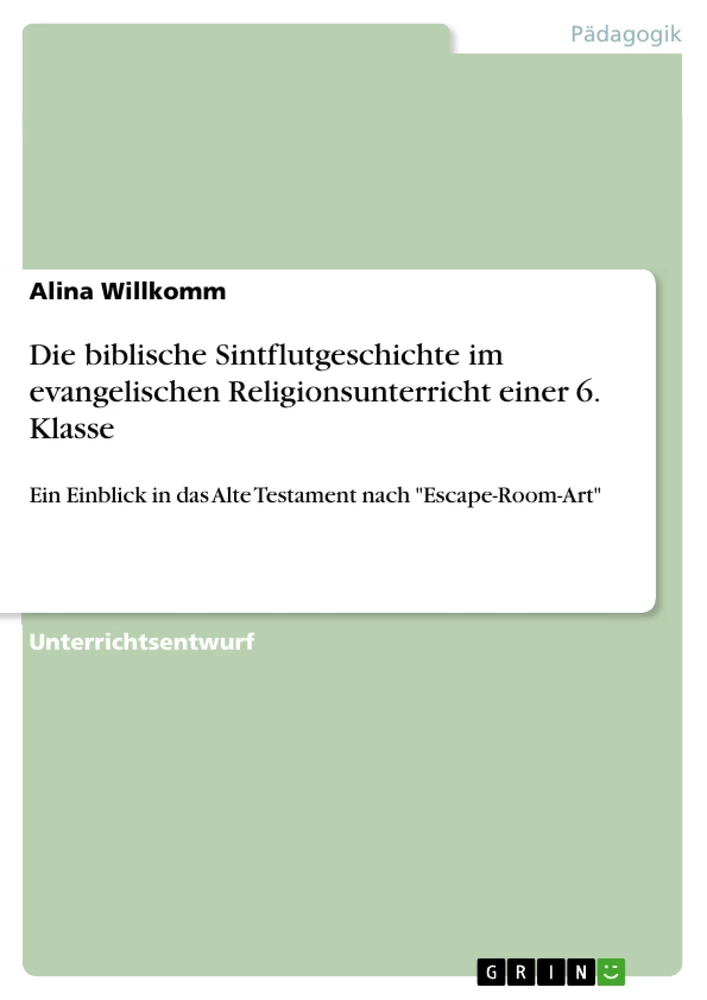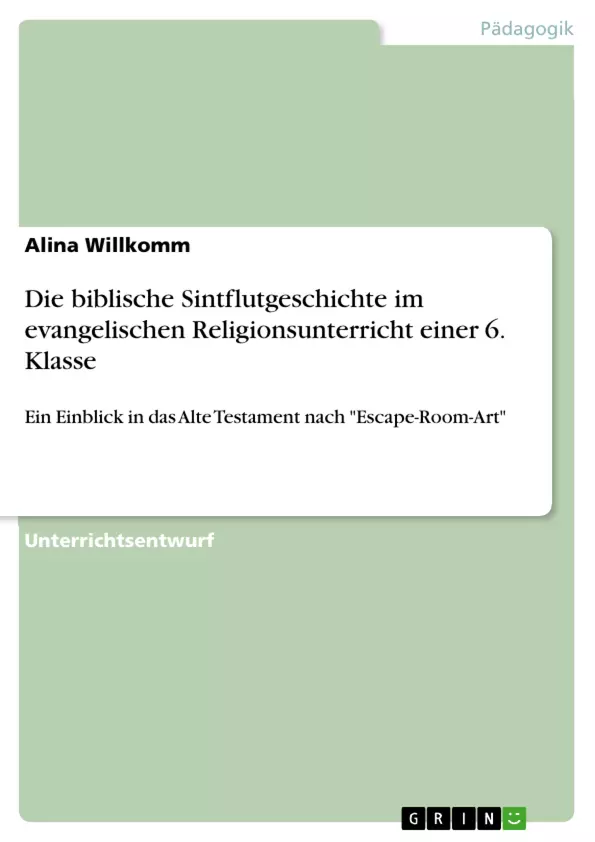Dieser Unterrichtsentwurf für das Fach evangelische Religionslehre einer 6. Klasse in NRW thematisiert die Sintflutgeschichte nach „Escape-Room-Art“. Es handelt sich also um einen Wettbewerb in dem die SuS als Ermittler aktiviert werden und ein Problem/Rätsel lösen sollen. Sie gehört zu der Unterrichtsreihe "Der Umgang mit der Bibel - Das ist doch gar nicht schwer!".
Der zentrale didaktische Schwerpunkt liegt bei dem inhaltlichen Verständnis der Sintflutgeschichte und dem Bezug des Inhalts auf die heutige Lebenswelt, verbunden mit der Beschreibung, was man heute als der Geschichte aus christlicher Sicht lernen kann. Daraus ergibt sich ein Gegenwartsbezug und damit eine Verknüpfung der Unterrichtsstunde zur Lebenswelt der SuS.
Die Unterrichtsstunde ist subjektorientiert angelegt, sie stellt die SuS zum einen ins Zentrum der Stundenhandlung und zum anderen gibt sie ihnen die Möglichkeit, an ihre Lebensgeschichten anzuknüpfen und damit den Religionsunterricht zu gestalten.
Die SuS können den Inhalt der Sintflutgeschichte (Gen 6, 1-9,29) anhand von Rätseln erschließen und kriteriengeleitet den Inhalt der Sintflutgeschichte untersuchen und ihre Bedeutung für das heutige Leben beschreiben. Dadurch können sie Beispiele für verantwortungsbewusstes Handeln in der eigenen Lebenswelt entwickeln und in Grundzügen wiedergeben, welchen Aspekt der Lebensorientierung die Sintflutgeschichte beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Längerfristige Unterrichtszusammenhänge
- 1. Leitgedanken
- 2. Curriculare Legitimation
- 3. Nachhaltiger Kompetenzaufbau
- 4. Überprüfung des Lern- und Kompetenzzuwachses
- 5. Übersicht über die Unterrichtsreihe
- Teil II: Inhalte der Unterrichtsstunde
- 1. Lehr- und Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
- 2. Sachanalyse der Stunde
- 3. Zentraler didaktischer Schwerpunkt der Stunde
- 4. Angabe des Lernzuwachses: Lernziele der Stunde
- 5. Begründung der eingesetzten Medien
- 6. Begründung der gewählten Methodenkonzeption
- 7. Informationen zu Lern- und Arbeitsverhalten, zur Differenzierung und Individualisierung
- 8. Verlaufsplan der Stunde
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Umsetzung einer Unterrichtseinheit zum Thema „Die Sintflutgeschichte nach Escape-Room-Art“ im Rahmen einer längeren Unterrichtsreihe zum Umgang mit der Bibel. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern einen lebendigen und interaktiven Zugang zu biblischen Texten zu ermöglichen und sie dabei gleichzeitig zu befähigen, die Bedeutung der Bibel als Urkunde des Glaubens zu verstehen. Die Arbeit beleuchtet die curriculare Einbettung der Unterrichtsreihe, die Förderung nachhaltiger Kompetenzen sowie die didaktische Gestaltung der einzelnen Unterrichtseinheiten.
- Der Umgang mit der Bibel im Religionsunterricht
- Die Bedeutung der Bibel als Urkunde des Glaubens
- Handlungsorientierte Lernformen im Religionsunterricht
- Die Förderung von Kompetenzen im Bereich der Bibelerklärung und der Religionsdidaktik
- Die didaktische Relevanz von Escape Rooms im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: Längerfristige Unterrichtszusammenhänge
- Leitgedanken: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung der Bibel im christlichen Glauben und die Herausforderungen, die sich aus dem Umgang mit biblischen Texten im Religionsunterricht ergeben. Die Relevanz der Bibelarbeit wird sowohl aus theologischer als auch aus bildungstheoretischer Perspektive begründet. Die Arbeit mit der Bibel soll Schülerinnen und Schülern helfen, ihre eigene Identität zu entwickeln, die Welt zu verstehen und mit ihren eigenen Lebenserfahrungen in Verbindung zu bringen.
- Curriculare Legitimation: Hier wird die Unterrichtsreihe „Der Umgang mit der Bibel – Das ist doch gar nicht schwer!“ in den Kontext des Kernlehrplans evangelische Religionslehre für Realschulen des Landes Nordrhein-Westfalen eingeordnet. Die Thematik der Unterrichtsreihe lässt sich dem Inhaltsfeld 2: Christlicher Glaube als Lebensorientierung zuordnen.
- Nachhaltiger Kompetenzaufbau: Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Unterrichtsreihe erwerben sollen. Es werden Kompetenzen in den Bereichen der Bibelerklärung, der religiösen Orientierung, der Präsentation und der kritischen Auseinandersetzung mit biblischen Texten genannt.
- Überprüfung des Lern- und Kompetenzzuwachses: Hier wird die Art und Weise der Überprüfung des Kompetenzzuwachses erläutert. Es wird auf die Bedeutung der mündlichen Mitarbeit und die Bewertung von schriftlichen Arbeiten, wie z.B. dem Diorama, hingewiesen. Die Bewertung des Dioramas ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, sich kreativ mit einer Bibelstelle auseinanderzusetzen und den Zugang zu biblischen Texten zu erleichtern.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Umgang mit der Bibel im Religionsunterricht, insbesondere mit dem Einsatz von Escape-Room-Elementen zur Vermittlung der Sintflutgeschichte. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Bibel als Urkunde des Glaubens, die didaktische Gestaltung von Unterrichtseinheiten zum Thema Bibel und die Förderung von Kompetenzen in den Bereichen der Bibelerklärung, der religiösen Orientierung und der kritischen Auseinandersetzung mit biblischen Texten.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Sintflutgeschichte im Religionsunterricht vermittelt?
Die Vermittlung erfolgt handlungsorientiert nach „Escape-Room-Art“, wobei die Schüler als Ermittler Rätsel lösen, um sich den Textinhalt zu erschließen.
Was ist das Ziel dieser Unterrichtseinheit für die 6. Klasse?
Ziel ist es, ein inhaltliches Verständnis der Geschichte zu erlangen und deren Bedeutung als Lebensorientierung für die heutige Zeit und das eigene Handeln zu reflektieren.
Was bedeutet Subjektorientierung in diesem Entwurf?
Die Schüler stehen im Zentrum des Geschehens und erhalten die Möglichkeit, ihre eigenen Lebensgeschichten und Erfahrungen in den Unterricht einzubringen.
Welche Kompetenzen werden durch die Erstellung eines Dioramas gefördert?
Das Diorama ermöglicht eine kreative Auseinandersetzung mit Bibelstellen und erleichtert den Zugang zu komplexen religiösen Texten.
Wie wird der Lernzuwachs in dieser Reihe überprüft?
Die Überprüfung erfolgt durch die Beobachtung der mündlichen Mitarbeit sowie die Bewertung der erstellten kreativen Produkte wie dem Diorama.
- Quote paper
- Alina Willkomm (Author), 2020, Die biblische Sintflutgeschichte im evangelischen Religionsunterricht einer 6. Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937436