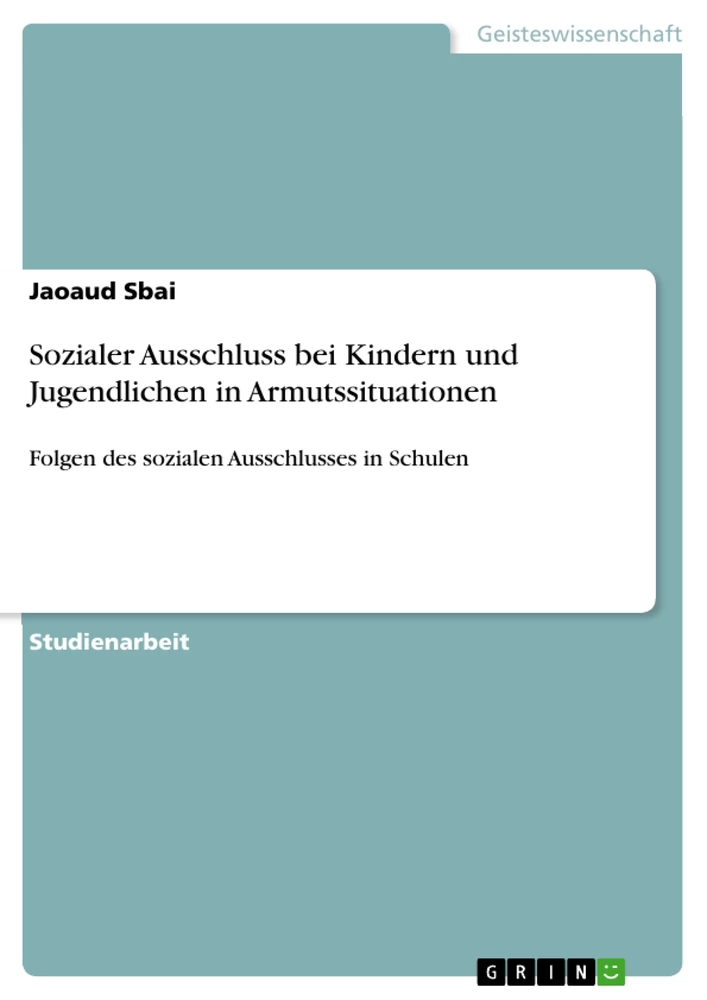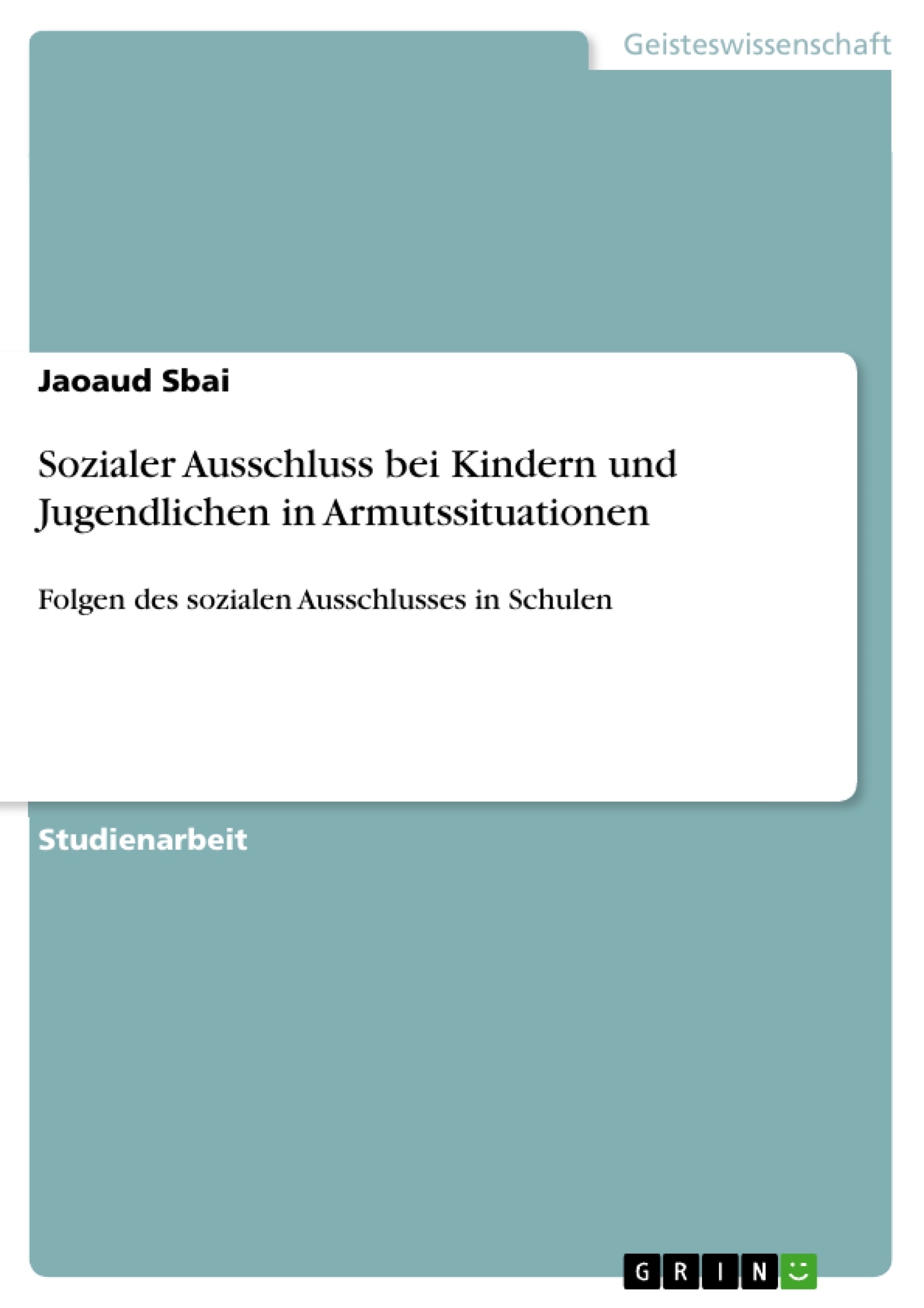In der Arbeit wird die Thematik des sozialen Ausschlusses im Kontext Schule begutachtet. Ebenso wird sich mit der Frage: "Inwieweit führt der mangelnde Zugang zu materiellen Gütern bei Kindern und Jugendlichen zur sozialen Ausschließung und Ausgrenzung an Schulen?" beschäftigt.
Soziale Ausschließung und Ausgrenzung ist ebenso schwer auseinanderzuhalten, wie Armut, Armutsgefährdung und Unterversorgung. Speziell Kindern und Jugendlichen fällt es schwerer, aus dem bereits vorhandenen sozialen Umfeld auszubrechen. Die Problematik hierbei ist jedoch nicht, dass es eine Selbstverschuldung der Betroffenen ist, so wie die neoliberale Weltansicht vorgibt, sondern eine Abwärtsspirale, die sich an mangelndem Zugang von sozialer Teilhabe, Möglichkeiten, Chancen und schulischen Misserfolgen bedient.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Einführung in den Themenbereich
- Relative Armut an Schulen
- Kinder- und Jugendarmut
- Folgen der sozialen Ausschließung an Schulen
- Medienaktivitäten in Schulen
- Cybermobbing
- Diagnose, Intervention und Prävention an Schulen
- Interventionsmöglichkeiten
- Der „No Blame Approach“ Ansatz
- Prävention
- Fazit
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht soziale Ausgrenzung im schulischen Kontext und befasst sich mit der Frage, inwieweit der mangelnde Zugang zu materiellen Gütern bei Kindern und Jugendlichen zu sozialer Ausgrenzung an Schulen führt. Die Arbeit analysiert die Zusammenhänge zwischen Armut, sozialer Ausgrenzung und den daraus resultierenden Folgen für betroffene Kinder und Jugendliche.
- Definition und Dimensionen sozialer Ausgrenzung
- Zusammenhang zwischen Armut und sozialer Ausgrenzung
- Folgen sozialer Ausgrenzung für Kinder und Jugendliche (materiell, sozial, gesundheitlich, etc.)
- Soziale Ausgrenzung an Schulen und deren Auswirkungen
- Interventions- und Präventionsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Ausgrenzung im schulischen Kontext ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen mangelndem Zugang zu materiellen Gütern und sozialer Ausgrenzung an Schulen. Sie hebt die Schwierigkeit hervor, Armut, Armutsgefährdung und Unterversorgung voneinander abzugrenzen, und betont die Notwendigkeit, den Begriff der sozialen Ausgrenzung zu klären, um die Zusammenhänge mit Armut und Ausgrenzung zu verstehen. Die Einleitung skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit und kündigt die Analyse der Folgen sozialer Ausgrenzung für Kinder und Jugendliche an.
Relative Armut an Schulen: Dieses Kapitel definiert relative Armut als Unterversorgung an materiellen und immateriellen Gütern im Vergleich zum gesellschaftlichen Wohlstand. Es beleuchtet unterschiedliche Definitionen von Armut, Armutsrisiko und Unterversorgung und kritisiert die Pauschalität bestehender Messungen. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die relative Armut für Kinder und Jugendliche in Bezug auf die Teilhabe am sozialen Leben und den Zugang zu materiellen Gütern wie Handys und Computern darstellt, wobei die Diskussion um die Armuts- und Armutsgefährdungsschwelle im Kontext von Metropolregionen eine zentrale Rolle spielt. Die Undurchsichtigkeit der Armutsmessung und das Fehlen detaillierterer Informationen über den Abstand zur Armutsgefährdung werden als Kritikpunkte hervorgehoben.
Kinder- und Jugendarmut: Dieses Kapitel untersucht Kinder- und Jugendarmut unter Berücksichtigung des kindbezogenen Armutskonzepts der AWO-ISS Studie. Es betont die Notwendigkeit, individuelle Lebensverhältnisse und subjektive Wahrnehmungen junger Menschen in die Armutsdefinition einzubeziehen, während gleichzeitig der Zusammenhang zur Gesamtsituation und den elterlichen Verhältnissen berücksichtigt wird. Die Analyse stützt sich auf ein mehrdimensionales Armutsverständnis, welches neben dem Einkommen auch materielle, soziale, gesundheitliche und kulturelle Aspekte einbezieht. Drei Lebenslagetypen – Wohlergehen, Benachteiligung und Multiple Deprivation – werden anhand von Indikatoren beschrieben, um die unterschiedlichen Auswirkungen von Armut auf Kinder und Jugendliche zu verdeutlichen. Das Kapitel betont den Unterschied zu allgemeinen Armutsdefinitionen, die auch auf Erwachsene angewendet werden.
Schlüsselwörter
Soziale Ausgrenzung, Schulischer Kontext, Kinderarmut, Jugendarmut, Materielle Benachteiligung, Soziale Teilhabe, Armutsgefährdung, Interventionsmöglichkeiten, Prävention, Cybermobbing.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziale Ausgrenzung im schulischen Kontext
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht soziale Ausgrenzung im schulischen Kontext und den Zusammenhang zwischen mangelndem Zugang zu materiellen Gütern bei Kindern und Jugendlichen und deren sozialer Ausgrenzung in der Schule. Analysiert werden die Beziehungen zwischen Armut, sozialer Ausgrenzung und deren Folgen für betroffene Kinder und Jugendliche.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Dimensionen sozialer Ausgrenzung, den Zusammenhang zwischen Armut und sozialer Ausgrenzung, die Folgen sozialer Ausgrenzung (materiell, sozial, gesundheitlich etc.), soziale Ausgrenzung an Schulen und deren Auswirkungen sowie Interventions- und Präventionsmöglichkeiten. Besondere Aufmerksamkeit wird der relativen Armut an Schulen und der Kinder- und Jugendarmut gewidmet, inklusive verschiedener Armutsdefinitionen und -messungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu relativer Armut an Schulen, Kinder- und Jugendarmut, Folgen der sozialen Ausgrenzung (inkl. Cybermobbing und Medienaktivitäten), Interventions- und Präventionsmöglichkeiten (z.B. der "No Blame Approach"), ein Fazit und eine Literaturliste. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung der behandelten Aspekte.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit der mangelnde Zugang zu materiellen Gütern bei Kindern und Jugendlichen zu sozialer Ausgrenzung an Schulen führt. Zusätzlich wird untersucht, wie Armut, Armutsgefährdung und Unterversorgung voneinander abgegrenzt werden können und wie ein umfassendes Verständnis von sozialer Ausgrenzung erreicht werden kann.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Analyse bestehender Literatur und Konzepte. Im Kapitel zu Kinder- und Jugendarmut wird das kindbezogene Armutskonzept der AWO-ISS Studie herangezogen. Es wird ein mehrdimensionales Armutsverständnis verwendet, das neben dem Einkommen auch materielle, soziale, gesundheitliche und kulturelle Aspekte einbezieht.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen? (Ohne den Inhalt des Fazits zu verraten)
Die Arbeit analysiert die komplexen Zusammenhänge zwischen Armut, sozialer Ausgrenzung und deren Folgen für Kinder und Jugendliche im schulischen Kontext. Sie beleuchtet verschiedene Definitionen von Armut und deren Herausforderungen für die Messung und zeigt verschiedene Interventions- und Präventionsmöglichkeiten auf.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Soziale Ausgrenzung, Schulischer Kontext, Kinderarmut, Jugendarmut, Materielle Benachteiligung, Soziale Teilhabe, Armutsgefährdung, Interventionsmöglichkeiten, Prävention, Cybermobbing.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Personen, die sich mit den Themen soziale Ausgrenzung, Kinderarmut und Jugendhilfe befassen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Themen und Zusammenhängen in strukturierter und professioneller Weise.
- Quote paper
- Jaoaud Sbai (Author), 2018, Sozialer Ausschluss bei Kindern und Jugendlichen in Armutssituationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937454