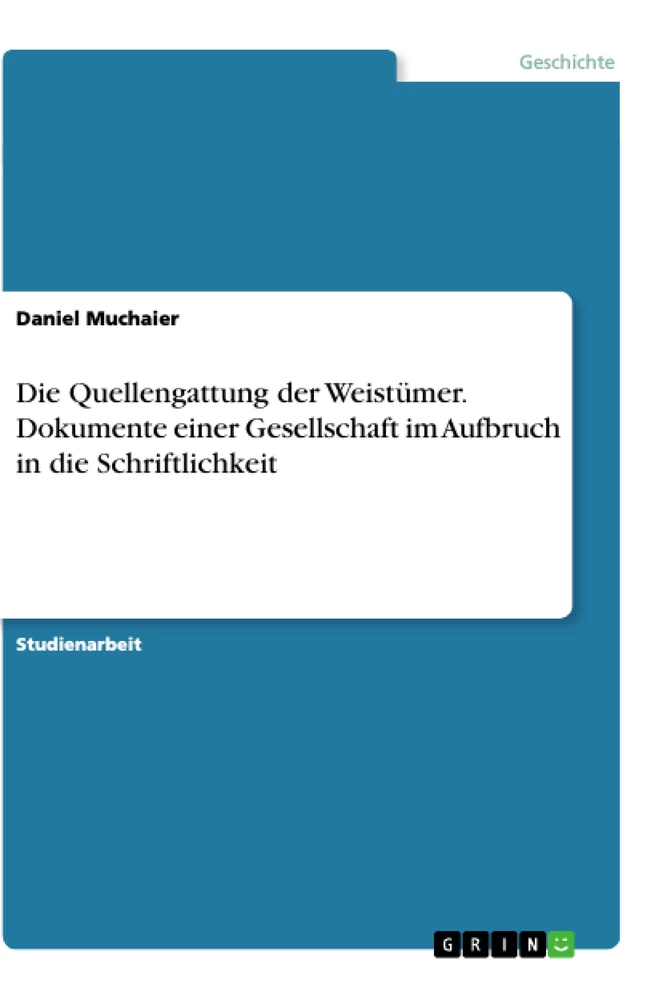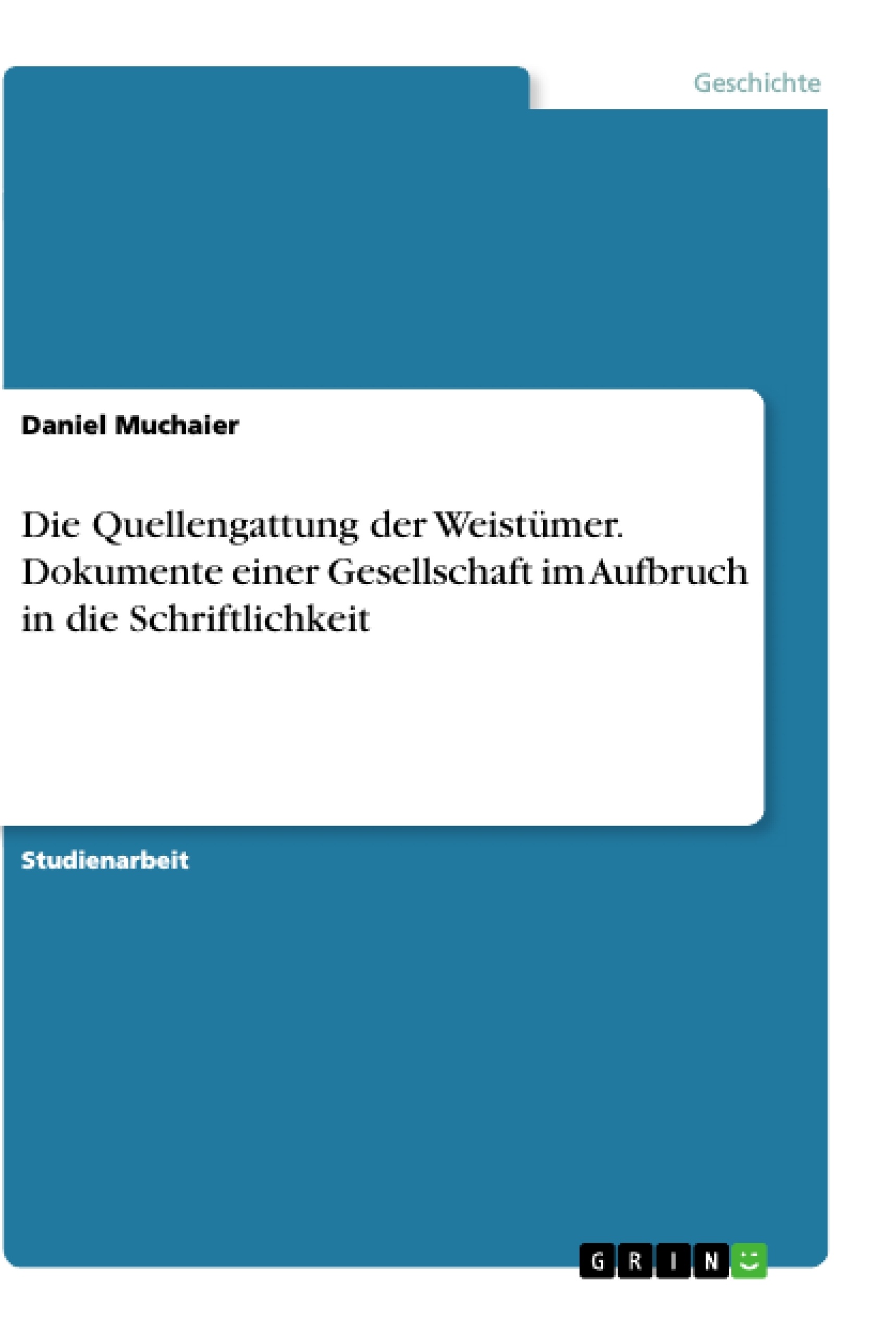In dieser Arbeit wird die Quellengattung der Weistümer behandelt. Als eine der wenigen schriftlichen Quellen der mittelalterlichen Landbevölkerung wird ihre besondere Bedeutung im Zusammenhang mit dem Prozess der Rechtsverschriftlichung herausgestellt. Zunächst wird der Begriff der Weistümer und seine Eigenschaften geklärt und anschließend exemplarisch an zwei ausgewählten Weistümern Merkmale einer Gesellschaft, die sich für ihre Rechtstradierung sowohl skripturaler als auch oraler Mittel bediente, identifiziert und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Weistumsbegriff
- 3. Struktur der Weistümer
- 4. Die Quellen
- 4.1 Weistum über die Zentrügepflicht der Bauern von Drügendorf
- 4.2 Die Offnung von Weiler
- 5. Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- 5.1 Die Bedeutung des kollektiven Gedächtnisses
- 5.2 Merkmale einer semiliteralen Gesellschaft in den Weistumstexten
- 6. Folgen der Rechtsverschriftlichung
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Weistümern als Dokumente des Übergangs von einer oralen zu einer schriftlichen Kultur im ländlichen Raum des Mittelalters. Sie analysiert die Weistümer nicht nur unter rechtshistorischen Aspekten, sondern auch im Kontext der gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen dieser Zeit.
- Der Wandel von mündlicher zu schriftlicher Rechtskultur
- Die Rolle des kollektiven Gedächtnisses in der ländlichen Gesellschaft
- Die Charakteristika einer semiliteralen Gesellschaft anhand von Weistumstexten
- Herrschaftliche und bäuerliche Interessen in den Weistümern
- Die Bedeutung von Weistümern als historische Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von Weistümern als Dokumente des Übergangs von einer mündlichen zu einer schriftlichen Kultur im Mittelalter. Sie kritisiert vereinfachte Darstellungen der bäuerlichen Bevölkerung im Mittelalter und hebt die Weistümer als wichtige Quelle hervor, um ein authentischeres Bild zu zeichnen. Die Einleitung diskutiert unterschiedliche Forschungsansätze zur Interpretation von Weistümern, von Jacob Grimms romantischer Sicht bis hin zur pragmatischeren Betrachtung der „Wiener Schule“, und betont die Bedeutung interdisziplinärer Forschung im Umgang mit diesen Quellen.
2. Zum Weistumsbegriff: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs „Weistum“ und der Rolle Jacob Grimms in der Etablierung der Weistumsforschung. Es beschreibt Weistümer als kollektive Aussagen rechtskundiger Männer über bestehendes Recht und diskutiert verschiedene regionale Bezeichnungen für ähnliche Dokumente. Der Kapitel erläutert die Schwierigkeiten, Weistümer von anderen ländlichen Rechtsquellen abzugrenzen, und präsentiert vier charakteristische Merkmale, die von Prosser zusammengefasst wurden: lokale Begrenzung, bäuerlich-ländlicher Inhalt, retrospektive Natur der Rechtsfindung und die Berufung auf altes Recht.
3. Struktur der Weistümer: (Anmerkung: Da der bereitgestellte Text keine explizite Strukturbeschreibung der Weistümer enthält, kann hier keine Zusammenfassung dieses Kapitels erstellt werden. Eine solche Zusammenfassung würde die Analyse der inneren Struktur, der Gliederung und des Aufbaus der Weistümer erfordern, was im gegebenen Text nicht vorhanden ist.)
4. Die Quellen: Dieses Kapitel präsentiert zwei Fallstudien: das Weistum über die Zentrügepflicht der Bauern von Drügendorf und die Offnung von Weiler. Diese konkreten Beispiele dienen als Grundlage für die weitere Analyse der semiliteralen Gesellschaft und der Übergangszeit zwischen mündlicher und schriftlicher Kultur. Die Kapitel stellt die Quellen und deren Kontexte dar, um anschließend eine detaillierte Analyse im Kontext des Gesamtwerks vorzunehmen.
5. Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des kollektiven Gedächtnisses und die Merkmale einer semiliteralen Gesellschaft, die sich in den Weistumstexten zeigen. Es analysiert, wie mündliche Traditionen in schriftliche Form gebracht wurden und welche kulturellen und gesellschaftlichen Implikationen dieser Prozess hatte. Die Analyse verbindet die Ergebnisse mit den zuvor besprochenen Quellen, um die Charakteristika der semiliteralen Gesellschaft zu beleuchten.
6. Folgen der Rechtsverschriftlichung: (Anmerkung: Da der bereitgestellte Text keinen expliziten Abschnitt mit dem Titel "Folgen der Rechtsverschriftlichung" aufweist, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden. Um dieses Kapitel zusammenzufassen, wäre eine detailliertere Beschreibung der Konsequenzen der Verschriftlichung des Rechts im Kontext des vorliegenden Textes erforderlich.)
Schlüsselwörter
Weistümer, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Rechtsgeschichte, ländliche Gesellschaft, Mittelalter, kollektives Gedächtnis, semiliterale Gesellschaft, Jacob Grimm, Rechtsverschriftlichung, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Weistümern als Dokumente des Übergangs von einer oralen zu einer schriftlichen Kultur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Weistümern als Dokumente des Übergangs von einer mündlichen zu einer schriftlichen Kultur im ländlichen Raum des Mittelalters. Sie analysiert Weistümer unter rechtshistorischen, gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten.
Was sind Weistümer?
Weistümer sind kollektive Aussagen rechtskundiger Männer über bestehendes Recht. Sie sind lokal begrenzt, bäuerlich-ländlich im Inhalt, retrospektiv in der Rechtsfindung und berufen sich auf altes Recht. Der Begriff und die Forschung dazu wurden maßgeblich von Jacob Grimm geprägt, jedoch ist die Abgrenzung zu anderen ländlichen Rechtsquellen schwierig.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert zwei Fallstudien: das Weistum über die Zentrügepflicht der Bauern von Drügendorf und die Offnung von Weiler. Diese dienen als Grundlage für die Analyse der semiliteralen Gesellschaft und des Übergangs zwischen mündlicher und schriftlicher Kultur.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel von mündlicher zu schriftlicher Rechtskultur, die Rolle des kollektiven Gedächtnisses in der ländlichen Gesellschaft, die Charakteristika einer semiliteralen Gesellschaft anhand von Weistumstexten, herrschaftliche und bäuerliche Interessen in den Weistümern und die Bedeutung von Weistümern als historische Quellen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, zum Weistumsbegriff, zur Struktur der Weistümer, den Quellen (mit den Fallstudien), dem Übergang zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, den Folgen der Rechtsverschriftlichung und einem Fazit. Die Kapitel behandeln die Definition von Weistümern, ihre Struktur, die Analyse der ausgewählten Quellen und die Interpretation im Kontext des Übergangs zwischen mündlicher und schriftlicher Kultur.
Welche Rolle spielt das kollektive Gedächtnis?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des kollektiven Gedächtnisses in der ländlichen Gesellschaft und wie mündliche Traditionen in schriftliche Form gebracht wurden. Dies wird anhand der Analyse der Weistumstexte beleuchtet.
Was ist eine semiliterale Gesellschaft?
Die Arbeit analysiert die Merkmale einer semiliteralen Gesellschaft anhand der Weistumstexte. Es wird untersucht, wie sich die Übergangszeit zwischen mündlicher und schriftlicher Kultur in den Texten widerspiegelt.
Welche Forschungsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert unterschiedliche Forschungsansätze zur Interpretation von Weistümern, von Jacob Grimms romantischer Sicht bis hin zur pragmatischeren Betrachtung der „Wiener Schule“, und betont die Bedeutung interdisziplinärer Forschung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Weistümer, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Rechtsgeschichte, ländliche Gesellschaft, Mittelalter, kollektives Gedächtnis, semiliterale Gesellschaft, Jacob Grimm, Rechtsverschriftlichung, Quellenkritik.
- Quote paper
- Daniel Muchaier (Author), 2020, Die Quellengattung der Weistümer. Dokumente einer Gesellschaft im Aufbruch in die Schriftlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937641