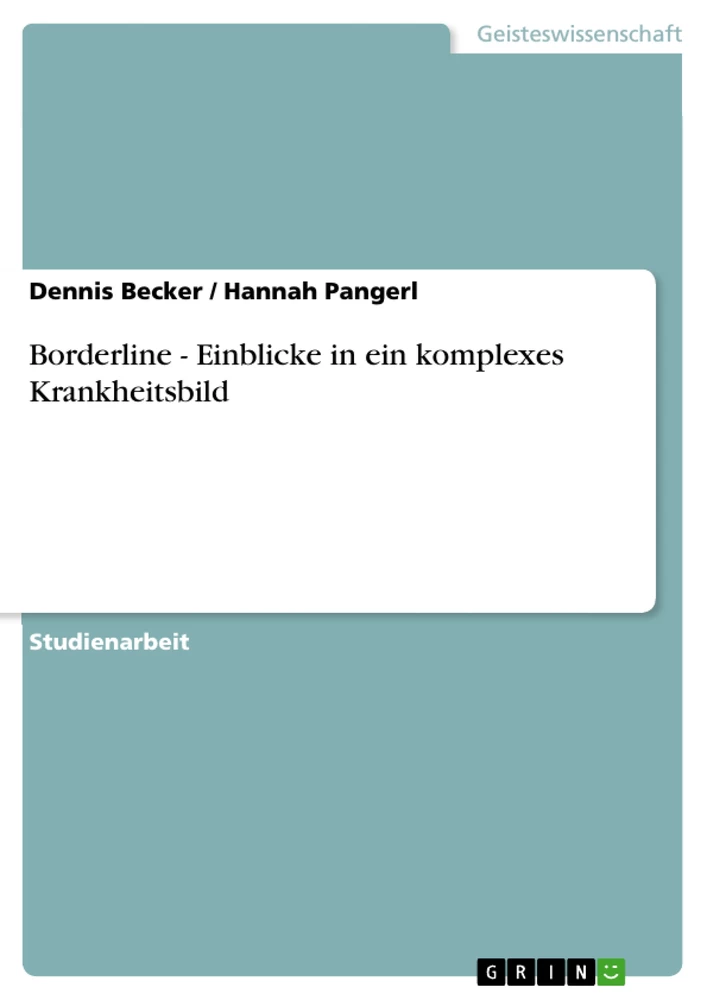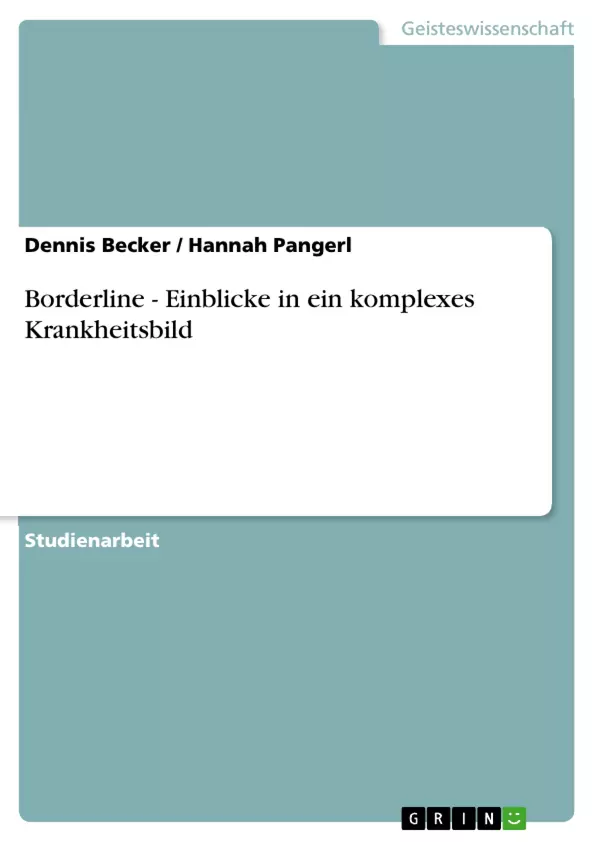Borderline - immer wieder haben wir während unseres Studiums und unserer Praktika von dieser Krankheit gehört, konnten sie jedoch nie richtig einordnen. Wir haben festgestellt, dass es auch anderen so geht, da uns auch auf Nachfrage niemand eine präzise Antwort darauf geben konnte.
Unser BPS-I haben wir beide im Bereich der Behindertenarbeit absolviert und hatten dort unter anderem Kontakt zu psychisch erkrankten Personen. Von unseren Kollegen erfuhren wir, dass der Umgang mit Borderline-Patienten aufgrund ihres wechselnden Verhaltens und ihrer Unberechenbarkeit oft mühselig sei. Keiner von ihnen strebe deshalb die Betreuung eines Betroffenen an. Auch unsere Literaturrecherche bestätigt dies, häufig haben Therapeuten Probleme bei der Behandlung von Borderline-Patienten und auch die Betroffenen selbst berichten davon, dass sie große Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Personen haben.
Während unserer Vorbereitung auf die Studienarbeit sind wir auf das Buch „Leben auf der Grenze - Erfahrungen mit Borderline“ von Andreas Knuf gestoßen, in dem Betroffene von ihrer Erkrankung berichten. Da dort sehr anschaulich beschrieben wird, wie und vor allem wie unterschiedlich der Krankheitsverlauf sein kann, werden wir zwei Erlebnisberichte verkürzt anführen. Sie sollen unterstützend zur Theorie eine bessere Verständlichkeit schaffen und einen Einblick in die Gefühlswelt eines Borderline-Patienten liefern.
Zu Beginn unserer Studienarbeit führen wir die Definition des Borderline-Syndroms nach Kernberg, ICD 10 und DSM IV auf, gefolgt von den zwei Erfahrungsberichten. Anschließend gehen wir auf die Entstehung, die Prävalenz und den Verlauf ein. Schließlich befassen wir uns mit Therapiemöglichkeiten und der medikamentösen Behandlung.
Wir wollen durch unsere Studienarbeit einen ersten Einblick in das wohl sehr komplexe Krankheitsbild erhalten und klären, ob der Umgang mit Betroffenen wirklich so problematisch ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 2.1 Definition nach Kernberg
- 2.2 Definition nach ICD-10
- 2.3 Definition nach DSM-IV
- 3. Erfahrungsberichte
- 4. Entstehung, Prävalenz und Verlauf
- 4.1 Entstehung
- 4.2 Prävalenz und Verlauf
- 5. Therapie
- 5.1 Therapiemethoden
- 5.2 Ambulante analytische Therapie
- 5.3 Stationäre Psychotherapie
- 5.4 Erwartungen an die Therapie
- 6. Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Einblick in das komplexe Krankheitsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu geben. Die Arbeit untersucht die Schwierigkeiten im Umgang mit Betroffenen und hinterfragt die oft problematische Wahrnehmung dieser Erkrankung.
- Definition und Abgrenzung der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach verschiedenen Klassifikationssystemen (Kernberg, ICD-10, DSM-IV).
- Entstehung, Prävalenz und Verlauf der Borderline-Persönlichkeitsstörung.
- Beschreibung verschiedener Therapiemethoden und deren Wirksamkeit.
- Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten bei Borderline.
- Analyse von Erfahrungsberichten, um die subjektive Wahrnehmung der Erkrankung zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung ein und beschreibt die Motivation der Autoren, sich mit diesem komplexen Krankheitsbild auseinanderzusetzen. Ausgehend von persönlichen Erfahrungen im Bereich der Behindertenarbeit und der Schwierigkeit, präzise Informationen über Borderline zu finden, wird der Fokus der Arbeit auf die Klärung des Umgangs mit Betroffenen gelegt. Die Autoren kündigen die Struktur der Arbeit an, die Definitionen, Erfahrungsberichte, Entstehung, Verlauf, Therapie und medikamentöse Behandlung umfasst. Das Buch „Leben auf der Grenze“ von Andreas Knuf wird als wichtige Informationsquelle erwähnt.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es werden die Definitionen nach Kernberg, ICD-10 und DSM-IV erläutert und verglichen. Kernbergs Definition wird im Detail dargestellt, wobei acht typische Symptome benannt werden, die im Zusammenspiel auf eine Borderline-Erkrankung hindeuten können. Die Kapitel veranschaulicht die Komplexität der Diagnose und die Schwierigkeiten einer präzisen Definition aufgrund der schwankenden Symptomatik und individuellen Ausprägungen der Störung.
3. Erfahrungsberichte: Dieses Kapitel präsentiert Erfahrungsberichte von Betroffenen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Obwohl die Berichte selbst hier nicht im Detail wiedergegeben sind, wird ihre Bedeutung für das Verständnis der Erkrankung betont. Die Berichte sollen einen Einblick in die subjektiven Erfahrungen und die Gefühlswelt von Betroffenen ermöglichen und die theoretischen Ausführungen ergänzen.
4. Entstehung, Prävalenz und Verlauf: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung, die Häufigkeit und den Verlauf der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Obwohl die genauen Inhalte hier nicht wiedergegeben werden, geht es um die Faktoren, die zur Entstehung beitragen, wie häufig diese Störung auftritt und wie sich die Krankheit im Laufe der Zeit entwickeln kann. Die Analyse wird wahrscheinlich sowohl biologische als auch psychosoziale Faktoren einbeziehen.
5. Therapie: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Therapieansätzen bei Borderline. Es werden unterschiedliche Therapiemethoden vorgestellt und deren jeweilige Vor- und Nachteile diskutiert. Der Fokus liegt auf ambulanten und stationären psychotherapeutischen Behandlungen, inklusive einer Analyse der an diese Therapien geknüpften Erwartungen. Das Kapitel vermittelt einen Überblick über die vielschichtigen Möglichkeiten der Behandlung und ihrer Herausforderungen.
6. Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel befasst sich mit den medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten bei Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es werden die verschiedenen Medikamentengruppen und deren Anwendung bei Borderline beschrieben, und der Beitrag von Medikamenten im Rahmen einer Gesamttherapie wird wahrscheinlich eingeordnet.
Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung, Kernberg, ICD-10, DSM-IV, Therapie, medikamentöse Behandlung, Erfahrungsberichte, Entstehung, Prävalenz, Verlauf, psychische Erkrankung.
Häufig gestellte Fragen zur Studienarbeit: Borderline-Persönlichkeitsstörung
Was ist der Inhalt dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS). Sie beinhaltet eine Begriffsklärung anhand verschiedener Klassifikationssysteme (Kernberg, ICD-10, DSM-IV), die Untersuchung der Entstehung, Prävalenz und des Verlaufs der Störung, eine Beschreibung verschiedener Therapiemethoden (inklusive ambulanter und stationärer Psychotherapie) sowie die Darstellung medikamentöser Behandlungsmöglichkeiten. Zusätzlich werden Erfahrungsberichte von Betroffenen einbezogen, um die subjektive Wahrnehmung der Erkrankung zu beleuchten.
Welche Definitionen der Borderline-Persönlichkeitsstörung werden verwendet?
Die Arbeit vergleicht und erläutert die Definitionen der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach Kernberg, dem ICD-10 und dem DSM-IV. Kernbergs Definition wird detailliert dargestellt, inklusive der Beschreibung typischer Symptome.
Wie wird die Entstehung der Borderline-Persönlichkeitsstörung behandelt?
Das Kapitel zur Entstehung, Prävalenz und zum Verlauf der BPS untersucht die Faktoren, die zur Entstehung beitragen, wie häufig die Störung auftritt und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt. Wahrscheinlich werden sowohl biologische als auch psychosoziale Faktoren berücksichtigt.
Welche Therapiemethoden werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Therapieansätze für die Borderline-Persönlichkeitsstörung, darunter ambulante und stationäre psychotherapeutische Behandlungen. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden werden diskutiert, und es wird ein Überblick über die Herausforderungen der Behandlung gegeben.
Welche Rolle spielen Medikamente in der Behandlung?
Die Studienarbeit behandelt die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten bei BPS. Es werden verschiedene Medikamentengruppen und ihre Anwendung beschrieben, und der Beitrag der Medikamente im Rahmen einer Gesamttherapie wird eingeordnet.
Wie werden Erfahrungsberichte von Betroffenen berücksichtigt?
Erfahrungsberichte von Betroffenen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen werden vorgestellt, um die subjektive Wahrnehmung der Erkrankung und die Gefühlswelt der Betroffenen zu beleuchten und die theoretischen Ausführungen zu ergänzen.
Welche Ziele verfolgt die Studienarbeit?
Die Studienarbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Einblick in die komplexe Borderline-Persönlichkeitsstörung zu geben und die Schwierigkeiten im Umgang mit Betroffenen zu untersuchen. Ein weiterer Fokus liegt auf der oft problematischen Wahrnehmung dieser Erkrankung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Borderline-Persönlichkeitsstörung, Kernberg, ICD-10, DSM-IV, Therapie, medikamentöse Behandlung, Erfahrungsberichte, Entstehung, Prävalenz, Verlauf, psychische Erkrankung.
Welche Quellen werden genannt?
Das Buch „Leben auf der Grenze“ von Andreas Knuf wird als wichtige Informationsquelle erwähnt.
- Quote paper
- Dennis Becker (Author), Hannah Pangerl (Author), 2008, Borderline - Einblicke in ein komplexes Krankheitsbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93776