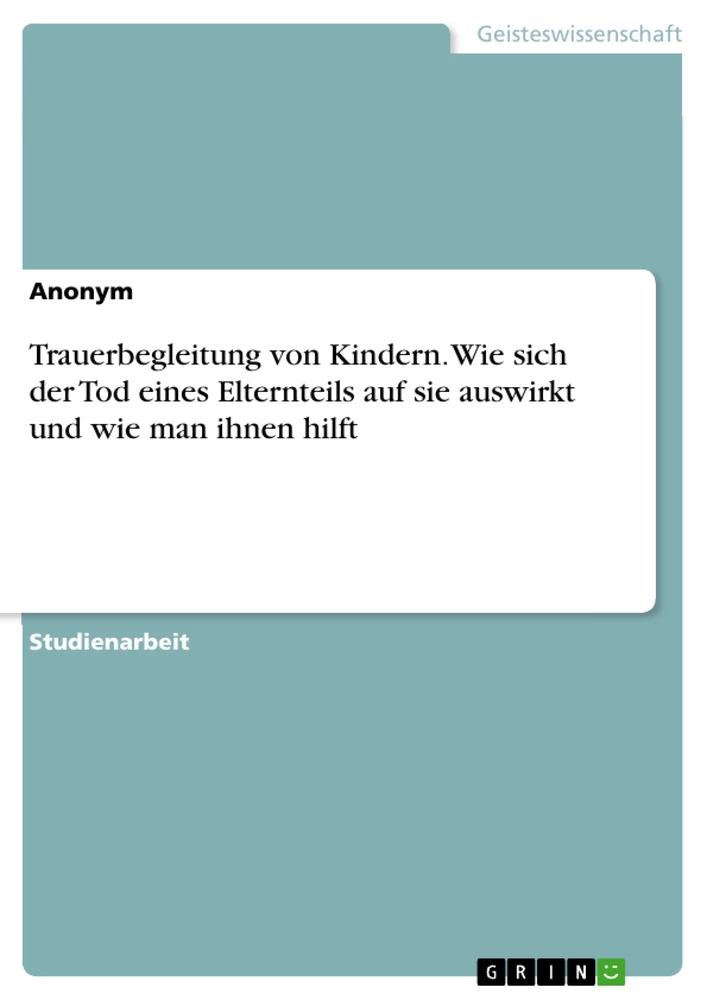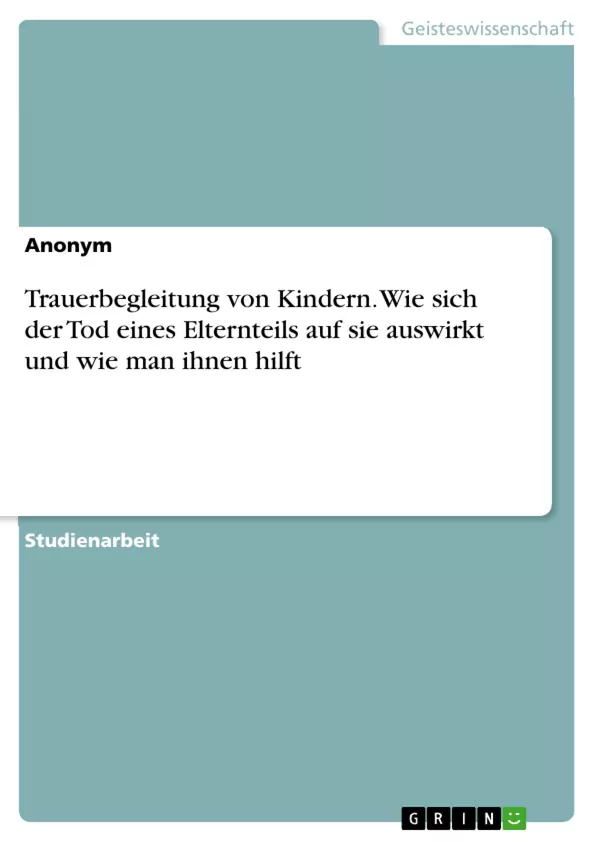Im Folgenden soll auf Erkenntnisse eingegangen werden, wie man richtig reagiert, wenn ein Kind im Alter zwischen 7 und 18 Jahren ein Elternteil verliert. Es soll geklärt werden, welche Auswirkungen solche schweren Diagnosen und Verlusterfahrungen auf die Kinder haben, wie sie trauern und was jeweils bei der Trauerarbeit und Intervention zu beachten ist. Durch die Ergebnisse, soll das Verständnis über kindliche Trauer verbessert werden. Viele Kinder verlieren vor ihrem 18ten Lebensjahr einen Elternteil. Schätzungen zufolge bekommen in Deutschland jährlich ca. 200.000 Erwachsene mit Kindern unter 18 Jahren, die Diagnose Krebs. Diese Diagnose kann möglicherweise zum Tod führen. Auch durch plötzliche Tode kommen jährlich zahlreiche Menschen ums Leben. Egal ob Ehepartner, Elternteil, Angehöriger oder Freund, es ist jedes Mal ein schwerwiegender Schicksalsschlag und Verlust, der verarbeitet werden muss. Mit Sterben, Tod und Trauer möchte niemand etwas zu tun haben, keiner möchte darüber sprechen, aber doch betrifft es jeden. In der Gesellschaft gelten diese Themen als Tabuthemen. Es gibt nicht den richtigen Moment um über solche Dinge zu sprechen. Häufig werden auch schwere Diagnosen verschwiegen. Die Möglichkeit des Todes wird nicht thematisiert und nicht besprochen, weder vom Erkrankten selbst, noch von den Angehörigen. Niemand möchte solche Verlusterfahrungen machen, allerdings passiert es immer wieder und dann stellen sich viele Fragen und es kommen Unsicherheiten auf, vor allem, wenn der Erkrankte noch jüngere Kinder hat. Aufgrund dessen ist es wichtig, schon vorher etwas über die kindliche Trauer zu wissen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Definition Trauer
- Unterschied komplizierte Trauer und posttraumatisches Belastungssyndrom
- Was versteht man unter Trauerarbeit?
- Wie trauern Kinder und Jugendliche?
- Methodik
- Ergebnisse
- Ergebnis plötzlicher Tod
- Ergebnis Sterbebegleitung
- Diskussion
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Auswirkungen des plötzlichen Todes eines Elternteils auf Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren im Vergleich zu einem erwarteten Tod mit vorangegangener Krebserkrankung und Sterbebegleitung. Die Studie beleuchtet die Besonderheiten der Trauerarbeit und Intervention in beiden Situationen. Die Analyse zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis der kindlichen Trauer und ihrer Bewältigung in verschiedenen Verlustsituationen zu entwickeln.
- Die Auswirkungen von plötzlichem Tod auf Kinder und Jugendliche
- Die Besonderheiten der Trauerarbeit bei Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle der Intervention in der Bewältigung von Trauer
- Der Vergleich zwischen plötzlichem Tod und Sterbebegleitung
- Die Bedeutung des Verständnisses der kindlichen Trauer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Trauerarbeit bei Kindern und Jugendlichen ein. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas, insbesondere im Hinblick auf die hohen Zahlen von Krebserkrankungen bei Erwachsenen mit Kindern. Das zweite Kapitel, der theoretische Rahmen, definiert den Begriff Trauer, erläutert den Unterschied zwischen komplizierter Trauer und posttraumatischem Belastungssyndrom und beleuchtet das Konzept der Trauerarbeit. Zudem wird die spezifische Trauerbewältigung von Kindern und Jugendlichen im Detail betrachtet.
Die Methodik beschreibt die Vorgehensweise bei der Literaturrecherche, die für die Beantwortung der Forschungsfrage durchgeführt wurde. Es werden die verwendeten Suchbegriffe und Datenbanken erläutert, sowie der Umgang mit älteren Texten und Literatur aus dem angloamerikanischen Raum. Das Kapitel über die Ergebnisse analysiert die Auswirkungen von plötzlichem Tod und Sterbebegleitung auf Kinder und Jugendliche.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Trauer, kindliche Trauer, plötzlicher Tod, Sterbebegleitung, Trauerarbeit, Intervention, Trauma, Verlust, Entwicklung, emotionale Verarbeitung, kindliche Entwicklungspsychologie, Familientherapie.
Häufig gestellte Fragen
Wie trauern Kinder im Vergleich zu Erwachsenen?
Kinder trauern oft in 'Pfützen' – sie können tief traurig sein und im nächsten Moment wieder spielen. Ihre Trauer ist stark entwicklungsabhängig und braucht klare Erklärungen.
Welchen Einfluss hat ein plötzlicher Tod auf die Trauerarbeit?
Ein plötzlicher Tod lässt keine Zeit für Abschiede, was das Risiko für traumatische Belastungen erhöht. Die Intervention muss hier oft stabilisierend wirken.
Was ist der Vorteil einer Sterbebegleitung für Kinder?
Bei einer Krebserkrankung ermöglicht die Sterbebegleitung den Kindern, den Prozess des Abschiednehmens bewusst zu erleben, was die Verarbeitung des Verlustes erleichtern kann.
Warum wird das Thema Tod in der Gesellschaft oft tabuisiert?
Tod und Trauer lösen Ängste und Unsicherheiten aus. Viele Erwachsene verschweigen Kindern schwere Diagnosen, um sie zu schützen, was jedoch oft zu mehr Verwirrung führt.
Wie kann man Kindern beim Verlust eines Elternteils helfen?
Wichtig sind Ehrlichkeit, altersgerechte Informationen, das Zulassen aller Gefühle und die Aufrechterhaltung von stabilen Alltagsstrukturen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Trauerbegleitung von Kindern. Wie sich der Tod eines Elternteils auf sie auswirkt und wie man ihnen hilft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937912