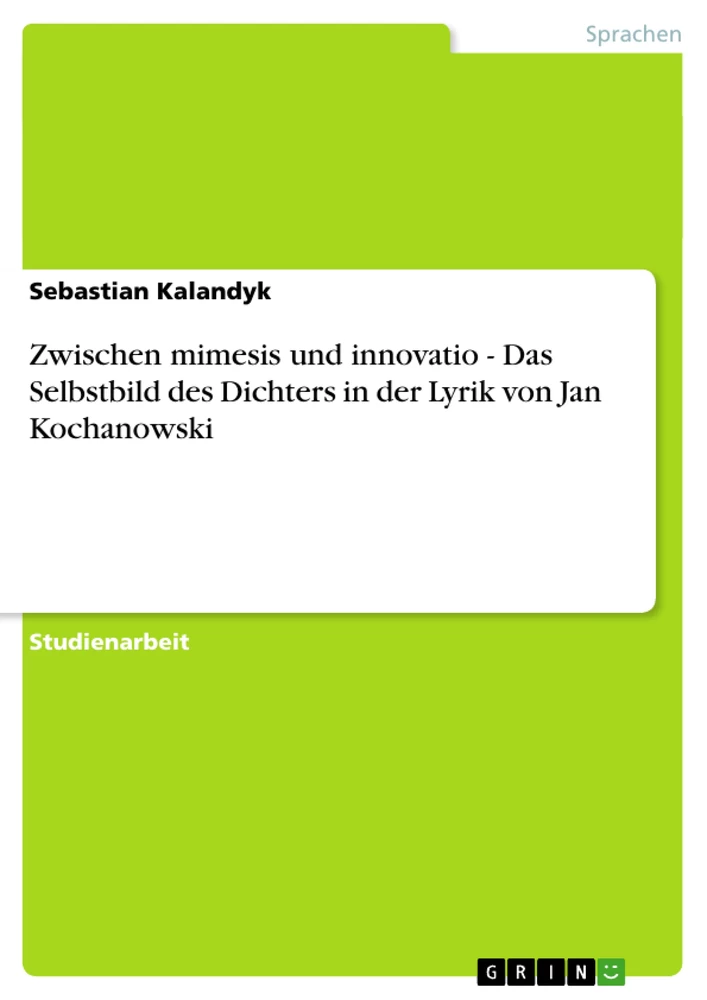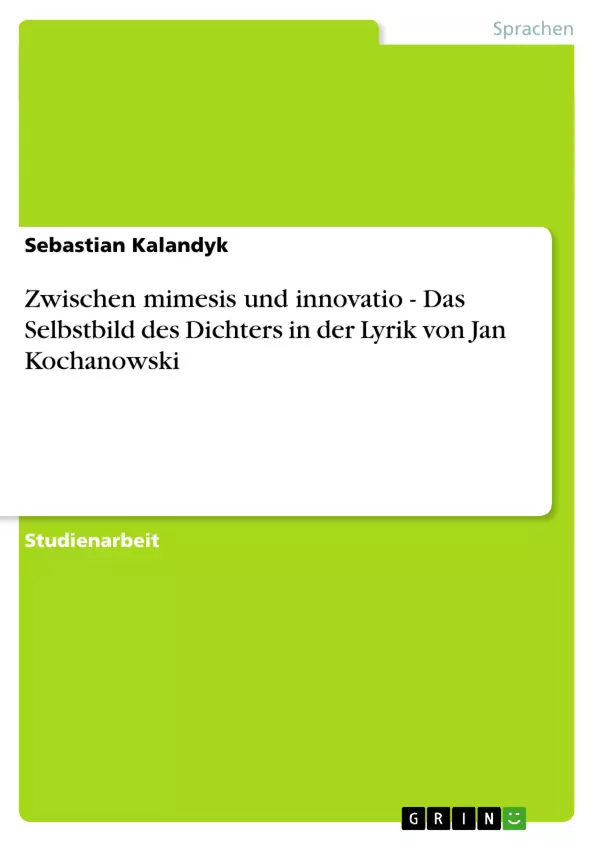Thema der vorliegenden Arbeit ist die Verarbeitung des antiken Mythos vom Flug des Dädalus und des Ikarus in der Dichtung des polnischen Renaissancepoeten Jan Kochanowski.
In Kochanowskis Interpretation des Sujets manifestiert sich sein Selbstbild als Autor. Dieses ist, wie die Ausarbeitung hoffentlich zu beweisen vermag, nicht eindeutig positioniert und nur vor dem Hintergrund der zeit-genössischen Geisteswelt und der Biografie des Dichters verständlich. Ich möchte der Frage nachgehen, welche Faktoren dazu führen, dass man in der Wissenschaft von Jan Kochanowski und Ioannes Cochanovius spricht.
Diese Untersuchung wird es nicht vermeiden können, sich zumindest teilweise der Methoden des in Kreisen von Autorschaftsforschern lange Zeit verteufelten Biografismus zu bedienen. Die Gefahren, die mit einer möglichen Betretung völligen Neulands verbunden sind, bleiben mir indes erspart. Im Falle Kochanowskis kam die Forschergemeinde schon in den 80er Jahren zu dem Ergebnis, dass das Interesse an seiner Person sehr wohl Legitimität besitzt, und dass das pauschal ausgerufene Verbot einer biografischen Betrachtung die Forschung eher behindert als unterstützt. Diese Erkenntnis mündete jedoch nicht in einem Rückfall in hemmungslosen Biografismus nach dem Muster des 19. Jahrhunderts, sondern in der Suche nach dem „implizierten Autor“, dem alter ego Kochanowskis.
Ein solcher Ansatz erscheint im Hinblick auf das Werk des Meisters aus Czarnolas angemessen, sowohl was die Fülle der von ihm gestreuten autobiografischen Angaben als auch seine Janusköpfigkeit und seine Freude an der Ambivalenz von Aussagen angeht.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen zwei kurze Texte in Versform: das Lied II 24 und Fraszka III 29 . Der Vergleich beider Texte miteinander sowie mit der Darstellung des Flugmythos bei Ovid soll zwei konträre Autorkonzepte aufzeigen, zu denen sich Kochanowski bekennt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursprung der Inspiration Kochanowskis: die antike Mythenwelt des ,,Methamorphoseon libri“
- Kochanowski und die humanistische Begeisterung für antike Meister
- Der Zimmermann als Inbegriff der Tradition: Fraszka III 29.
- Erhebung über die irdischen Dinge: Lied II 24.
- Traditionelle und innovative Aspekte in Kochanowskis Dichtung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verarbeitung des antiken Ikarus-Mythos in Jan Kochanowskis Lyrik und analysiert, wie sich darin das Selbstbild des Dichters manifestiert. Die Arbeit beleuchtet die Ambivalenz dieses Selbstbildes im Kontext der humanistischen Geisteswelt der Renaissance und Kochanowskis Biografie. Es wird untersucht, welche Faktoren zur Verwendung der Namen "Jan Kochanowski" und "Ioannes Cochanovius" führen.
- Das Selbstbild des Dichters Jan Kochanowski
- Die Auseinandersetzung mit dem antiken Mythos (Ikarus und Dädalus)
- Die Verbindung von traditioneller und innovativer Dichtung
- Der Einfluss der humanistischen Geisteswelt
- Die Rolle der Biografie in der Interpretation von Kochanowskis Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein: die Interpretation des Ikarus-Mythos in Kochanowskis Werk und die damit verbundene Darstellung seines Selbstbildes als Autor. Sie betont die Ambivalenz dieses Selbstbildes und die Notwendigkeit, es im Kontext der Zeit und der Biografie des Dichters zu verstehen. Die Arbeit konzentriert sich auf zwei kurze Gedichte, Fraszka III 29 und Lied II 24, um konträre Autorkonzepte aufzuzeigen, die in Kochanowskis Werk präsent sind. Die Methode des Biografismus wird als legitim dargestellt, unter Berücksichtigung der "implizierten Autors" als interpretatorischen Ansatz.
Ursprung der Inspiration Kochanowskis: die antike Mythenwelt des ,,Methamorphoseon libri“: Dieses Kapitel analysiert Ovids "Metamorphosen" als Quelle der Inspiration für Kochanowskis Interpretation des Ikarus-Mythos. Es fasst den Mythos bei Ovid zusammen, wobei die Handlungsstränge von Dädalus und Ikarus im Detail dargestellt werden, inklusive der Darstellung von Dädalus als genialer Handwerker und Ikarus als unvorsichtiger Sohn. Die Interpretation von Ovid durch Felix Philipp Ingold wird herangezogen, um die unterschiedlichen Positionen zum Verhältnis von Vernunft (Dädalus) und Wagemut (Ikarus) zu beleuchten. Der Bezug zu den philosophischen Debatten zwischen Platonismus und Aristotelianismus wird hergestellt, um den Kontext des Autorkonzepts zu verdeutlichen, das Ovid in seinen Metamorphosen präsentiert.
Schlüsselwörter
Jan Kochanowski, Ikarus-Mythos, Autorkonzept, Renaissance-Lyrik, polnische Literatur, humanistische Geisteswelt, Mimesis, Innovatio, Biografismus, implizierter Autor, Ovid, Metamorphosen.
Häufig gestellte Fragen zu: Interpretation des Ikarus-Mythos in Jan Kochanowskis Lyrik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Darstellung des antiken Ikarus-Mythos in der Lyrik von Jan Kochanowski und analysiert, wie sich darin das Selbstbild des Dichters manifestiert. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz dieses Selbstbildes im Kontext der humanistischen Geisteswelt der Renaissance und Kochanowskis Biografie. Die Arbeit beleuchtet auch die Verwendung der Namen "Jan Kochanowski" und "Ioannes Cochanovius".
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Hauptquelle ist Jan Kochanowskis Lyrik, insbesondere zwei kurze Gedichte: Fraszka III 29 und Lied II 24. Ein weiterer wichtiger Bezugspunkt sind Ovids "Metamorphosen", die als Inspirationsquelle für Kochanowskis Interpretation des Ikarus-Mythos dienen. Die Arbeit bezieht sich auch auf Interpretationen von Ovid, z.B. von Felix Philipp Ingold, und auf philosophische Debatten zwischen Platonismus und Aristotelianismus.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Selbstbild des Dichters Jan Kochanowski, die Auseinandersetzung mit dem antiken Mythos (Ikarus und Dädalus), die Verbindung von traditioneller und innovativer Dichtung, der Einfluss der humanistischen Geisteswelt, die Rolle der Biografie in der Interpretation von Kochanowskis Werk, sowie die Verwendung unterschiedlicher Namensformen (Jan Kochanowski und Ioannes Cochanovius).
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet den Biografismus als legitime Interpretationsmethode, wobei der "implizierte Autor" als Ansatz dient. Sie analysiert die Verarbeitung des Ikarus-Mythos in Kochanowskis Gedichten im Kontext von Ovids "Metamorphosen" und den philosophischen Debatten der Renaissance.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Ursprung der Inspiration Kochanowskis: die antike Mythenwelt des ,,Methamorphoseon libri“, Traditionelle und innovative Aspekte in Kochanowskis Dichtung und Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Methodik. Das zweite Kapitel analysiert Ovids Einfluss. Der dritte Teil untersucht die traditionellen und innovativen Elemente in Kochanowskis Werk, und das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Jan Kochanowski, Ikarus-Mythos, Autorkonzept, Renaissance-Lyrik, polnische Literatur, humanistische Geisteswelt, Mimesis, Innovatio, Biografismus, implizierter Autor, Ovid, Metamorphosen.
Welche konkreten Aspekte des Ikarus-Mythos werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Dädalus als genialer Handwerker und Ikarus als unvorsichtigen Sohn, sowie die unterschiedlichen Positionen zum Verhältnis von Vernunft (Dädalus) und Wagemut (Ikarus) im Kontext der philosophischen Debatten zwischen Platonismus und Aristotelianismus.
- Quote paper
- Sebastian Kalandyk (Author), 2008, Zwischen mimesis und innovatio - Das Selbstbild des Dichters in der Lyrik von Jan Kochanowski, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93792