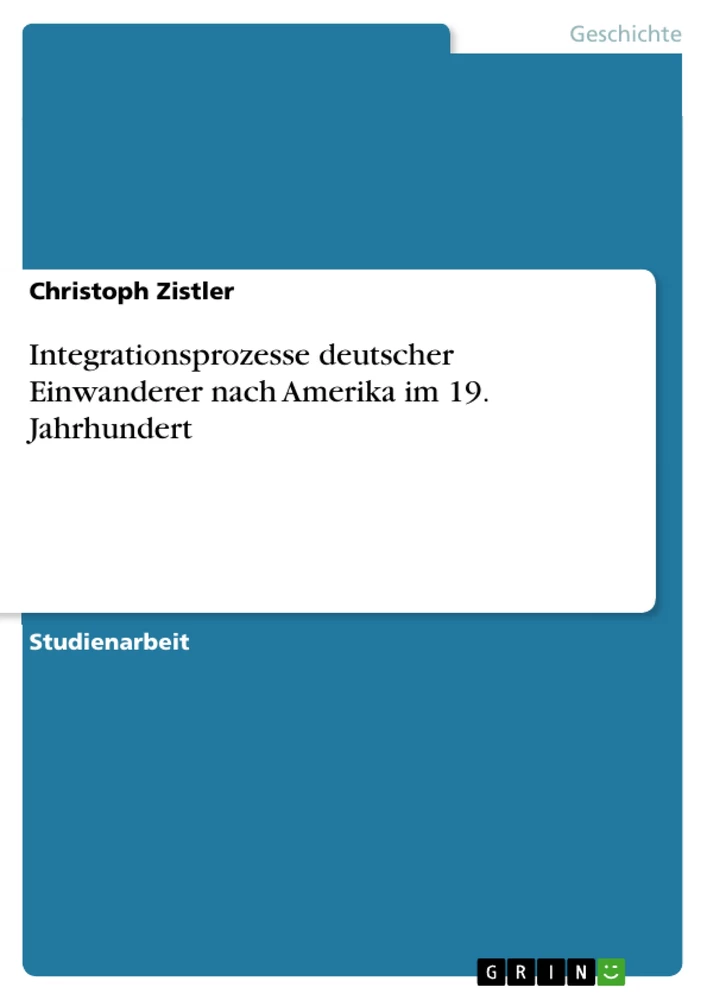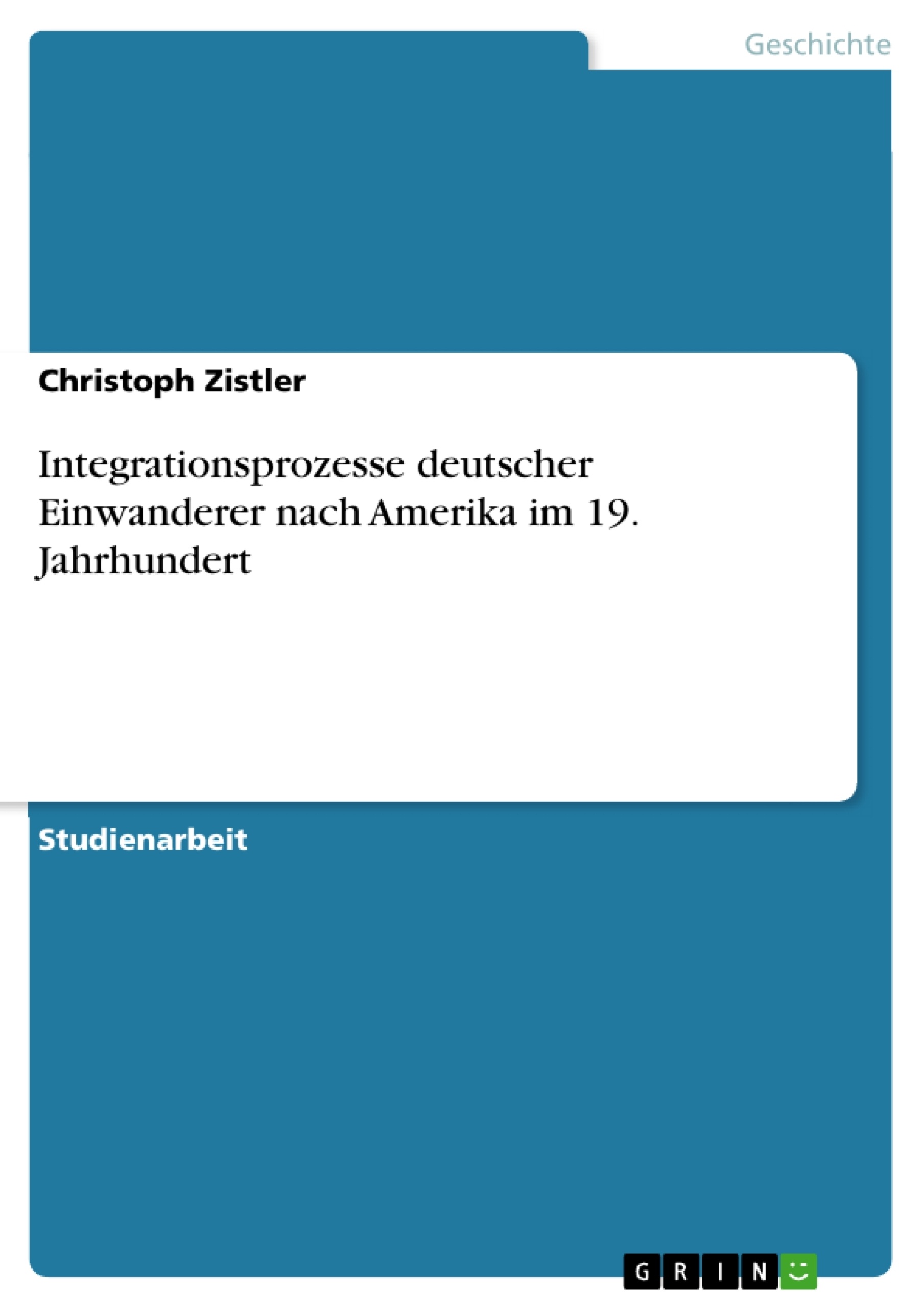Beim Betrachten der Geschichte stellt sich, wie bei vielen anderen Darstellungen von Migrationsverhältnissen, die Frage, wie der Integrationsprozess deutscher Einwanderer in Amerika vonstatten ging. Wie gelang es ihnen, sich in der neuen Welt zurechtzufinden und in die vorhandene Gesellschaft einzugliedern? Wie sahen auf der anderen Seite die Bemühungen der bereits dort ansässigen Bewohner aus, die Neuankömmlinge in ihre Gesellschaft aufzunehmen? Diese Ausarbeitung versucht nun, Antworten auf diese Fragen zu finden und darzustellen, inwiefern die lokale Gesellschaft und die Einwanderer in Amerika die wirtschaftlichen und kulturellen Schwierigkeiten zu überwinden versuchten.
Dafür sollte vorerst eine Arbeitsdefinition von Integration folgen. Unter Integration versteht diese Arbeit die Eingliederung von Neuankömmlingen in die vorhandene Gesellschaft. Dabei ist wichtig, dass sowohl die Versuche der Einwanderer, sich so gut es geht in die lokale Gesellschaft einzugliedern, als auch die Versuche der lokalen Gesellschaft, den Einwanderern den Übergang so einfach wie möglich zu gestalten, berücksichtigt werden sollten. Neben den Einwanderern tragen demnach auch die lokale Gesellschaft und deren Angebote einen erheblichen Teil zu Integrationsvorgängen der Neuankömmlinge bei. Um verschiedene Integrationsprozesse herauszuarbeiten und auf ihren Erfolg hin zu untersuchen, beschäftigt sich diese Arbeit mit Briefen, welche auf die oben angesprochenen Aspekte hin untersucht werden. Dabei sind alle Briefe in der Zeit des 19. Jahrhunderts angesiedelt und von deutschen Einwanderern geschrieben. Zuerst wird dabei die Briefserie von Johann Bauer, anschließend die von Matthias Dorgathen und zuletzt die von Christian Kirst auf Integrationsvorgänge untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenkorpus
- Johann Bauer: Ein Blick in politische Integrationsvorgänge
- Matthias Dorgathen: Opfer der systemabhängigen Integrationsfaktoren
- Christian Kirst: Ein Wirtschaftsflüchtling
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Briefe deutscher Einwanderer im 19. Jahrhundert, um den Integrationsprozess dieser Menschen in die amerikanische Gesellschaft zu untersuchen. Sie betrachtet dabei sowohl die Bemühungen der Einwanderer, sich in die neue Welt einzugliedern, als auch die Bemühungen der lokalen Gesellschaft, die Neuankömmlinge aufzunehmen.
- Die Rolle der Sprachbarriere bei der Integration
- Die wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderungen der Einwanderung
- Die Bedeutung von Briefen als historische Quelle für den Integrationsprozess
- Die Auswirkungen des Lebens in einer neuen Kultur auf die Identität der Einwanderer
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die deutsche Einwanderung als einen wichtigen Bestandteil der amerikanischen Geschichte und Gesellschaft dar. Sie stellt die Fragestellung der Arbeit, die Untersuchung des Integrationsprozesses deutscher Einwanderer, vor und definiert den Begriff „Integration“ im Kontext dieser Arbeit.
- Quellenkorpus: Dieses Kapitel beschreibt die Art der Quellen, die für die Arbeit verwendet werden, nämlich Briefe deutscher Auswanderer aus Amerika. Es wird eine allgemeine Quellenkritik der Briefe als historische Quellen durchgeführt, wobei der hohe subjektive Wahrheitsgehalt und die Bedeutung der Briefe als sozialhistorische Dokumente hervorgehoben werden.
- Johann Bauer: Ein Blick in politische Integrationsvorgänge: Dieses Kapitel analysiert die Briefe von Johann Bauer, einem deutschen Einwanderer im 19. Jahrhundert. Es untersucht die Schwierigkeiten, denen Bauer in Bezug auf seine Anpassung an die amerikanische Gesellschaft begegnet, insbesondere die Sprachbarriere und die Notwendigkeit, sich in eine neue Kultur und Gesellschaft zu integrieren.
Schlüsselwörter
Deutsche Einwanderung, Integration, amerikanische Gesellschaft, Sprachbarriere, Briefe als historische Quelle, 19. Jahrhundert, Kultur, Identität, Wirtschaft, Politik.
- Citar trabajo
- Christoph Zistler (Autor), 2020, Integrationsprozesse deutscher Einwanderer nach Amerika im 19. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937966