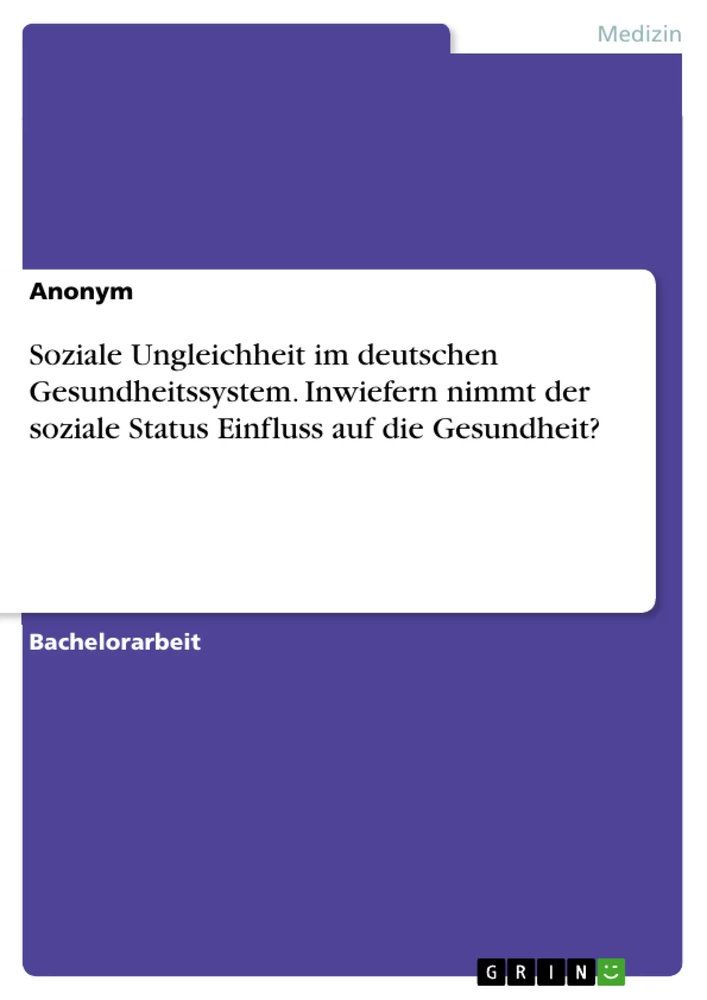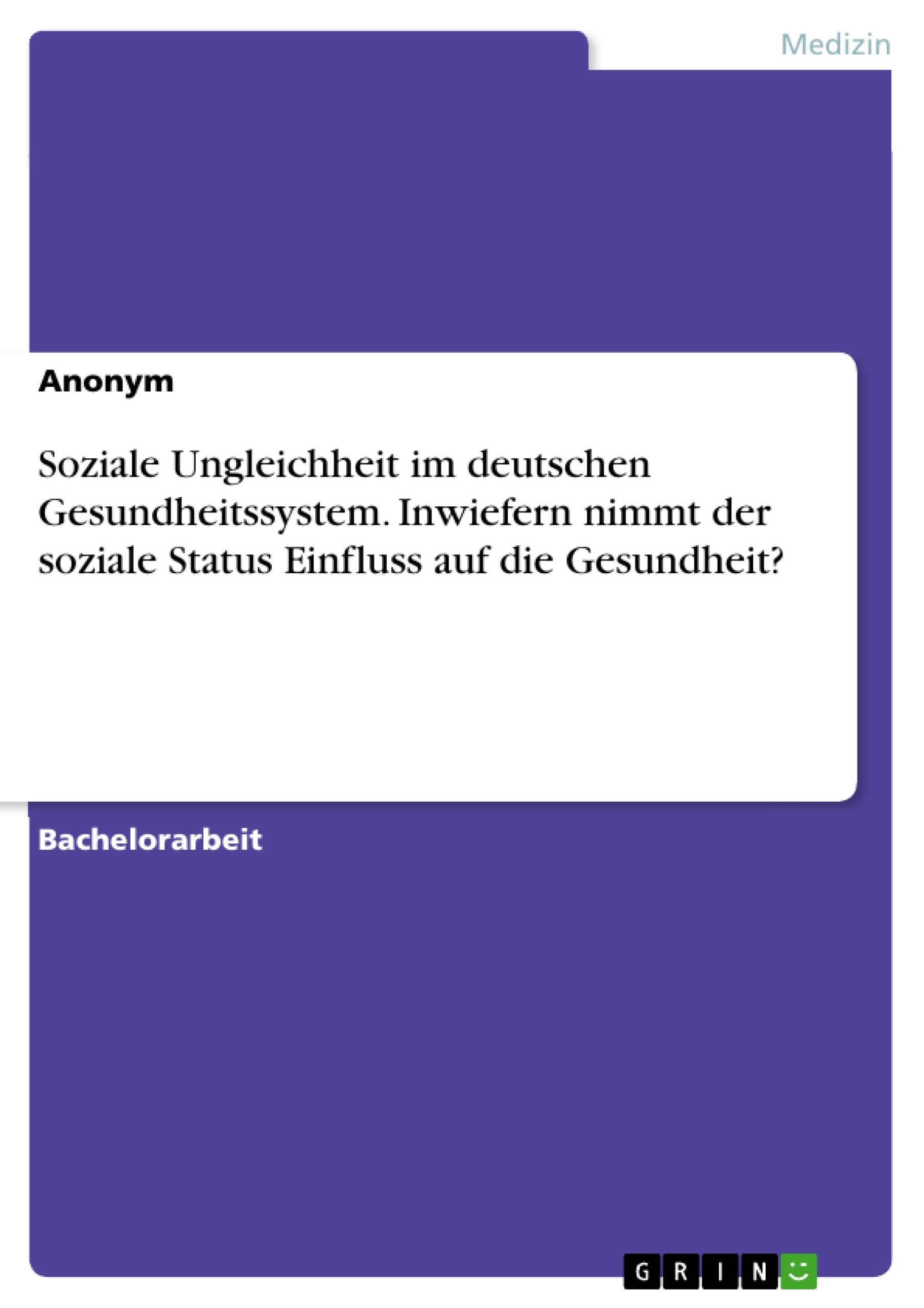Zielsetzung dieser Arbeit ist die Betrachtung der gesundheitlichen Ungleichheit im Zusammenhang zwischen dem sozialen und dem gesundheitlichen Status. Um herauszuarbeiten, inwiefern der soziale Status auf die gesundheitliche Situation eines Menschen Einfluss nimmt, ist es unausweichlich, die Ursachen der Entstehung herauszubilden und herauszustellen, welche Auswirkungen diese auf das Individuum haben.
Anhand einer systematische Literaturrecherche soll ein Vergleich zwischen dem Gesundheitszustand und dem sozialen Status angestellt werden, um Informationen und Daten aus bereits vorhandenen zuverlässigen wissenschaftlichen Quellen zu beziehen, welche an-schließend auf die Forschungsfrage angewendet werden. Absicht dieser Arbeit ist es, neben der Literaturrecherche, durch empirische Belege, schichtabhängige Handels- oder Verhaltensweisen herauszubilden. Die Ergebnisse der schichtabhängigen Verhaltensweisen sollen im Folgenden einen Ausblick auf die jeweiligen Gesundheitschancen dieser Schichten geben, um so eine gesundheitliche Ungleichheit herauszuarbeiten und vor allem die Entstehung sozialer Ungleichheit herauszubilden. Anfänglich ist eine Definition für die Thematik relevanter Termini vorgesehen, welche zur Klärung grundlegender Begrifflichkeiten dient, die zudem auf die Entstehung einer gesundheitlichen Ungleichheit hinweisen können. Hierauf folgt eine Erschließung der gesundheitlichen Ungleichheit durch den Zusammen-hang der sozialen Ungleichheit zwischen dem sozialen Status und dem Gesundheitszustand. Dazu werden verschiedene soziale Strukturen anhand sozialer Modelle untersucht. Neben den Strukturen sozialer Ungleichheit wird im Anschluss Bezug auf den gesundheitsrelevanten Lebensstil genommen, welcher sich aus mehreren Faktoren zusammensetzt und zur Klärung grundlegender Begrifflichkeiten dient. Der Vergleich der Sachverhalte auf verschiede-ne soziale Schichten, soll auf die Entstehung einer gesundheitlichen Ungleichheit hinweisen. Am Ende dieser Arbeit wird die Frage nach der Kausalität zwischen der gesundheitlichen Ungleichheit und dem Zugang der deutschen Gesundheitsversorgung gestellt. Dabei findet eine Erörterung des deutschen privaten- und gesetzlichen Versicherungssystems statt. Abschließend werden alle benannten Faktoren herangezogen, um die Frage der Kausalität be-antworten zu können. Aus Gründen des Umfangs beschränkt sich die Recherche ausschließlich auf den deutschen Sozialstaat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition Soziale Ungleichheit
- 3 Definition Gesundheit
- 4 Gesundheitlichen Ungleichheit
- 4.1 Soziale Ungleichheit und Gesundheit
- 4.2 Der Soziale Gradient
- 4.3 Soziale Determinanten der Gesundheit
- 4.3.1 Arbeitsbedingungen
- 4.3.2 Wohnbedingungen
- 4.3.3 Lebens- und Verhaltensweisen
- 4.4 Definition Sozioökonomischer Status
- 4.4.1 Einkommen
- 4.4.2 Erwerbstätigkeit/Beruflicher Status
- 4.4.3 Bildung
- 5 Sozialpolitische Absicherung der Gesundheit des Deutschen Gesundheitssystems
- 5.1 Gesetzliche Krankenversicherung
- 5.1.1 Zusatzleistungen
- 5.1.2 Zuzahlungen
- 5.2 Private Krankenversicherung
- 5.3 Soziale Ungleichheit innerhalb des Gesundheitssystems
- 5.1 Gesetzliche Krankenversicherung
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis befasst sich mit der sozialen Ungleichheit im deutschen Gesundheitssystem. Ziel der Arbeit ist es, die Zusammenhänge zwischen sozialem Status und Gesundheit zu untersuchen. Dabei wird die Definition von sozialer Ungleichheit und Gesundheit sowie die verschiedenen Determinanten der Gesundheit im Kontext sozialer Ungleichheit beleuchtet.
- Die Auswirkungen von sozialem Status auf die Gesundheit
- Die Rolle des sozialen Gradienten im Gesundheitswesen
- Soziale Determinanten der Gesundheit, wie Arbeitsbedingungen, Wohnbedingungen und Lebensweisen
- Das deutsche Gesundheitssystem und seine soziale Absicherung
- Soziale Ungleichheit innerhalb des Gesundheitssystems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema soziale Ungleichheit im Gesundheitswesen einführt und die Relevanz der Thematik unterstreicht. Im Anschluss wird die Definition von sozialer Ungleichheit sowie die Definition von Gesundheit im Kontext des deutschen Gesundheitssystems erläutert. Kapitel 4 befasst sich mit der Problematik der gesundheitlichen Ungleichheit und untersucht verschiedene Determinanten wie Arbeitsbedingungen, Wohnbedingungen und Lebens- und Verhaltensweisen. Der sozioökonomische Status wird dabei als ein wichtiger Faktor hervorgehoben. Kapitel 5 analysiert die sozialpolitische Absicherung der Gesundheit durch das deutsche Gesundheitssystem, wobei die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung im Detail betrachtet werden. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Erkenntnisse der Arbeit zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Gesundheitssystem, Gesundheit, soziale Determinanten der Gesundheit, sozioökonomischer Status, Gesetzliche Krankenversicherung, Private Krankenversicherung, Lebenserwartung, Bildungsgrad, Einkommen, Arbeitsbedingungen, Wohnbedingungen, Lebens- und Verhaltensweisen.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der soziale Status die Gesundheit?
Der soziale Status beeinflusst die Gesundheit über Faktoren wie Einkommen, Bildung und berufliche Position, was sich in unterschiedlichen Lebens- und Verhaltensweisen sowie Gesundheitschancen widerspiegelt.
Was versteht man unter dem „sozialen Gradienten“?
Der soziale Gradient beschreibt den Zusammenhang, dass mit sinkendem sozialen Status das Risiko für Krankheiten steigt und die Lebenserwartung sinkt.
Welche sozialen Determinanten sind entscheidend für die Gesundheit?
Zu den wichtigsten Determinanten zählen die Arbeitsbedingungen, die Wohnsituation sowie individuelle Lebens- und Verhaltensweisen, die oft schichtabhängig sind.
Gibt es Unterschiede in der Versorgung zwischen GKV und PKV?
Ja, die Arbeit untersucht die Kausalität zwischen dem Versicherungssystem (gesetzlich vs. privat) und dem Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie daraus resultierende Ungleichheiten.
Was umfasst der sozioökonomische Status (SES)?
Der SES setzt sich primär aus den drei Faktoren Einkommen, Bildungsgrad und beruflicher Status bzw. Erwerbstätigkeit zusammen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Soziale Ungleichheit im deutschen Gesundheitssystem. Inwiefern nimmt der soziale Status Einfluss auf die Gesundheit?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937970