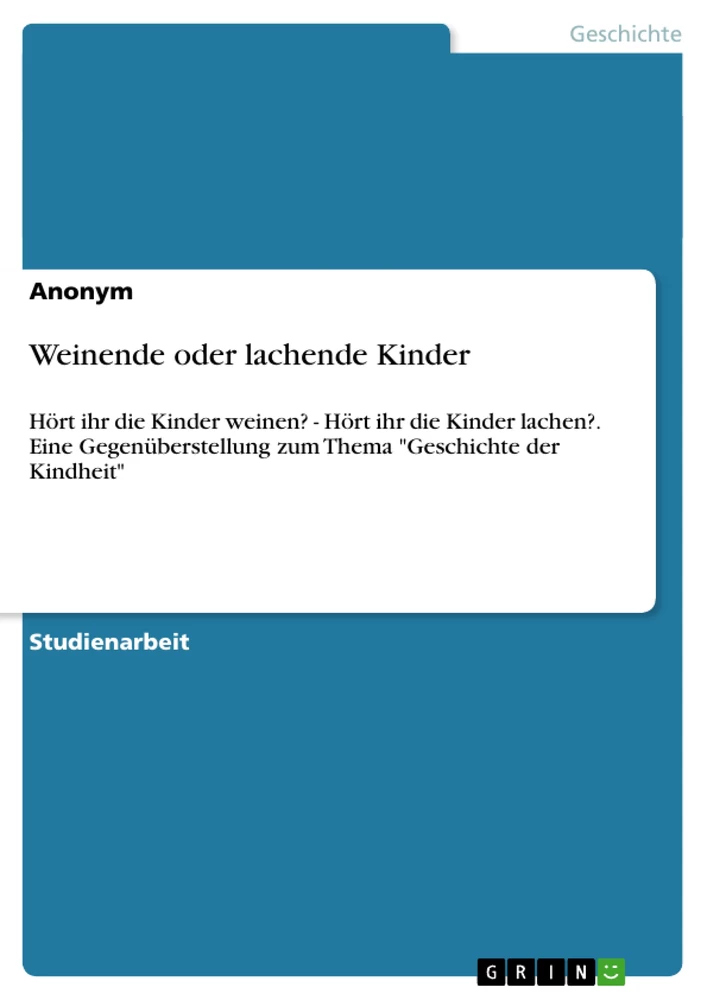„Hört ihr die Kinder weinen? – Hört ihr die Kinder lachen?“, der Titel meiner Hausarbeit und des dazu gehörten Referats thematisiert den Buchvergleich des Buches „Hört ihr die Kinder weinen – Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit“ herausgegeben von dem Historiker Lloyd deMause, in fünfjähriger Zusammenarbeit mit einigen anderen Historikern geschrieben, mit dem Buch „Hört ihr die Kinder lachen? – Zur Kindheit im Spätmittelalter“, herausgegeben von Elisabeth Loffl-Haag. Das Leben eines Kindes zur Zeit des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit wird in deMaues Buch überwiegend negativ, traurig und schwer dargestellt, während sich Loffl-Haag um ein positiveres Bild von Kindheit im Spätmittelalter bemüht. Diese verschiedenen Darstellungen möchte ich in meiner Arbeit herausstellen, vergleichen und vor allem die Wiederlegungen einiger verschwärzlichten Auffassungen des Mittelalters, welche Loffl-Haag leistet in den Vordergrund stellen.
Säuglingspflege
Um die Säuglingspflege des Spätmittelalters zu rekonstruieren, hat sich Elisabeth Loffl-Haag mehrere Hebammenbücher zur Quelle genommen, deren Existenz allein schon Anzeichen für eine intensive Beschäftigung mit der Gesundheit und Pflege der Säuglinge ist. Diese Hebammenbücher aus dem 15. und 16. Jahrhundert, wie zum Beispiel „Das Regiment der jüngeren Kinder“ von einem Arzt namens Bartholomäus Metlinger von 1473, auf welches sich Loffl-Haag besonders bezieht, waren medizinische Ratgeber für Hebammen und gaben zugleich praktische Hinweise für die Eltern selbst. Jedoch lassen sich kaum Rückschlüsse auf die Verbreitung dieser Bücher ziehen, da deren Exemplare nicht mehr erhalten sein können. Die einzigen Anhaltspunkte hierfür geben die Anzahlen der Auflagen und die Nachdrucke der Hebammenbücher. Die Existenz dieser lässt sich auf jeden Fall nicht leugnen.
In den Büchern werden Anweisungen gegeben, welche von den heutigen üblichen Vorgehensweisen bei der Pflege eines Neugeborenen teilweise kaum abweichen. Es werden präzise Anleitungen zu der Körperpflege gegeben. „Danach wurde das Kind in lauwarmen Wasser gebadet.“ „Nach dem Baden sollte das Kind wiederum eingesalbt werden, diesmal mit Rosenöl oder Myrrthenöl.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Säuglingspflege
- Kindererziehung
- Kinderspielzeug und Kinderspiele
- Rechtsstellung des Kindes
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Darstellung der Kindheit im Spätmittelalter in Lloyd deMause's „Hört ihr die Kinder weinen?“ mit Elisabeth Loffl-Haag's „Hört ihr die Kinder lachen?“. Ziel ist es, die gegensätzlichen Perspektiven herauszuarbeiten und Loffl-Haag's Widerlegung negativer Mittelalter-Stereotypen hervorzuheben.
- Gegensätzliche Darstellungen der Säuglingspflege im Spätmittelalter
- Vergleichende Analyse der Erziehungsmethoden
- Die Rolle der Arbeit und Ausbildung im Leben mittelalterlicher Kinder
- Bewertung der Quellenlage und deren Interpretation
- Widerlegung negativer Stereotype über das Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Vergleich der beiden Bücher „Hört ihr die Kinder weinen?“ von Lloyd deMause und „Hört ihr die Kinder lachen?“ von Elisabeth Loffl-Haag. deMause präsentiert ein überwiegend negatives Bild der Kindheit im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, während Loffl-Haag eine positivere Sichtweise einnimmt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Herausarbeitung dieser unterschiedlichen Perspektiven und die kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Argumentationen.
Säuglingspflege: Dieses Kapitel analysiert die Säuglingspflege im Spätmittelalter anhand von Hebammenbüchern, die Loffl-Haag als Quellen heranzieht. Im Gegensatz zu der in deMause's Werk präsentierten These von unzureichender und vernachlässigender Säuglingspflege, zeigt Loffl-Haag anhand von detaillierten Anweisungen zur Körperpflege (Baden mit lauwarmem Wasser, Einölen mit Rosen- oder Myrrthenöl) und zum Wickeln, dass ein fundiertes Wissen über die Bedürfnisse von Säuglingen bestand. Die Autorin argumentiert, dass das Wickeln nicht primär als Schutzmaßnahme vor Selbstverletzung oder Misshandlung der Kinder diente, sondern vielmehr zur Förderung einer geraden Körperhaltung und zum Schutz vor Kälte. Loffl-Haag widerlegt somit die in „Hört ihr die Kinder weinen?“ geäußerte Annahme von weit verbreiteter Unkenntnis und Vernachlässigung.
Kindererziehung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Erziehungsmethoden des Spätmittelalters. Es wird der Gegensatz zwischen deMause's Darstellung von autoritärer Erziehung, geprägt von Strafen wie Schlägen, und Loffl-Haag's differenzierteren Ansatz deutlich. Während deMause ein generelles Desinteresse an der Kindheit postuliert, argumentiert Loffl-Haag, dass die Existenz von Erziehungsliteratur ein Interesse an der kindlichen Entwicklung belegt. Die Autorin zeigt, dass es unterschiedliche Erziehungsansätze gab, von autoritärer Erziehung bis hin zu nachsichtigeren Methoden, wie sie beispielsweise von Metlinger vertreten werden. Das Kapitel veranschaulicht die Bandbreite der Erziehungspraktiken und widerlegt die einseitige Darstellung deMause's, wonach Kinder im Spätmittelalter primär als Untergebene und nicht als eigenständige Persönlichkeiten betrachtet wurden. Die Bedeutung von körperlicher und geistiger Erziehung, sowie die Rolle der Ausbildung werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Spätmittelalter, Kindheit, Säuglingspflege, Kindererziehung, Lloyd deMause, Elisabeth Loffl-Haag, Hebammenbücher, Erziehungsliteratur, Quellenkritik, Mittelalter-Stereotype.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Darstellungen der Kindheit im Spätmittelalter bei deMause und Loffl-Haag
Welche Bücher werden in diesem Text verglichen?
Der Text vergleicht die Bücher „Hört ihr die Kinder weinen?“ von Lloyd deMause und „Hört ihr die Kinder lachen?“ von Elisabeth Loffl-Haag. Beide befassen sich mit der Darstellung der Kindheit im Spätmittelalter, jedoch aus gegensätzlichen Perspektiven.
Was ist die zentrale These des Textes?
Der Text analysiert die gegensätzlichen Perspektiven von deMause und Loffl-Haag auf die Kindheit im Spätmittelalter. deMause präsentiert ein überwiegend negatives Bild, während Loffl-Haag eine positivere Sichtweise vertritt und negative Mittelalter-Stereotype widerlegt.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt verschiedene Aspekte der Kindheit im Spätmittelalter, darunter Säuglingspflege, Erziehungsmethoden, die Rolle von Arbeit und Ausbildung, sowie die Bewertung der Quellenlage und deren Interpretation. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Darstellungen dieser Themen bei deMause und Loffl-Haag.
Wie wird die Säuglingspflege im Spätmittelalter dargestellt?
Loffl-Haag widerlegt deMause's These von unzureichender Säuglingspflege anhand von Hebammenbüchern. Sie zeigt detaillierte Anweisungen zur Körperpflege und zum Wickeln, die auf fundiertem Wissen über die Bedürfnisse von Säuglingen beruhen. Im Gegensatz zu deMause argumentiert Loffl-Haag, dass das Wickeln nicht primär als Schutzmaßnahme vor Misshandlung diente, sondern der Förderung einer geraden Körperhaltung und dem Schutz vor Kälte.
Wie werden die Erziehungsmethoden im Spätmittelalter verglichen?
Der Text stellt den Gegensatz zwischen deMause's Darstellung von autoritärer Erziehung und Loffl-Haag's differenzierteren Ansatz heraus. Während deMause ein generelles Desinteresse an der Kindheit postuliert, argumentiert Loffl-Haag, dass Erziehungsliteratur ein Interesse an der kindlichen Entwicklung belegt. Es wird gezeigt, dass es unterschiedliche Erziehungsansätze gab, von autoritär bis nachsichtig.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse basiert auf den Büchern von deMause und Loffl-Haag, sowie auf Hebammenbüchern und Erziehungsliteratur des Spätmittelalters, die von Loffl-Haag als Quellen herangezogen werden. Der Text legt Wert auf Quellenkritik und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Interpretationen.
Welche Schlussfolgerung zieht der Text?
Der Text zeigt die gegensätzlichen Perspektiven auf die Kindheit im Spätmittelalter auf und hebt Loffl-Haag's Widerlegung negativer Mittelalter-Stereotype hervor. Er verdeutlicht die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der historischen Quellen und deren Interpretation.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Spätmittelalter, Kindheit, Säuglingspflege, Kindererziehung, Lloyd deMause, Elisabeth Loffl-Haag, Hebammenbücher, Erziehungsliteratur, Quellenkritik, Mittelalter-Stereotype.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2004, Weinende oder lachende Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93798