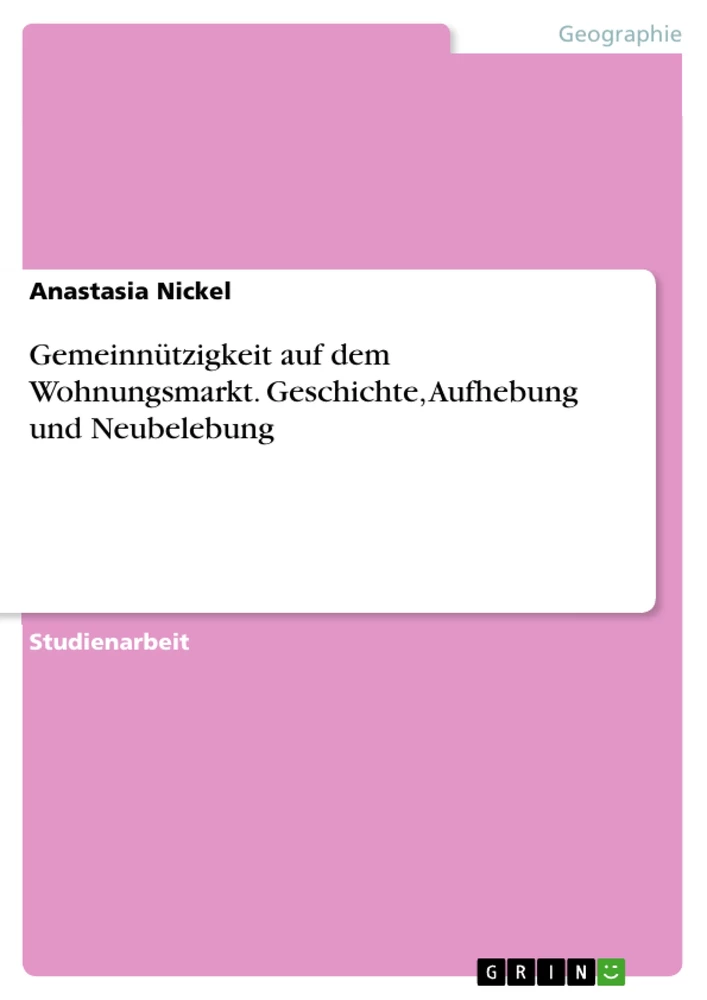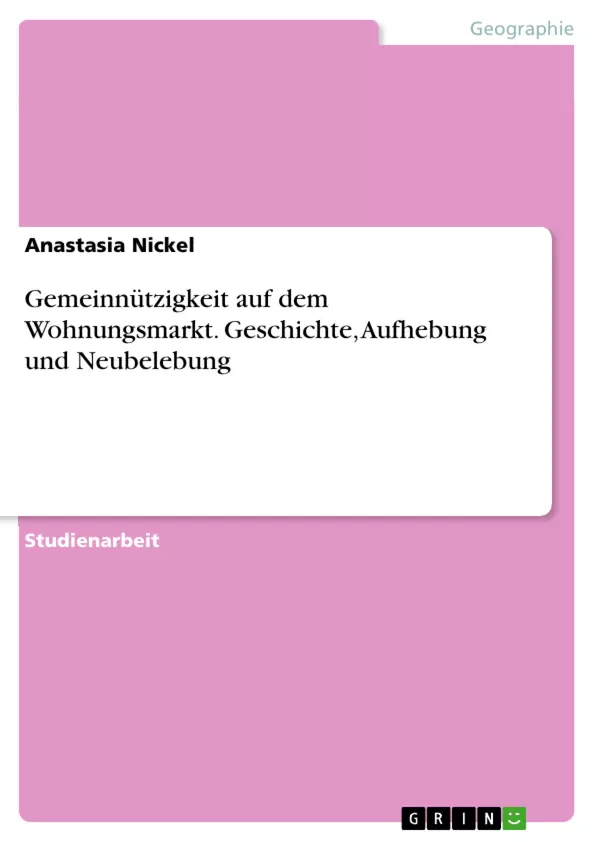Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen und stellt nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation „die Verbindung von Wohnunterkunft, Zuhause, unmittelbarem Wohnumfeld und Nachbarschaft“ dar.
Einen Einfluss auf das Sein und Bewusstsein der Bewohner hat die Stadt selber. Sie spiegelt nämlich durch ihren Grundriss und ihre Gestalt die jeweiligen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten wieder, die das Leben der in ihr wohnenden Bürger beeinflussen. Zudem kann das Wohnen selbst als ein elementares Kriterium für den gesellschaftlichen und territorialen Zusammenhalt gesehen werden.
Neben dem Wohnen als ein menschliches Grundbedürfnis, zählen auch das Wohnumfeld und die soziale Nachbarschaft.
Diese beiden Elemente haben einen erheblichen Einfluss auf das Wohnen eines jeden. Die individuellen Wohnformen können dabei als Ausdrucksformen der freien Entfaltung der Persönlichkeit gesehen werden. De facto lässt sich sagen, dass das
Wohnen eine gesellschaftliche, sozialpolitische und gesamtwirtschaftliche Bedeutung hat. Grundbegriffe, wie Integration
und Segregation können hier als bedeutende Faktoren der gesellschaftlichen Entwicklung angesehen werden. Der sozialpolitische Aspekt des Wohnens weist auf die Mindeststandards für ein menschenwürdiges Wohnen hin. Das Wohnen als Wirtschaftsgut für das man Miete aufwenden muss, stellt die gesamtwirtschaftliche Bedeutung dar. Dennoch sollte eine Wohnung nicht nur als ein Verkaufsgegenstand angesehen werden. Eine Wohnung ist zugleich, so wie bereits zuvor erläutert, auch was soziales. Tatsache ist jedoch, dass die Mieter oftmals keine große Auswahl haben und häufig gewissen sozialen und
finanziellen Zwängen unterworfen sind. Damit Mieter die Chance haben eine Wohnung zu bekommen, die ihnen gerecht wird, muss es einen erheblichen Anteil an bezahlbarem und adäquatem Wohnraum geben. Nur so kann ein Wohnungswechsel gewährleistet werden. Das Problem der aktuellen Wohnungsversorgung ist jedoch nicht unbedingt Quantität, vor allem auch begründet durch die rückläufigen Bevölkerungszahlen. Vielmehr ist es der Aspekt der Qualität, die eine Wohnung aufweisen
muss.
Inhaltsverzeichnis
- Wohnen als Grundbedürfnis der Menschen
- Gemeinnützigkeit - Eine Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit
- Zur Geschichte der Wohnungsgemeinnützigkeit: Gründung, Abschaffung und ihre Folgen
- Die Anfänge der Wohnungsgemeinnützigkeit
- Neue Heimat - Gegenmacht um kapitalistisches Unternehmertum
- Die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit und ihre Folgen
- Aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt
- Eine 2. Chance für die Wohnungsgemeinnützigkeit?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Wohnungsgemeinnützigkeit und beleuchtet dessen Geschichte, Abschaffung und die aktuelle Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Wohnungsgemeinnützigkeit als ein wichtiger Faktor zur Bewältigung der Wohnungsnot im 19. Jahrhundert und analysiert die Folgen ihrer Abschaffung. Darüber hinaus analysiert sie die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt und die potenziellen Chancen für eine Wiederbelebung der Wohnungsgemeinnützigkeit.
- Das Wohnen als Grundbedürfnis des Menschen und seine gesellschaftliche Bedeutung
- Die Rolle der Gemeinnützigkeit im Kontext von sozialer Verantwortung und öffentlicher Daseinsvorsorge
- Die Geschichte der Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland
- Die Folgen der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit für den Wohnungsmarkt
- Die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt und die Relevanz von bezahlbarem Wohnraum
Zusammenfassung der Kapitel
1. Wohnen als Grundbedürfnis der Menschen
Dieses Kapitel erläutert Wohnen als ein grundlegendes menschliches Bedürfnis und betont seine gesellschaftliche Bedeutung. Es beleuchtet die Verbindung von Wohnunterkunft, Zuhause, Wohnumfeld und Nachbarschaft und stellt die Stadt als Spiegelbild politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Gegebenheiten dar. Der Text betont den Einfluss dieser Gegebenheiten auf das Leben der Bewohner und die Rolle des Wohnens als ein Kriterium für gesellschaftlichen und territorialen Zusammenhalt.
2. Gemeinnützigkeit - Eine Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit
Dieses Kapitel definiert Gemeinnützigkeit als einen steuerrechtlichen Begriff, der eine Handlung beschreibt, die der Allgemeinheit nützlich ist. Es stellt die Gemeinnützigkeit dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip gegenüber, bei dem die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht. Der Text erläutert die Steuerbefreiung gemeinnütziger Organisationen und erläutert die Kriterien, die für die Anerkennung als gemeinnützig relevant sind.
3. Zur Geschichte der Wohnungsgemeinnützigkeit: Gründung, Abschaffung und ihre Folgen
3.1 Die Anfänge der Wohnungsgemeinnützigkeit
Dieses Unterkapitel beleuchtet die Entstehung der Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland. Es schildert die Gründung der "Berliner Gemeinnützige Baugesellschaft" im Jahre 1847 und beschreibt die Motivation hinter der Gründung: die Linderung der Wohnungsnot, die durch die Industrialisierung und Verstädterung entstanden war. Der Text hebt die Rolle der Wohnungsgemeinnützigkeit als Gegenmacht zum kapitalistischen Unternehmertum hervor und stellt die Ziele der Gesellschaften dar: staatliche Entlastung in der Wohnungsvorsorge und soziale Besänftigung.
3.2 Neue Heimat - Gegenmacht um kapitalistisches Unternehmertum
Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Rolle der "Neuen Heimat" als Gegenmacht zum kapitalistischen Unternehmertum. Der Text beschreibt die Abschaffung des privaten Grundeigentums und die Übergabe von Erbpacht und kommunalem Bauland an gemeinnützige Siedlungsgesellschaften. Dieser Schritt zielte darauf ab, Bodenspekulation zu verhindern und die Wohnungsnachfrage zu decken.
3.3 Die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit und ihre Folgen
Dieses Unterkapitel analysiert die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit und deren Folgen für den Wohnungsmarkt. Es beleuchtet die Entstehung der Wohnungsnot und die Bedeutung bezahlbaren Wohnraums.
4. Aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt
Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt und analysiert die Herausforderungen der Wohnungversorgung. Es betont die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum und diskutiert die Potenziale und Probleme des Wohnungsmarkts.
4.1 Eine 2. Chance für die Wohnungsgemeinnützigkeit?
Dieses Unterkapitel untersucht die Möglichkeit einer Wiederbelebung der Wohnungsgemeinnützigkeit im aktuellen Kontext. Es beleuchtet die Rolle der Gemeinnützigkeit in der heutigen Gesellschaft und die Bedeutung sozialer Verantwortung im Bereich der Wohnungswirtschaft.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die Themen Wohnungsgemeinnützigkeit, soziale Verantwortung, bezahlbarer Wohnraum, Wohnungsnot, Industrialisierung, Verstädterung, Bodenspekulation, Steuern, Steuerrecht, Gemeinwirtschaft, kapitalistisches Unternehmertum, und aktuelle Herausforderungen des Wohnungsmarkts in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Gemeinnützigkeit auf dem Wohnungsmarkt?
Es beschreibt eine Tätigkeit von Baugesellschaften, die nicht auf Gewinnmaximierung, sondern auf die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für die Allgemeinheit ausgerichtet ist.
Wann entstand die Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland?
Die Anfänge liegen in der Mitte des 19. Jahrhunderts (z. B. Gründung der Berliner Gemeinnützigen Baugesellschaft 1847) als Reaktion auf die Wohnungsnot der Industrialisierung.
Was war die „Neue Heimat“?
Ein bedeutendes gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, das als Gegenmacht zum kapitalistischen Unternehmertum fungierte, bis es in die Krise geriet.
Warum wurde die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft?
Die Arbeit analysiert die politischen und wirtschaftlichen Gründe für die Aufhebung der Gemeinnützigkeit Ende der 1980er Jahre und deren Folgen für die Mietpreise.
Gibt es eine Chance für eine Neubelebung der Gemeinnützigkeit?
Angesichts der aktuellen Wohnungsnot und steigender Mieten diskutiert die Arbeit Potenziale für eine Rückkehr zu gemeinnützigen Modellen in der Wohnungswirtschaft.
- Arbeit zitieren
- Anastasia Nickel (Autor:in), 2014, Gemeinnützigkeit auf dem Wohnungsmarkt. Geschichte, Aufhebung und Neubelebung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/938428