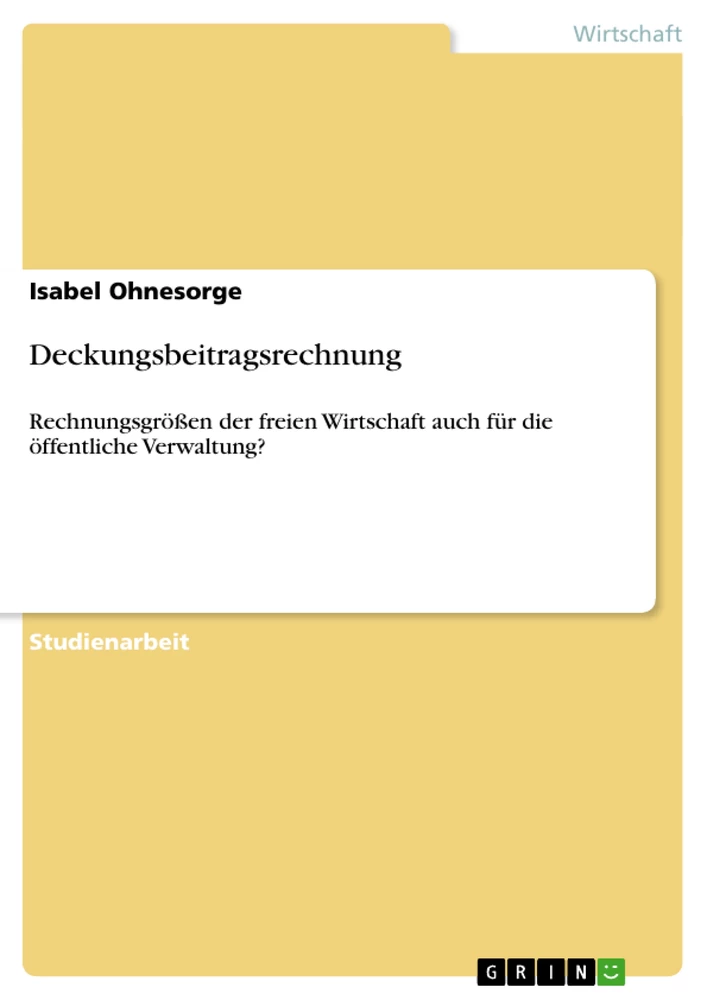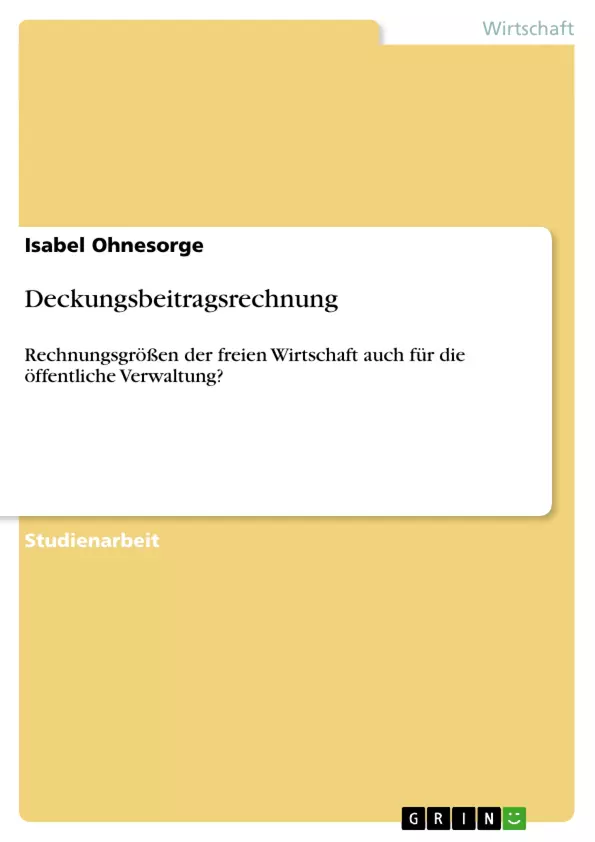1 Kostenrechnung in der Verwaltung
1.1 Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit existiert überall…
Entscheidungen über Fremdvergabe oder Eigenleistung, Leistungsausweitung und Wirtschaftlichkeit von Kostenträgern sind in der öffentlichen Verwaltung ebenso zu treffen wie in der freien Wirtschaft. In Verbindung mit der VK-Rechnung gibt die erhöhte Kostentransparenz der DB-Rechnung aussagekräftige Informationen über die richtige Gebührenkalkulation oder eine notwendige Verfahrensänderung. In der Privatwirtschaft sind zwei große Entwicklungslinien auf dem Gebiet des internen Rechnungswesens zu erkennen: Einerseits entfernt sich der Weg von der konventionellen VK- oder Nettorergebnisrechnung hin zur modernen EK- und DB-Rechnung. Dabei wird auf – stets willkürliche – Gemeinkostenschlüsselungen verzichtet. Andererseits geht der Weg von der reinen Istkostenrechnung hin zur modernen Form der Grenzplankostenrechnung.
1.2 Gewinnschwellen und Betriebsergebnisse – Rechnungsgrößen der freien Wirtschaft auch für die Verwaltung?
„Pecunia nervus rerum est – Geld ist letztlich der Kern aller Dinge“
Diese Tatsache stellt Wewer für die öffentlichen Verwaltungen fest. Dabei geht es aber um Geld im Sinne von Kosten, welche der öffentlichen Hand für die Bereitstellung von Dienstleistungen entstehen. In den seltensten Fällen werden dabei Gewinne erzielt. Das BVerwG hat 1961 entschieden, dass der Nutzen der Monopolleistung (der Verwaltung) den Gebühren bzw. Verrechnungswerten vergleichbar sein soll. Der Rechnungszweck des öffentlichen Sektors ist zwar nicht identisch mit dem der Privatwirtschaft; Männel hat jedoch bereits 1990 vertreten, dass die konzeptionellen Entwicklungen der internen Rechnungslegung auch auf die öffentliche Verwaltung übertragen werden sollten. In den konzeptionellen Kern eines entscheidungsorientierten Rechnungswesens ist immer ein Rechnen mit EK zu stellen. Abzulehnen sind GK-Schlüsselungen analog einer VK-Kalkulation. Es genügt nicht, die Kosten nach Kostenarten, -stellen und -trägern zu strukturieren. Auch im Zuge der Kostenspaltung muss die Abhängigkeit der Kosten von der Kostenstellenleistung ermittelt werden. Das gilt sowohl für Stellen, welche Leistungen lediglich verwaltungs- bzw. unternehmensintern abgeben , als auch für Dienstleistungsbereiche. (…) In der Annahme, die gesamten Kosten der alternativen Eigenfertigung würden bei Leistungsbezug von außen entfallen, wird die Leistung von außen eingekauft.
Inhaltsverzeichnis
- Kostenrechnung in der Verwaltung
- Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit existiert überall….
- Gewinnschwellen und Betriebsergebnisse – Rechnungsgrößen der freien Wirtschaft auch für die Verwaltung?
- Die Deckungsbeitragsrechnung - vorher Entscheiden, hinterher Controllen
- Entscheidungen
- Programmoptimierung und -entscheidung
- Kein Engpass - Unterbeschäftigung
- Ein Engpass
- Mehrere Engpässe
- Preisuntergrenzen - Annehmen von Zusatzaufträgen
- Kurzfristige Untergrenze – bei freien Kapazitäten
- Kurzfristige Untergrenze – bei einem gemeinsamen Engpass_
- Verfahrenswahl
- Kurzfristige Wahl – bei freien Kapazitäten
- Kurzfristige Wahl – bei einem Engpass_
- Preisobergrenzen - Make or buy
- Gewinnschwellenanalyse – Break-even-Point_
- Controlling
- Kostenstrukturmanagement – ein Hauptauftrag der öffentlichen Hand
- Rechnungsgrößen
- Leistungs- und Erlösrechnung.
- Ergebnisrechnung_
- Fixkostenorientiertes Deckungsbeitragsmanagement
- Deckungsbeiträge für die öffentliche Verwaltung – sinnvoll oder nicht
- Anwendung der Deckungsbeitragsrechnung in der öffentlichen Verwaltung
- Übertragbarkeit von Wirtschaftlichkeitskonzepten aus der freien Wirtschaft
- Steuerung und Entscheidungsfindung in der Verwaltung
- Analyse von Engpässen und Kapazitätsauslastung
- Kostenstrukturmanagement in der öffentlichen Verwaltung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht die Anwendbarkeit der Deckungsbeitragsrechnung in der öffentlichen Verwaltung. Dabei wird besonders auf die Frage eingegangen, ob kontrollierte Rechnungsgrößen der freien Wirtschaft auch in der Verwaltung sinnvoll eingesetzt werden können. Die Deckungsbeitragsrechnung wird als Instrument zur Entscheidungsfindung und Steuerung im Kontext der öffentlichen Verwaltung analysiert.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 befasst sich mit der grundlegenden Frage, ob das Prinzip der Wirtschaftlichkeit auch in der öffentlichen Verwaltung Anwendung finden kann. Es wird dargestellt, dass auch in der Verwaltung, trotz des fehlenden Gewinnstrebens, das Prinzip der Wirtschaftlichkeit relevant ist, da Ressourcen effizient eingesetzt werden müssen. Kapitel 2 beleuchtet die Deckungsbeitragsrechnung als Instrument für Entscheidungen und Kontrollen. Es werden verschiedene Anwendungsbeispiele und Entscheidungsmodelle im Kontext der Deckungsbeitragsrechnung vorgestellt. Kapitel 3 thematisiert die Möglichkeiten und Grenzen der Deckungsbeitragsrechnung für die öffentliche Verwaltung. Kapitel 4 bietet einen zusammenfassenden Ausblick auf die zentralen Erkenntnisse des Referats.
Schlüsselwörter
Deckungsbeitragsrechnung, öffentliche Verwaltung, Wirtschaftlichkeit, Entscheidungsfindung, Kostenstrukturmanagement, Engpässe, Kapazitätsauslastung, Controlling, Rechnungsgrößen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Deckungsbeitragsrechnung (DB-Rechnung) für die Verwaltung relevant?
Sie bietet Kostentransparenz für Entscheidungen über Eigenleistung oder Fremdvergabe und hilft bei der effizienten Gebührenkalkulation.
Was unterscheidet die DB-Rechnung von der Vollkostenrechnung?
Die DB-Rechnung verzichtet auf willkürliche Gemeinkostenschlüsselungen und konzentriert sich auf die variablen Kosten, die direkt durch eine Leistung entstehen.
Was ist der "Break-even-Point" in der Verwaltung?
Es ist die Gewinnschwelle, an der die Erlöse die Kosten decken – ein Konzept, das auch zur Wirtschaftlichkeitsprüfung öffentlicher Dienstleistungen genutzt werden kann.
Welche Rolle spielen Engpässe bei der Programmoptimierung?
Die Arbeit analysiert, wie bei Unterbeschäftigung oder vorhandenen Engpässen Entscheidungen über die Priorisierung von Leistungen getroffen werden sollten.
Was bedeutet „Make or buy“ im öffentlichen Sektor?
Es ist die Entscheidung, ob eine Verwaltungsleistung intern erbracht oder von einem externen Anbieter eingekauft werden soll, basierend auf Preisobergrenzen.
Ist Gewinnmaximierung das Ziel der öffentlichen Kostenrechnung?
Nein, der Zweck ist nicht primär Gewinn, sondern die Sicherstellung des Wirtschaftlichkeitsprinzips bei der Bereitstellung öffentlicher Güter.
- Arbeit zitieren
- Isabel Ohnesorge (Autor:in), 2007, Deckungsbeitragsrechnung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93845