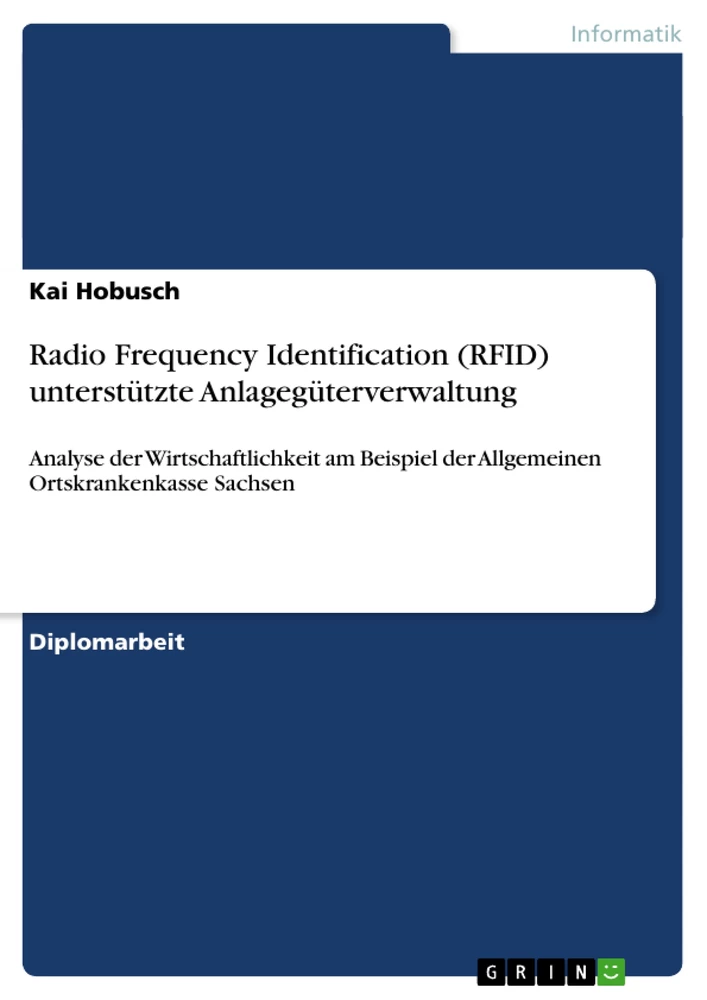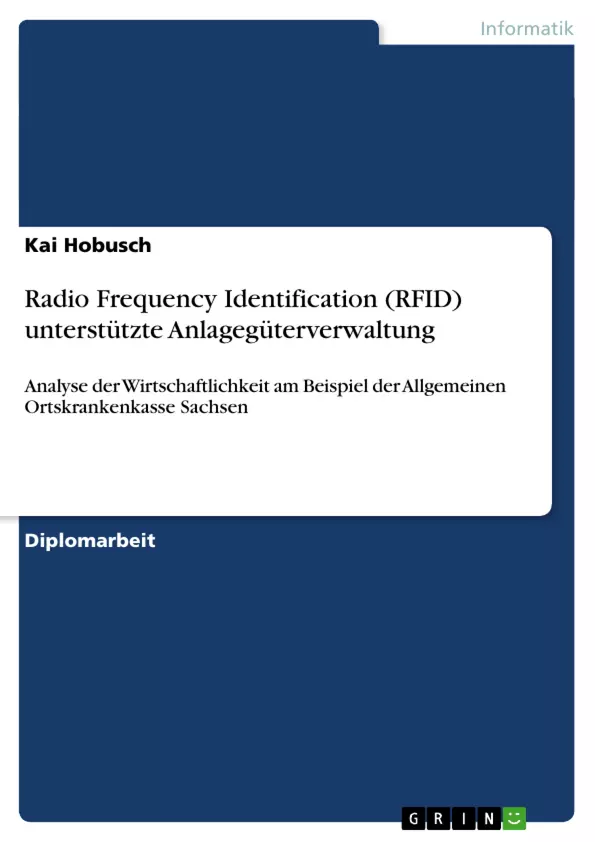Ob elektronischer Reisepass (ePass), die intelligente Kühltruhe im real Future Store oder der Einsatz im Supply Chain Management: die RFID-Technologie ist auf den Weg vom Hype zu realen Anwendungen. Radio Frequency Identification (RFID) bezeichnet allgemein die Identifizierung von Objekten mittels Funkwellen. RFID Systeme erreichen derzeit den Massenmarkt, weil diese sich immer schneller zu einer kosteneffizienten Technologie wandeln.
Dies ist, auf dem amerikanischen Markt, zum großen Teil den Bestrebungen von Wal-Mart und dem amerikanischen Verteidigungsministerium zu verdanken, die zunehmend RFID-Technologie in ihre Versorgungsketten integrieren. 2003 verpflichtete Wal-Mart seine Hauptlieferanten, Paletten und Kisten mit Electronic Product Code Labels zu versehen und dadurch die Lagerbestandsverfolgung auf Palettenlevel zu ermöglichen. Dem folgte das US-amerikanische Verteidigungsministerium mit derselben Verpflichtung seiner Top 100 Lieferanten. In Deutschland folgte die METRO - Gruppe diesem Vorgehen mit der Verpflichtung von Lieferanten zum Einsatz der RFID-Technologie zum 1. Januar 2005.
Die Integration von RFID-Technologie in die Lieferantenkette wird motiviert durch die dadurch zunehmende Versandeffizienz und die abnehmenden Kosten für Verwaltung, Lagerung und durch Produktverluste. Die aktuelle Diskussion dreht sich überwiegend um die Konsequenzen des RFID-Einsatz für den Datenschutz und das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen wird dagegen allgemein unterstellt.
So wird in verschiedenen Anwendungsfällen die RFID-Technologie als vorteilhaft gegenüber der etablierten Barcode-Technologie angeführt. Dabei verspricht RFID im Asset Management oder Asset Tracking, also dem Verwalten und Verfolgen von Anlagevermögen, einen schnellen Return on Investment (ROI). Die Möglichkeit, Verwaltungsdaten des Objektes physisch mit dem Objekt zu verbinden, wird als entscheidender Vorteil beschrieben Unklar ist allerdings, ob trotz der in den Fallstudien beschriebenen Vorteile die RFID-Technologie die Barcode-Technologie wirtschaftlich sinnvoll ersetzen kann.
Der Autor untersucht dies am Beispiel der Anlagengüterverwaltung der AOK Sachsen. Konkret wird überprüft, ob und in welchem Umfang der Einsatz der RFID-Technologie als Ersatztechnologie für Barcodes im Rahmen der Anlagegüterverwaltung einen Beitrag zur Senkung der Verwaltungskosten der AOK Sachsen leisten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage
- Zielsetzung und Vorgehensweise
- Anlagegüterverwaltung in der AOK Sachsen
- Unternehmensdarstellung und rechtliche Rahmenbedingungen
- Eingesetzte Methoden der Ist-Situations-Analyse
- Prozessbeschreibung der Anlagegüterverwaltung
- Aufbauorganisatorische Umsetzung und Personalbedarf
- IT-Unterstützung bei der Prozessausführung
- Darstellung des Anlagenbestandes und der Bestandsbewegungen
- Zusammenfassende Bewertung und Darstellung der erkannten Defizite
- Formulierung der Ziele und Identifizierung möglicher Zielkonflikte
- RFID-technische Grundlagen
- Automatische Identifikationsverfahren (Auto-ID)
- Übersicht verschiedener Auto-ID-Technologien
- Barcode
- Radio Frequency Identification - RFID
- Komponenten eines RFID-Systems
- Gegenüberstellung Barcode-ID-System und RFID
- Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- Erörterung des Investitionsbegriff
- Kapitalwertmethode als quantitativ dynamisches Bewertungsverfahren
- Probleme bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einzelner Faktoren
- RFID-unterstützte Anlagegüterverwaltung
- Nutzenpotenziale im Prozess
- Ablauf- und aufbauorganisatorische Maßnahmen
- Funktionelle Anforderungen an RFID-Systeme aus Sicht der Anlagenwirtschaft
- Auswahl der geeigneten RFID-Technologie
- Technische Lösungsarchitektur einer RFID-unterstützten Anlagenbuchhaltung
- Architekturentwicklung mittels Komponentendiagramm
- Infrastrukturelle Maßnahmen
- Bestimmung der notwendigen technischen Maßnahmen für die Anlagengüter-Inventarisierung
- Bestimmung der notwendigen technischen Maßnahmen für die Anlagengüter-Verfolgung
- Bewertung der Eignung zur Erreichung der Ziele (Wirkungsanalyse)
- Quantitative Wirtschaftlichkeitsanalyse mittels Kapitalwert
- Erörterung der Vorgehensweise
- Bestimmung der Investitionsausgaben
- Bestimmung der Rückflüsse
- Ermittlung des Liquidationserlös
- Festsetzung des Kalkulationszinssatzes
- Berechnung des Kapitalwertes
- Ergebnisbewertung
- Einfluss des Kalkulationszinssatzes
- Sensitivitätsanalyse ausgewählter Eingangsgrößen
- Kritische Werte-Rechnung für ausgewählte Eingangsgrößen
- Handlungsempfehlung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Analyse der Wirtschaftlichkeit einer RFID-gestützten Anlagegüterverwaltung am Beispiel der Allgemeinen Ortskrankenkasse Sachsen. Die Arbeit untersucht die aktuellen Prozesse der Anlagegüterverwaltung, analysiert die Herausforderungen und Defizite des bestehenden Systems und evaluiert die Einsatzmöglichkeiten und den wirtschaftlichen Nutzen von RFID-Technologie in diesem Kontext.
- Optimierung der Anlagegüterverwaltung in der AOK Sachsen
- Analyse der Wirtschaftlichkeit von RFID-Systemen
- Entwicklung einer technischen Lösungsarchitektur für die RFID-gestützte Anlagegüterverwaltung
- Bewertung der Eignung von RFID zur Erreichung der gesteckten Ziele
- Erstellung einer Handlungsempfehlung für die Einführung von RFID in der AOK Sachsen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Anlagegüterverwaltung im Kontext der AOK Sachsen ein. Es werden die Ausgangslage, die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Arbeit erläutert. Kapitel 2 geht detailliert auf die bestehenden Prozesse der Anlagegüterverwaltung in der AOK Sachsen ein. Es werden die Unternehmensdarstellung, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die eingesetzten Methoden der Ist-Situations-Analyse, die Prozessbeschreibung, die Aufbauorganisation und die IT-Unterstützung beleuchtet. Des Weiteren werden der Anlagenbestand, die Bestandsbewegungen und die erkannten Defizite dargestellt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den RFID-technischen Grundlagen. Es werden verschiedene Auto-ID-Technologien vorgestellt, wobei der Fokus auf RFID liegt. Die Komponenten eines RFID-Systems werden erläutert und ein Vergleich zwischen Barcode-ID-Systemen und RFID durchgeführt. Kapitel 4 behandelt die betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Es werden der Investitionsbegriff, die Kapitalwertmethode und die Probleme bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einzelner Faktoren erläutert.
Kapitel 5 befasst sich mit der RFID-unterstützten Anlagegüterverwaltung. Es werden die Nutzenpotenziale im Prozess, die Ablauf- und Aufbauorganisation, die funktionalen Anforderungen an RFID-Systeme, die Auswahl der geeigneten RFID-Technologie und die technische Lösungsarchitektur einer RFID-gestützten Anlagenbuchhaltung vorgestellt.
Kapitel 6 widmet sich der quantitativen Wirtschaftlichkeitsanalyse mittels Kapitalwert. Die Vorgehensweise, die Bestimmung der Investitionsausgaben und Rückflüsse, die Ermittlung des Liquidationserlöses und die Festsetzung des Kalkulationszinssatzes werden erläutert. Anschließend wird der Kapitalwert berechnet und das Ergebnis bewertet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Einsatz von Radio Frequency Identification (RFID) zur Optimierung der Anlagegüterverwaltung in der Allgemeinen Ortskrankenkasse Sachsen. Schwerpunkte der Arbeit sind die Analyse der Wirtschaftlichkeit von RFID-Systemen, die Entwicklung einer technischen Lösungsarchitektur und die Bewertung der Eignung zur Erreichung der gesteckten Ziele. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erörterung von Nutzenpotenzialen, die Anwendung der Kapitalwertmethode sowie die Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen der AOK Sachsen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist RFID-Technologie?
Radio Frequency Identification (RFID) bezeichnet die automatische Identifizierung von Objekten mittels Funkwellen, ohne direkten Sichtkontakt.
Welchen Vorteil bietet RFID gegenüber dem Barcode im Asset Management?
RFID ermöglicht die gleichzeitige Erfassung mehrerer Objekte (Pulklesung) und das physische Speichern von Verwaltungsdaten direkt am Objekt.
Wie wirtschaftlich ist der Einsatz von RFID bei der AOK Sachsen?
Die Arbeit untersucht dies mittels der Kapitalwertmethode und analysiert, ob die Einsparungen bei den Verwaltungskosten die Investitionskosten übersteigen.
Welche technischen Komponenten werden für ein RFID-System benötigt?
Ein System besteht aus Transpondern (Tags), Lesegeräten (Readern) und einer Middleware zur Anbindung an die IT-Infrastruktur.
Welche Rolle spielt der Datenschutz beim RFID-Einsatz?
Die Arbeit thematisiert die aktuelle Diskussion um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Konsequenzen für den Datenschutz.
- Citation du texte
- Kai Hobusch (Auteur), 2008, Radio Frequency Identification (RFID) unterstützte Anlagegüterverwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93863