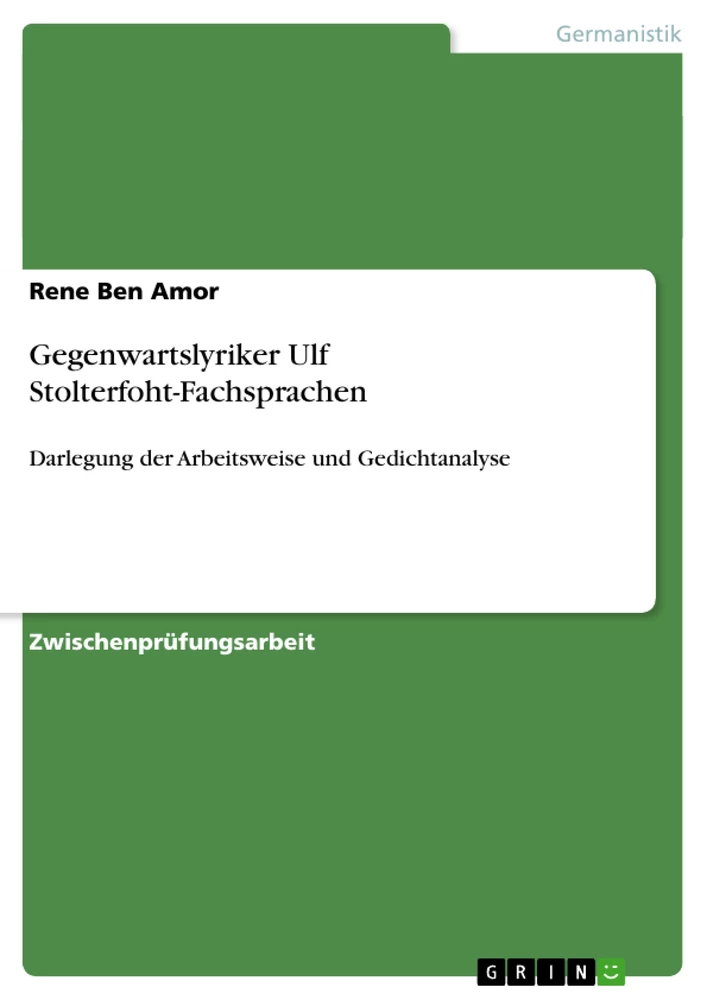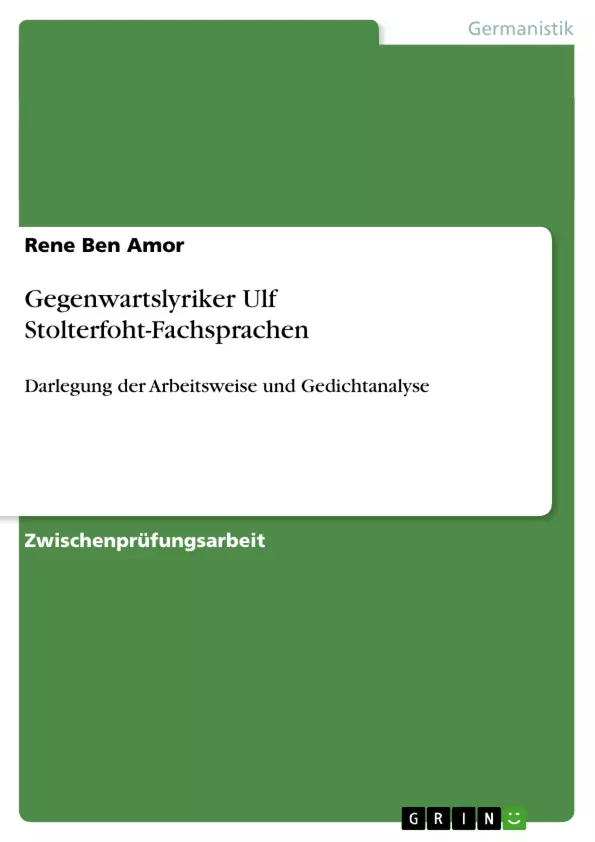Im Zuge des Seminars „das Gedicht gibt es nicht.“ – Lyrik des 21. Jahrhun-derts“ wurde Gegenwartslyrik thematisiert und analysiert. Einer der Autoren dieser Thematik war der Lyriker Ulf Stolterfoht. Diese Arbeit wird versuchen sich wissenschaftlich mit der Arbeitsweise des Autoren1 und ihren möglichen Ursprüngen auseinanderzusetzen und verdeutlichen in welchen Feldern der Lyrik sich Stolterfohts Gedichte bewegen. Der Forschungsstand hierzu ist schlecht. Es finden sich keine wissenschaftlichen Arbeiten die verwendet werden könnten, einzig das „world wide web“ bietet eine Auswahl von Zeitungsartikeln und abgetippten Gesprächen mit Stolterfoht. In anbetracht des Mediums, sind diese Artikel mit Vorbehalten zu verwenden, auch wenn die ihnen zugrunde liegende Internetseite die Publikation eines Verlagshauses ist. Ulf Stolterfoht ist ein Lyriker über den, bis auf ein paar Eckdaten, nicht viel Persönliches zu erfahren ist. Er zählt zu den Autoren der Gegenwartslyrik, die einem das Lesen und verstehen ihrer Werke nicht gerade dadurch erleichtern, dass sie Worte im traditionellen Sinne nutzen, was allerdings die einhergehende Meinung, das Lyrik eine anspruchsvolle Gattung ist nur unterstreicht. Interessant ist, dass der Lyriker Stolterfoht seine Gedichtbände Fachsprachen genannt hat. Dies zeugt von dem Witz und der Ironie des Autoren, da er in seinen Gedichten Worte frei von Sinn verwendet und sie in der reduzierten Struktur des Satzes aufgehen lässt. Man bedenke dabei, dass Begriffe innerhalb einer Fachsprache mit Bedeutung geradezu beladen sind. Ein Wort kann teilweise gleich in mehreren Fachsprachen vorkommen und dabei verschiedene Bedeutungen. Um so makaberer ist es da, dass die Titel der Bände den Begriff Fachsprachen trägt. Eine ähnliche Abweichung von Lyrik im traditionellen Sinne findet sich in den lesefeindlichen Texten Michaels Lenz´ die sich dem Leser entziehen und vielmehr ein akustisches Erlebnis in sich bergen, bzw. in den Werken von Thomas Kling.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gedichtanalyse
- Definition Fachsprache
- Stolterfohts Arbeitsweise
- Dekonstruktivismus
- Reflexionslyrik
- Reduktion der sprachlichen Mittel
- Abwendung von der Bedeutung der Worte
- Verbindungen zu Pastior
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Arbeitsweise des Gegenwartslyrikers Ulf Stolterfoht und analysiert seine Gedichte, insbesondere im Hinblick auf seinen Umgang mit Sprache und Bedeutung. Der Fokus liegt auf der Dekonstruktion von Sprache und der Reduktion sprachlicher Mittel in Stolterfohts Werk. Die geringe Anzahl an wissenschaftlichen Arbeiten über Stolterfoht stellt eine Herausforderung dar. Die Analyse stützt sich daher teilweise auf Zeitungsartikel und online verfügbare Interviews.
- Analyse der Arbeitsweise Ulf Stolterfohts
- Untersuchung der sprachlichen Mittel und ihrer Reduktion in Stolterfohts Gedichten
- Bedeutung der Dekonstruktion in Stolterfohts Lyrik
- Vergleich mit anderen Lyrikern (z.B. Celan, Lenz, Kling)
- Analyse des Gedichts (8) aus dem Band "Fachsprachen X-XVIII"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Forschungsstand zur Lyrik Ulf Stolterfohts als gering. Sie hebt Stolterfohts eigenwilligen Umgang mit Sprache hervor, der sich durch die Verwendung von Wörtern abseits ihrer traditionellen Bedeutung auszeichnet. Der Titel seiner Gedichtbände, "Fachsprachen", wird als ironisch interpretiert, da Stolterfoht die Worte von ihrer gewohnten Bedeutung befreit und sie in reduzierten Satzstrukturen verwendet, im Gegensatz zum üblichen Bedeutungsgehalt von Termini in Fachsprachen. Der Vergleich mit anderen Lyrikern wie Michael Lenz und Thomas Kling verdeutlicht die Besonderheit von Stolterfohts Ansatz.
Gedichtanalyse: Dieses Kapitel analysiert das Gedicht (8) aus Stolterfohts Band "Fachsprachen X-XVIII". Die Abwesenheit eines Paratextes wird als bewusste Entscheidung des Autors interpretiert, um den Fokus auf die Sinnfreiheit der Wörter zu lenken und den Leser nicht durch bedeutungstragende Elemente abzulenken. Die Analyse des Strophen- und Versbaus zeigt freie Verse mit Trochäen und Daktylen, aber ohne durchgängiges Metrum. Die Anzahl der Silben und Betonungen variiert, wobei eine gewisse Regelmäßigkeit erkennbar ist. Es werden keine Endreime verwendet, dafür aber Binnenreime. Die Analyse hebt die besondere Struktur des Gedichts und den bewussten Verzicht auf konventionelle lyrische Mittel hervor.
Schlüsselwörter
Ulf Stolterfoht, Gegenwartslyrik, Gedichtanalyse, Fachsprache, Dekonstruktivismus, Reflexionslyrik, Sprachreduktion, freie Verse, Metrum, Reim, Sinnfreiheit, Celan, Lenz, Kling.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Ulf Stolterfoht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Arbeitsweise des Gegenwartslyrikers Ulf Stolterfoht und untersucht insbesondere seinen Umgang mit Sprache und Bedeutung in seinen Gedichten. Der Fokus liegt auf der Dekonstruktion von Sprache und der Reduktion sprachlicher Mittel.
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert hauptsächlich das Gedicht (8) aus Stolterfohts Band "Fachsprachen X-XVIII".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der Arbeitsweise Ulf Stolterfohts, die Untersuchung der sprachlichen Mittel und ihrer Reduktion in seinen Gedichten, die Bedeutung der Dekonstruktion in seiner Lyrik und einen Vergleich mit anderen Lyrikern wie Celan, Lenz und Kling. Weitere Themen sind der Dekonstruktivismus und die Reflexionslyrik in Stolterfohts Werk sowie die Abwendung von der traditionellen Bedeutung der Worte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Gedichtanalyse, eine Auseinandersetzung mit dem Begriff "Fachsprache" im Kontext von Stolterfohts Werk, eine detaillierte Beschreibung von Stolterfohts Arbeitsweise (inklusive Dekonstruktivismus und Reflexionslyrik), eine Erörterung der Reduktion sprachlicher Mittel und der Abwendung von der Bedeutung der Worte, Verknüpfungen zu anderen Lyrikern (z.B. Pastior) und schließlich ein Resümee.
Welche methodischen Herausforderungen gab es?
Die geringe Anzahl an wissenschaftlichen Arbeiten über Stolterfoht stellte eine Herausforderung dar. Die Analyse stützt sich daher teilweise auf Zeitungsartikel und online verfügbare Interviews.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ulf Stolterfoht, Gegenwartslyrik, Gedichtanalyse, Fachsprache, Dekonstruktivismus, Reflexionslyrik, Sprachreduktion, freie Verse, Metrum, Reim, Sinnfreiheit, Celan, Lenz, Kling.
Wie wird die "Fachsprache" in Stolterfohts Werk interpretiert?
Der Titel von Stolterfohts Gedichtbänden, "Fachsprachen", wird ironisch interpretiert, da Stolterfoht die Worte von ihrer gewohnten Bedeutung befreit und sie in reduzierten Satzstrukturen verwendet – im Gegensatz zum üblichen Bedeutungsgehalt von Termini in Fachsprachen.
Wie beschreibt die Arbeit Stolterfohts Umgang mit Sprache?
Stolterfoht zeichnet sich durch einen eigenwilligen Umgang mit Sprache aus, der sich durch die Verwendung von Wörtern abseits ihrer traditionellen Bedeutung und reduzierte Satzstrukturen auszeichnet.
Welche formalen Aspekte der Gedichtanalyse werden behandelt?
Die Gedichtanalyse betrachtet den Strophen- und Versbau, das Metrum (oder dessen Fehlen), die Anzahl der Silben und Betonungen, Reime (Binnenreime und das Fehlen von Endreimen) und die allgemeine Struktur des Gedichts.
Wie wird die Abwesenheit eines Paratextes interpretiert?
Die Abwesenheit eines Paratextes im analysierten Gedicht wird als bewusste Entscheidung des Autors interpretiert, um den Fokus auf die Sinnfreiheit der Wörter zu lenken und den Leser nicht durch bedeutungstragende Elemente abzulenken.
- Quote paper
- Rene Ben Amor (Author), 2006, Gegenwartslyriker Ulf Stolterfoht-Fachsprachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93896