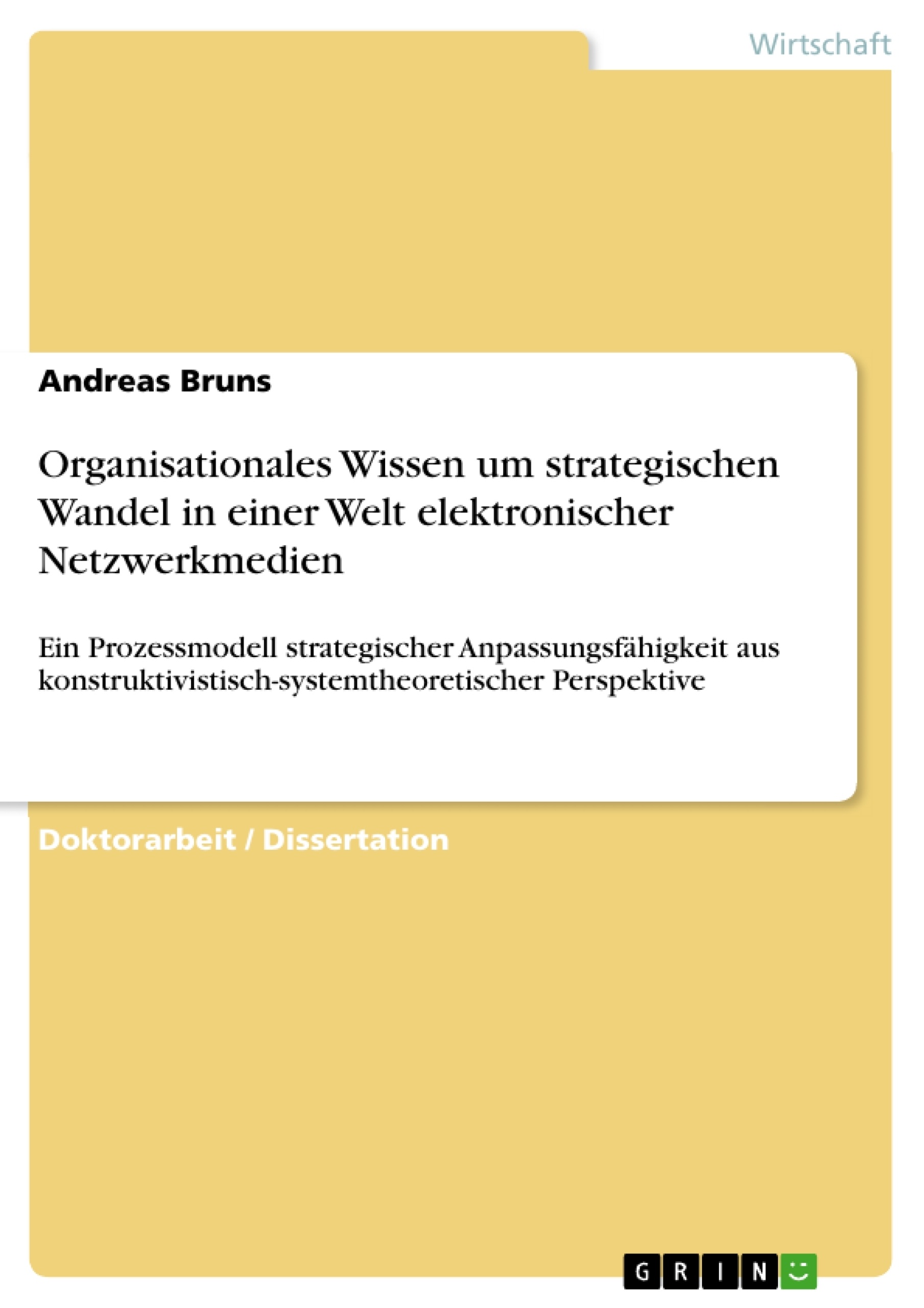In der heutigen dynamischen Informationsgesellschaft hängt der Erfolg einer Organisation nicht mehr von einmal gesetzten Impulsen ab, sondern es zählt die Fähigkeit, Strategien ständig den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Vorliegende Konzepte des organisationalen Wandels trivialisieren komplexe Sachverhalte auf eine Weise, dass sie nur über eine sehr begrenzte Geltung verfügen. Theorien der Selbstorganisation, wie z.B. die neuere Systemtheorie, die eine angemessenere Betrachtung erlauben, sind dagegen bisher kaum auf die anwendungsorientierte Organisationsforschung übertragen worden. Vor diesem Hintergrund wird im erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Teil der Untersuchung auf Grundlage der neueren Systemtheorie eine pluralistische Forschungsstrategie abgeleitet, die auch für pragmatische Gestaltungshinweise zu nutzen ist. Im Anschluss steht die Entwicklung eines konkreten Forschungsrahmens, bestehend aus einem „Forschungsobjekt Organisation” als analytische Einheit verschiedener Systeme bzw. Untersuchungsperspektiven und einem modelltheoretischen Lösungsansatz strategischer Anpassungsfähigkeit, der gleichzeitig den Anwendungsfall für etwaige Gestaltungshinweise darstellt. Strategische Anpassungsfähigkeit entspricht danach einem „organisationalen Wissen um strategischen Wandel”, dessen Produktion durch das Vorhandensein bestimmter Bedingungen wahrscheinlicher wird. Im Unterschied zum üblichen Vorgehen werden so pragmatische Gestaltungsvorschläge abgeleitet, deren Zweck und Ziel aus abstrakten theoretischen Modellüberlegungen resultieren und nicht aus einem direkten – oft trügerischen – Praxiszusammenhang. Abschließend verdeutlicht ein Prozessmodell zur Realisierung eines „Organisationalen Wissens um strategischen Wandel” in einer Welt elektronischer Netzwerkmedien die praktische Anwendbarkeit des verwendeten begrifflichen Konzepts und die praktische Aussagefähigkeit der logischen Schlussfolgerungen. Konkret erfolgt eine beispielhafte Überprüfung des abstrakten Modells durch die Ableitung resultierender Anforderungen für das Software-Design eines IT-Tools zur Unterstützung von strategischer Anpassungsfähigkeit. Das IT-Tool wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts als Prototyp verwirklicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Grundüberlegungen
- 2.1 Wissenschaftsziel
- 2.2 Epistemologische Basis dieser Arbeit
- 2.2.1 Grenzen einer abbildtheoretischen Perspektive
- 2.2.2 Radikaler Konstruktivismus
- 2.2.3 Erkenntnistheoretische Einordnung des Radikalen Konstruktivismus
- 2.2.4 Die Erweiterung des Radikalen Konstruktivismus zu einer allgemeinen Theorie beobachtender Systeme
- 2.3 Resultierende Implikationen für ein konstruktivistisch-systemtheoretisches Wissenschaftsverständnis
- 2.3.1 Allgemeine wissenschaftstheoretische Konsequenzen
- 2.3.2 Methodologische Konsequenzen
- 2.4 Eine pluralistische Forschungsstrategie als geeignete Methodik für Anwendungsorientierung
- 3 Beschreibung des Forschungsobjekts Organisation' mit Hilfe systemtheoretischer Ansätze
- 3.1 Systemtheoretische Ansätze zur Modellbildung
- 3.1.1 Allgemeine Systemtheorie und Kybernetik
- 3.1.2 Anwendung der Systemtheorie als Modelltheorie
- 3.2 Die Theorie sozialer Systeme zur Begriffs- und Problembildung
- 3.2.1 Grundzüge der Theorie sozialer Systeme
- 3.2.2 Verschiedene Typen sozialer Systeme
- 3.2.3 Die Organisation im eigentlichen Sinne (i.e.S.) als autopoietisches soziales System
- 3.3 Das Forschungsobjekt Organisation': Eine Organisation im weiteren Sinne (i.w.S.) als Einheit verschiedener Systeme
- 3.1 Systemtheoretische Ansätze zur Modellbildung
- 4 Die Festlegung relevanter Systeme einer Organisation i.w.S.
- 4.1 Die äußere Umwelt: Das Gesellschaftssystem unter besonderer Berücksichtigung elektronischer Netzwerkmedien
- 4.2 Die normative bzw. formale Sozialstruktur: Das Organisationssystem als Organisation i.e.S.
- 4.3 Die Systeme der inneren Umwelt der Organisation i.e.S.
- 4.3.1 Die Verhaltensstrukturen bzw. die informellen Sozialstrukturen: Interaktionssysteme
- 4.3.2 Die Beteiligten bzw. Mitglieder: Bewusstseinssysteme
- 4.3.3 Die Technik: Informations-Technische Systeme (IT)
- 4.4 Zwischenfazit
- 5 Das Problem: Strategische Anpassung von Organisationen i.e.S.
- 5.1 Evolutionärer Wandel von Organisationen
- 5.1.1 Evolution von Organisationspopulationen (Population-Ecology-Ansatz)
- 5.1.2 Kognition und Evolution bei Weick
- 5.1.3 Evolution von Organisationen als soziale Systeme
- 5.1.4 Einseitigkeit organisationaler Beobachtung als Problem evolutionärer Bewährung
- 5.2 Organisationen zwischen Zweck- und Systemrationalität
- 5.2.1 Zweckrationalität und Rationalitätsmythos
- 5.2.2 Relative Zweckrationalität und Systemrationalität
- 5.2.3 Systemrationalität durch einen Rationalitätsmythos 2. Ordnung
- 5.3 Notwendigkeit strategischer Anpassungsfähigkeit von Organisationen
- 5.3.1 Der Strategiebegriff und die Notwendigkeit strategischer Anpassungsfähigkeit
- 5.3.2 Der Begriff organisationaler Wandel/Anpassung
- 5.3.3 Strategische Anpassung von Organisationen i.e.S.
- 5.1 Evolutionärer Wandel von Organisationen
- 6 Der Lösungsansatz: Strategische Anpassungsfähigkeit als ,organisationales Wissen um strategischen Wandel'
- 6.1 Konzept eines organisationalen Wissens in einer Welt elektronischer Netzwerkmedien
- 6.2 ,Organisationales Wissen um strategischen Wandel': Ein dualistisches Verständnis
- 6.2.1 Generierung eines Zweifels durch strategische Information
- 6.2.2 Das Know-how der Generierung strategischer Information
- 6.3 Ein formales Entscheidungsprogramm 2. Ordnung als Voraussetzung für Gestaltungshinweise
- 6.3.1 Ermöglichung von ,Organisationalem Wissen um strategischen Wandel' als Zweck des Programms
- 6.3.2 Eine strategische Agenda als Mittel zur Umsetzung des Programms
- 6.4 Resultierende prinzipielle Anforderungen der Organisation i.e.S. an ihre innere Umwelt
- 6.4.1 Das Prinzip polykontextueller Beobachtung
- 6.4.2 Das Prinzip des begrenzten Zufalls
- 6.4.3 Das Prinzip einer begrenzten Subversivität
- 6.5 Zwischenfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die strategische Anpassungsfähigkeit von Organisationen in einer Welt elektronischer Netzwerkmedien. Ziel ist die Entwicklung eines Prozessmodells, das auf konstruktivistisch-systemtheoretischen Grundlagen basiert und die Herausforderungen des Wandels für Organisationen beleuchtet.
- Organisationsentwicklung im Kontext elektronischer Netzwerkmedien
- Systemtheoretische Modellierung organisationaler Prozesse
- Konstruktivistisches Wissenschaftsverständnis und dessen methodologische Implikationen
- Strategische Anpassung als organisationales Wissen
- Entwicklung eines Prozessmodells für strategische Anpassungsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik der strategischen Anpassungsfähigkeit von Organisationen in Zeiten elektronischer Netzwerkmedien ein. Sie skizziert die Problemstellung und die Relevanz des Themas und bietet einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit eines neuen Verständnisses organisationaler Anpassung im Angesicht der durch digitale Medien veränderten Umweltbedingungen.
2 Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Grundüberlegungen: Dieses Kapitel legt die epistemologischen und wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es begründet die Wahl des radikalen Konstruktivismus als epistemologische Basis und diskutiert die methodischen Konsequenzen dieser Wahl für die Untersuchung des Forschungsthemas. Die kritische Auseinandersetzung mit abbildtheoretischen Perspektiven und die detaillierte Erläuterung des radikalen Konstruktivismus bildet den Kern dieses Kapitels. Besonders relevant ist hier die Erweiterung des Konstruktivismus zu einer allgemeinen Theorie beobachtender Systeme.
3 Beschreibung des Forschungsobjekts Organisation' mit Hilfe systemtheoretischer Ansätze: Dieses Kapitel beschreibt den Begriff "Organisation" unter systemtheoretischen Gesichtspunkten. Es werden verschiedene systemtheoretische Ansätze vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit auf das Forschungsobjekt angewendet. Der Fokus liegt auf der Organisation als autopoietisches soziales System und ihrer Einbettung in ein komplexes Umfeld aus verschiedenen interagierenden Systemen. Die Unterscheidung zwischen Organisation im eigentlichen und weiteren Sinne wird detailliert erläutert.
4 Die Festlegung relevanter Systeme einer Organisation i.w.S.: Das Kapitel analysiert die relevanten Systeme, die eine Organisation im weiteren Sinne (i.w.S.) beeinflussen und von ihr beeinflusst werden. Die Analyse umfasst die äußere Umwelt (Gesellschaftssystem), die normative Sozialstruktur (Organisationssystem i.e.S.), sowie die Systeme der inneren Umwelt (Interaktionssysteme, Bewusstseinssysteme, Informations-Technische Systeme). Die Interdependenzen zwischen diesen Systemen werden eingehend untersucht, um ein umfassendes Bild der organisationalen Einbettung zu schaffen.
5 Das Problem: Strategische Anpassung von Organisationen i.e.S.: Hier wird das zentrale Problem der Arbeit – die strategische Anpassung von Organisationen – detailliert beschrieben. Es werden verschiedene evolutionäre Ansätze zur Erklärung organisationalen Wandels diskutiert, insbesondere die Herausforderungen der Einseitigkeit organisationaler Beobachtung und der Balance zwischen Zweck- und Systemrationalität werden beleuchtet. Das Kapitel führt zu dem Schluss, dass eine erhöhte strategische Anpassungsfähigkeit essentiell für das Überleben von Organisationen ist.
6 Der Lösungsansatz: Strategische Anpassungsfähigkeit als ,organisationales Wissen um strategischen Wandel': Dieses Kapitel präsentiert den zentralen Lösungsansatz der Arbeit: strategische Anpassungsfähigkeit als "organisationales Wissen um strategischen Wandel". Es wird ein dualistisches Verständnis dieses Wissens entwickelt, das sowohl die Generierung von strategischem Wissen als auch das Know-how seiner Anwendung umfasst. Das Kapitel beschreibt ein formales Entscheidungsprogramm zweiter Ordnung als Werkzeug zur Förderung dieser Anpassungsfähigkeit und formuliert die daraus resultierenden Anforderungen an die innere Organisation.
Schlüsselwörter
Strategische Anpassungsfähigkeit, Organisationen, elektronische Netzwerkmedien, Systemtheorie, Radikaler Konstruktivismus, organisationales Wissen, strategischer Wandel, autopoietische Systeme, evolutionäre Organisationstheorie, Zweck- und Systemrationalität.
Häufig gestellte Fragen zur Dissertation: Strategische Anpassungsfähigkeit von Organisationen in einer Welt elektronischer Netzwerkmedien
Was ist das zentrale Thema dieser Dissertation?
Die Dissertation untersucht die strategische Anpassungsfähigkeit von Organisationen im Kontext elektronischer Netzwerkmedien. Das Hauptziel ist die Entwicklung eines Prozessmodells, das auf konstruktivistisch-systemtheoretischen Grundlagen basiert und die Herausforderungen des Wandels für Organisationen beleuchtet.
Welche wissenschaftstheoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem radikalen Konstruktivismus und erweitert diesen zu einer allgemeinen Theorie beobachtender Systeme. Abbildtheoretische Perspektiven werden kritisch diskutiert. Die methodologischen Konsequenzen dieser epistemologischen Wahl werden ausführlich dargelegt.
Wie wird der Begriff "Organisation" definiert?
Die Dissertation beschreibt "Organisation" unter systemtheoretischen Gesichtspunkten, insbesondere als autopoietisches soziales System. Es wird zwischen Organisation im eigentlichen Sinne (i.e.S.) und im weiteren Sinne (i.w.S.) unterschieden, wobei letztere als Einheit verschiedener interagierender Systeme betrachtet wird.
Welche Systeme werden im Zusammenhang mit der Organisation betrachtet?
Die Analyse umfasst die äußere Umwelt (Gesellschaftssystem, insbesondere elektronische Netzwerkmedien), die normative Sozialstruktur (Organisationssystem i.e.S.), sowie die Systeme der inneren Umwelt (Interaktionssysteme, Bewusstseinssysteme, Informations-Technische Systeme). Die Interdependenzen dieser Systeme werden untersucht.
Was ist das zentrale Problem, das die Dissertation adressiert?
Das zentrale Problem ist die strategische Anpassung von Organisationen an die Herausforderungen einer sich schnell verändernden Umwelt, die durch elektronische Netzwerkmedien geprägt ist. Die Herausforderungen der Einseitigkeit organisationaler Beobachtung und des Verhältnisses von Zweck- und Systemrationalität werden besonders hervorgehoben.
Welchen Lösungsansatz bietet die Dissertation?
Der Lösungsansatz besteht in der Konzeption von strategischer Anpassungsfähigkeit als "organisationales Wissen um strategischen Wandel". Dies beinhaltet ein dualistisches Verständnis, das sowohl die Generierung strategischer Information als auch das Know-how ihrer Anwendung umfasst. Ein formales Entscheidungsprogramm zweiter Ordnung wird als Werkzeug vorgeschlagen.
Welche Anforderungen werden an die innere Organisation gestellt?
Die Dissertation formuliert drei prinzipielle Anforderungen an die innere Umwelt der Organisation: das Prinzip polykontextueller Beobachtung, das Prinzip des begrenzten Zufalls und das Prinzip einer begrenzten Subversivität.
Welche Kapitel umfasst die Dissertation?
Die Dissertation besteht aus sechs Kapiteln: Einführung, Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Grundüberlegungen, Beschreibung des Forschungsobjekts Organisation, Festlegung relevanter Systeme, Das Problem: Strategische Anpassung, und Der Lösungsansatz: Strategische Anpassungsfähigkeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Strategische Anpassungsfähigkeit, Organisationen, elektronische Netzwerkmedien, Systemtheorie, Radikaler Konstruktivismus, organisationales Wissen, strategischer Wandel, autopoietische Systeme, evolutionäre Organisationstheorie, Zweck- und Systemrationalität.
- Quote paper
- Andreas Bruns (Author), 2006, Organisationales Wissen um strategischen Wandel in einer Welt elektronischer Netzwerkmedien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93902