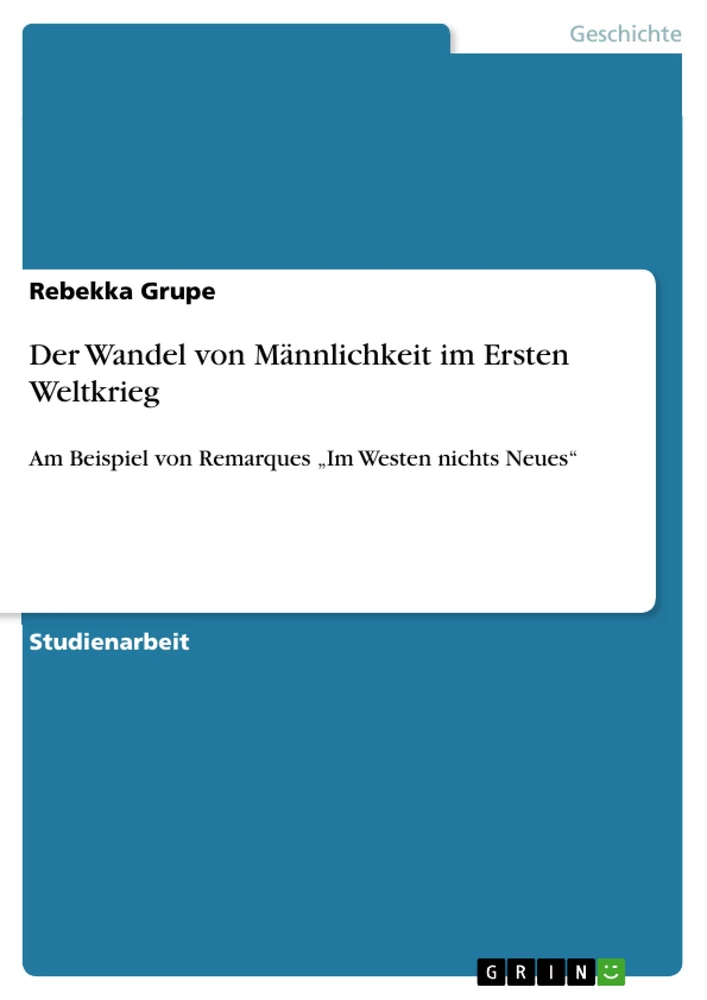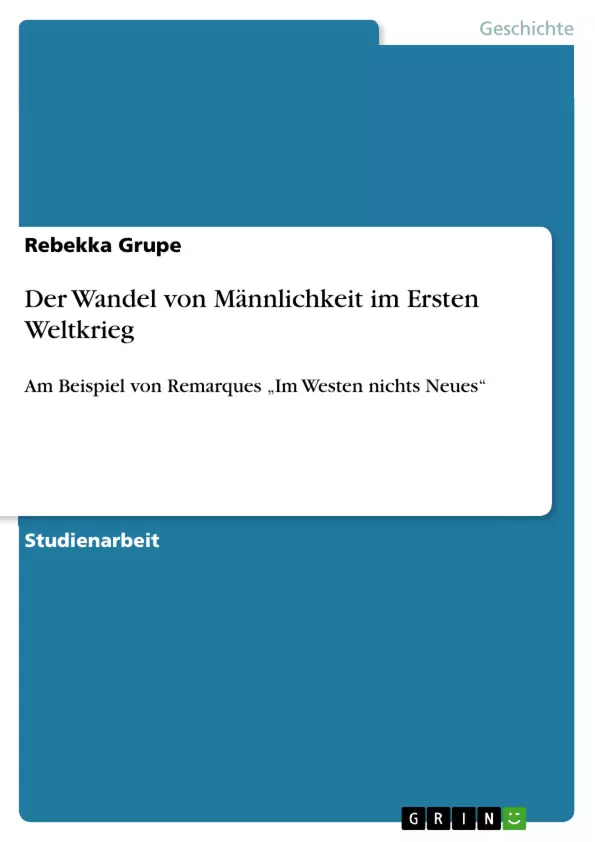Wie lebten und überlebten deutsche Soldaten an der Front während des Ersten Weltkrieges? Wie hat sich ihre Einstellung zum Krieg und wie haben sie sich selbst verändert? Diese Arbeit soll zeigen, dass die ursprüngliche Abenteuerlust und Hoffnung auf Ehre schnell der brutalen Realität an der Front weichen musste. Die Männlichkeit, die vor dem Krieg als Ideal galt, konnte währenddessen nicht aufrecht erhalten werden. Dies soll am Roman „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque geschehen. Obwohl ein fiktionaler Text, ist der Roman ein wahrheitsabbildendes Zeugnis für die Situation der deutschen Frontsoldaten. Das Problem, einen fiktionalen Text als historische Quelle zu benutzen, soll als Grundlage der Arbeit als erstes erläutert und gelöst werden. An verschiedenen Punkten wird dargelegt, weshalb dem Roman, der auch heute noch zum Kanon der Weltliteratur zählt, ein derartiger Wahrheitsgehalt zugeschrieben wird.
Als weitere Grundlage wird der Begriff der hegemonialen Männlichkeit eingeführt und diskutiert. Die Thesen Connells und weitere Forschungsliteratur zeigen, wie Männlichkeitsideale entstehen, sich entwickeln und verändern. Außerdem wird ein kurzer Überblick über die Darstellung der Männlichkeit in anderen Kriegsromanen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. IM WESTEN NICHTS NEUES - EINE HISTORISCHE QUELLE?
- 2.1. DER ROMAN ALS HISTORISCHE QUELLE
- 2.2. ERICH MARIA REMARQUE
- 2.3. REZEPTION
- 3. IDEALTYPUS DES MANNES? MÄNNLICHKEITEN IM WANDEL
- 4. NEUE MÄNNER NACH DER FRONT? DER ROMAN „IM WESTEN NICHTS NEUES“
- 4.1. INHALT UND AUFBAU
- 4.2. KRIEGSVORSTELLUNGEN VON HEIMAT UND FRONT
- 4.3. DARSTELLUNG DES FEINDES
- 4.4. DARSTELLUNG DES VERWUNDETEN UND STERBENDEN MANNES
- 4.5. ENTWICKLUNG DES CHARAKTERS HIMMELSTOB
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Männlichkeit im Ersten Weltkrieg anhand von Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“. Ziel ist es, zu zeigen, wie die anfängliche Abenteuerlust und der Glaube an heldenhafte Männlichkeit der brutalen Realität an der Front weichen mussten. Der Roman, obwohl fiktional, dient als wahrheitsgetreues Zeugnis der Erfahrungen deutscher Soldaten.
- Der Roman „Im Westen nichts Neues“ als historische Quelle
- Das Ideal der hegemonialen Männlichkeit und sein Zerfall im Krieg
- Darstellung des Krieges und seiner Auswirkungen auf die Soldaten
- Veränderung der Kriegsvorstellungen und der Identität der Soldaten
- Entwicklung des Charakters Himmelstoss und seine Repräsentation des Wandels der Männlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt mit einem eindringlichen Zitat aus Remarques Roman in die Thematik des Ersten Weltkriegs und seiner Auswirkungen auf die Soldaten ein. Sie skizziert die Forschungsfrage nach den Lebensbedingungen und der Veränderung der Einstellungen deutscher Soldaten an der Front. Der Fokus liegt auf dem Wandel der vor dem Krieg idealisierten Männlichkeit, der anhand des Romans „Im Westen nichts Neues“ untersucht wird. Die Arbeit thematisiert die Problematik der Verwendung eines fiktionalen Textes als historische Quelle und führt den Begriff der hegemonialen Männlichkeit ein, um die Analyse der Männlichkeitsbilder im Roman zu strukturieren.
2. Im Westen nichts Neues - eine historische Quelle?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, inwiefern Remarques Roman als historische Quelle geeignet ist. Es diskutiert die Unterscheidung zwischen Traditions- und Überrestquellen und analysiert die Verwendung literarischer Texte in der Geschichtswissenschaft. Unter Bezugnahme auf die Forschung von Ingmar Reither, Theodor Mommsen, Alexander Demandt und Jurij Striedter wird argumentiert, dass fiktionale Literatur, sofern die Darstellung von Fiktion und historischer Faktizität stimmig ist, einen wertvollen Beitrag zur Geschichtsforschung leisten kann. Der Roman „Im Westen nichts Neues“ wird in diesem Kontext als authentisches Zeugnis der Erlebnisse deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg betrachtet.
2.2. Erich Maria Remarque: Dieses Kapitel liefert einen kurzen Abriss aus dem Leben Remarques, der für die Interpretation seines Romans relevant ist. Es fokussiert auf seinen Kriegsdienst, seine Verwundung und die Entstehung des Romans aus einem inneren Zwang, der durch die nachwirkenden „Schatten des Krieges“ verursacht wurde. Die Analyse verneint eine explizit politische Intention des Autors, betonen aber den später gewonnenen politischen Stellenwert seines Werkes. Die Frage nach der Wahrheitsgemäßheit der Darstellung des Kriegsgeschehens wird gestellt und bleibt ein zentraler Punkt für die Verwendung des Romans als historische Quelle.
3. Idealtypus des Mannes? Männlichkeiten im Wandel: (Kapitel fehlt im Auszug)
4. Neue Männer nach der Front? Der Roman „Im Westen nichts Neues“: Dieses Kapitel, das Herzstück der Analyse, untersucht die im Roman präsentierten Männlichkeitsbilder. Durch die Fokussierung auf vier Oberthemen (Inhalt und Aufbau, Kriegsvorstellungen von Heimat und Front, Darstellung des Feindes, Darstellung des Verwundeten und Sterbenden Mannes, Entwicklung des Charakters Himmelstoss) wird aufgezeigt, wie das Ideal der heldenhaften Männlichkeit durch die Kriegserfahrungen zerbricht. Die Kapitel analysieren die Erfahrungen der Soldaten im Kontext der vorherrschenden Männlichkeitsvorstellungen und belegen, wie der Krieg diese Vorstellungen nachhaltig verändert.
5. Fazit: (Kapitel fehlt im Auszug)
Schlüsselwörter
Erster Weltkrieg, Männlichkeit, Erich Maria Remarque, „Im Westen nichts Neues“, historische Quelle, Kriegsliteratur, hegemoniale Männlichkeit, Soldatenerfahrungen, Trauma, Identitätswandel.
Häufig gestellte Fragen zu „Im Westen nichts Neues“ - Eine Analyse des Männerbildes im Ersten Weltkrieg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert den Wandel der Männlichkeit im Ersten Weltkrieg anhand von Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“. Der Fokus liegt darauf, wie die anfängliche Abenteuerlust und der Glaube an heldenhafte Männlichkeit der brutalen Realität an der Front weichen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie der Roman als historische Quelle für die Erforschung des Wandels der Männlichkeit im Ersten Weltkrieg verwendet werden kann. Sie beleuchtet die Darstellung des Krieges und seiner Auswirkungen auf die Soldaten, die Veränderung der Kriegsvorstellungen und der Identität der Soldaten, sowie die Entwicklung des Charakters Himmelstoss als Repräsentant dieses Wandels.
Wie wird der Roman „Im Westen nichts Neues“ in der Arbeit betrachtet?
Der Roman wird als wahrheitsgetreues Zeugnis der Erfahrungen deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg betrachtet, obwohl er fiktional ist. Die Arbeit diskutiert die Eignung des Romans als historische Quelle und bezieht sich auf die Forschung verschiedener Historiker zu diesem Thema.
Welche Aspekte des Romans werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert den Inhalt und Aufbau des Romans, die Darstellung der Kriegsvorstellungen von Heimat und Front, die Darstellung des Feindes, die Darstellung des verwundeten und sterbenden Mannes und die Entwicklung des Charakters Himmelstoss. Diese Analyse dient dazu, den Zerfall des Ideals der heldenhaften Männlichkeit durch die Kriegserfahrungen aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt der Begriff der „hegemonialen Männlichkeit“?
Der Begriff der hegemonialen Männlichkeit dient als analytisches Werkzeug, um die im Roman präsentierten Männlichkeitsbilder zu strukturieren und zu untersuchen, wie diese durch den Krieg verändert werden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, „Im Westen nichts Neues - eine historische Quelle?“, Erich Maria Remarque, Idealtypus des Mannes? Männlichkeiten im Wandel, Neue Männer nach der Front? Der Roman „Im Westen nichts Neues“, und Fazit. Der Auszug enthält nicht alle Kapitel vollständig.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erster Weltkrieg, Männlichkeit, Erich Maria Remarque, „Im Westen nichts Neues“, historische Quelle, Kriegsliteratur, hegemoniale Männlichkeit, Soldatenerfahrungen, Trauma, Identitätswandel.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie sich die Männlichkeitsvorstellungen deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg unter den Bedingungen des Krieges verändert haben. Dies wird anhand der Darstellung im Roman „Im Westen nichts Neues“ untersucht.
- Quote paper
- Rebekka Grupe (Author), 2007, Der Wandel von Männlichkeit im Ersten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93917