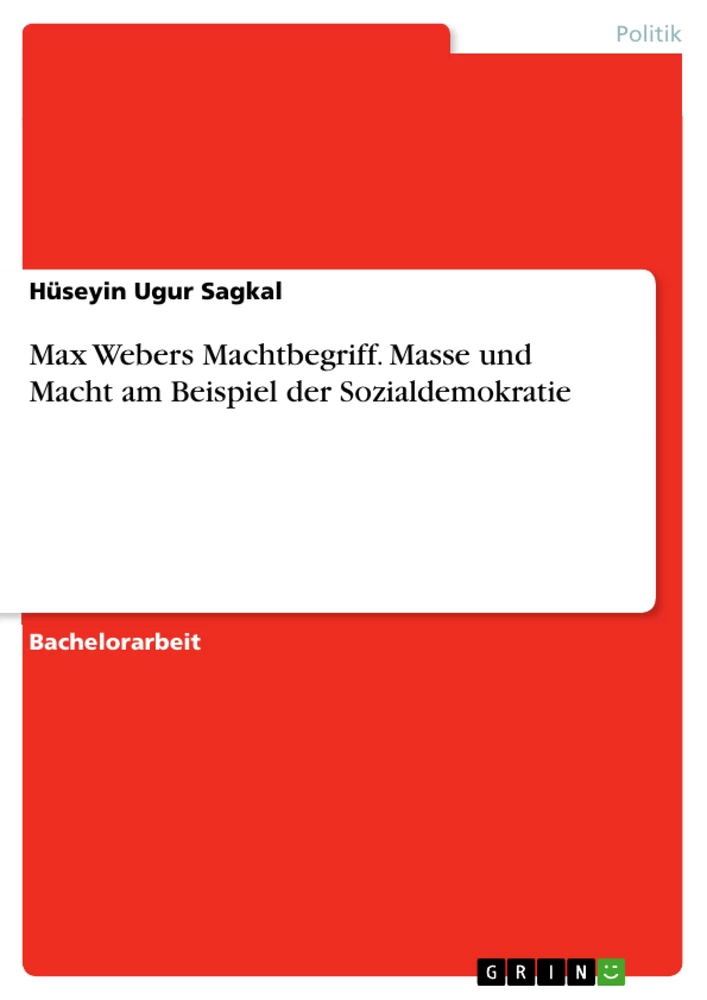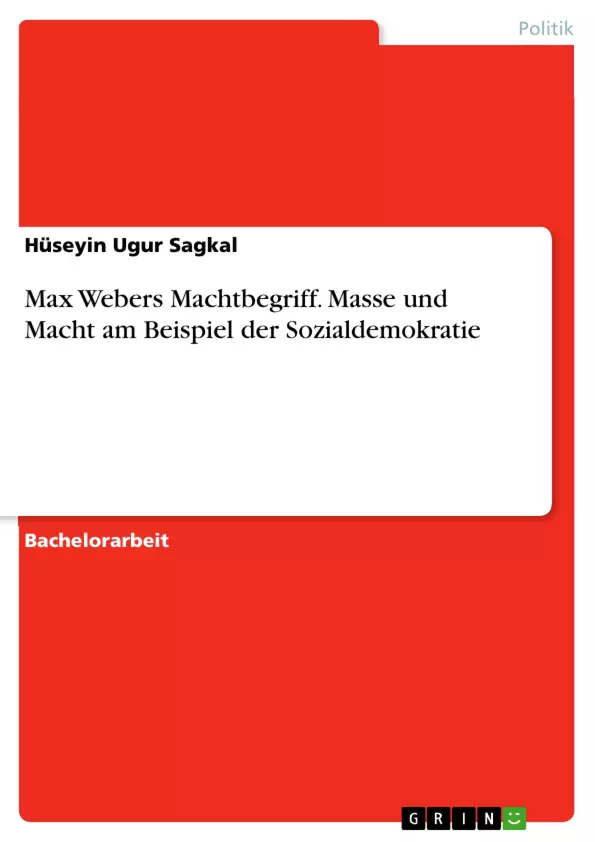Das zentrale Anliegen der Arbeit ist, die Bedeutung von Masse und Macht in Max Webers Werken zu untersuchen. Am Beispiel der Sozialdemokratie soll Webers Konzept von „Masse und Macht“ veranschaulicht werden. Die Sozialdemokratie wurde aus praktischen Gründen gewählt. Einerseits greift Weber in seinen Werken sehr viele Beispiele der Sozialdemokratie auf, andererseits ist die Sozialdemokratie in Webers Zeiten die größte Bewegung, die Massen auf der ganzen Welt mobilisieren konnte. Stellvertretend für die Sozialdemokratie wird die SPD analysiert werden, da sie in Deutschland die deutlichste politische Manifestation der Sozialdemokratie war und immer noch ist.
Maximilian Carl Emil „Max“ Weber ist bis heute der bedeutendste deutsche Soziologe. Sein Einfluss reicht bis in die Kultur-, Sozial-, Politik- und Geschichtswissenschaften
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsmethode und Literatur
- Definition Zentraler Begriffe
- Bedeutung von Masse und Macht in Webers politischem Denken
- Der charismatische Führer als Herrscher
- Webers Forderung nach „plebiszitärer Demokratie\" charismatischen Charakters
- Die Sozialdemokratie als Beispiel für Masse und Macht
- August Bebel als charismatische Führer
- Die sozialdemokratische ,,Masse"
- Der Abstieg der Sozialdemokratie
- Ausblick
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Masse und Macht in Max Webers Werken zu untersuchen. Da es zu diesem Thema bisher keine ausreichende Forschung gibt, soll die Arbeit die Grundlage für zukünftige Forschungen zu Max Webers Machtbegriff liefern.
- Analyse von Webers Machtbegriff im Kontext der Masse
- Untersuchung der Rolle des charismatischen Führers in Webers Theorie
- Beurteilung der Bedeutung der Sozialdemokratie als Beispiel für Masse und Macht in Webers Werken
- Exploration der Verbindung zwischen Webers Machtbegriff und dem Konzept der „plebiszitärer Demokratie"
- Bewertung der Auswirkungen der Masse auf die politische Macht im Kontext von Webers Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz von Max Webers Machtbegriff und die Forschungslücke in Bezug auf die Verbindung zwischen Masse und Macht in seinen Werken dar.
- Das zweite Kapitel erläutert die Forschungsmethode und die relevanten Quellen, die in dieser Arbeit verwendet werden.
- Das dritte Kapitel bietet eine Definition wichtiger Begriffe, die für das Verständnis von Webers Machtbegriff essenziell sind.
- Kapitel 4 untersucht die Bedeutung von Masse und Macht in Webers politischem Denken und beleuchtet dabei die Rolle des charismatischen Führers und Webers Forderung nach einer plebiszitären Demokratie.
- Kapitel 5 analysiert die Sozialdemokratie als Beispiel für Masse und Macht und beleuchtet dabei die Figur von August Bebel als charismatischen Führer, die Rolle der sozialdemokratischen Masse und den Abstieg der Sozialdemokratie im Laufe der Zeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Macht, Masse, Charisma, Sozialdemokratie und plebiszitäre Demokratie in Bezug auf die Werke von Max Weber. Sie untersucht die Interaktion zwischen diesen Konzepten und analysiert die Auswirkungen der Masse auf die politische Macht im Kontext von Webers Theorien.
Häufig gestellte Fragen
Wie definierte Max Weber den Begriff „Macht“?
Für Weber ist Macht die Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.
Was versteht Weber unter einem „charismatischen Führer“?
Ein charismatischer Führer ist eine Person, der aufgrund außergewöhnlicher (übernatürlicher oder vorbildlicher) Eigenschaften Gehorsam geleistet wird. Ein Beispiel in Webers Werk ist August Bebel für die Sozialdemokratie.
Was ist eine „plebiszitäre Demokratie“?
Es handelt sich um eine Form der Führerdemokratie, in der das Volk den Führer wählt und ihm Vertrauen schenkt, dieser aber weitgehende Vollmachten zur Gestaltung der Politik besitzt.
Warum analysierte Weber die SPD als Beispiel für „Masse“?
Die SPD war zu Webers Zeit die größte Massenbewegung, die weltweit Menschen mobilisieren konnte. Sie diente ihm als Modell zur Untersuchung politischer Manifestationen und Massenpsychologie.
Welche Rolle spielt die Bürokratisierung beim Abstieg der Sozialdemokratie?
Weber beobachtete, dass Massenbewegungen mit der Zeit zur Bürokratisierung neigen, wodurch der ursprüngliche charismatische Schwung verloren geht und die Macht in die Hände eines Apparats übergeht.
- Quote paper
- Hüseyin Ugur Sagkal (Author), 2020, Max Webers Machtbegriff. Masse und Macht am Beispiel der Sozialdemokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/940588