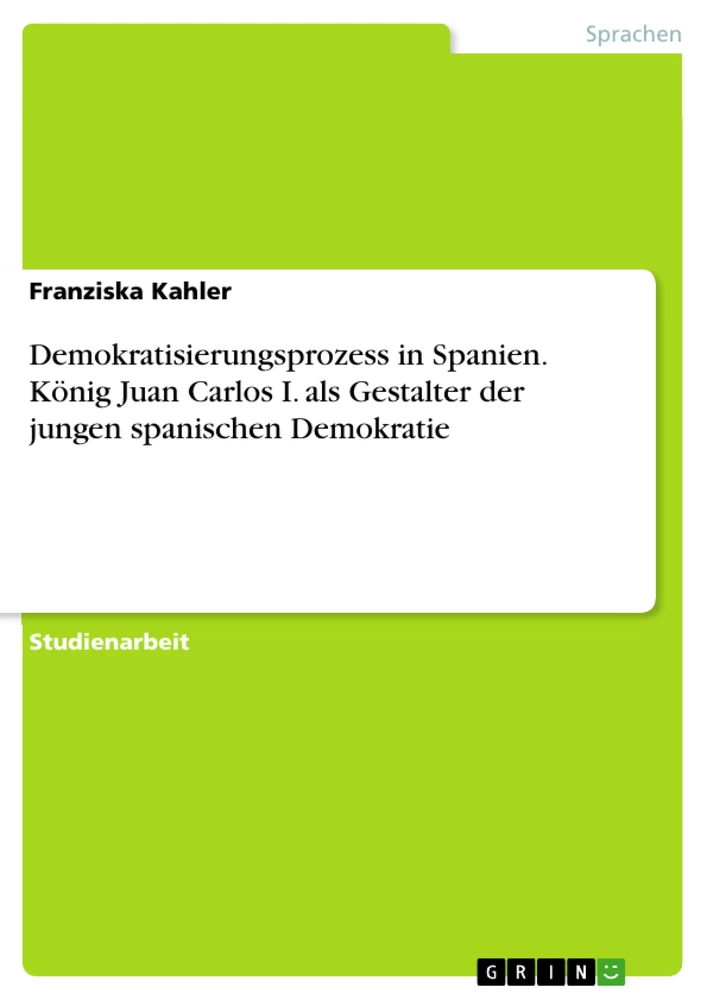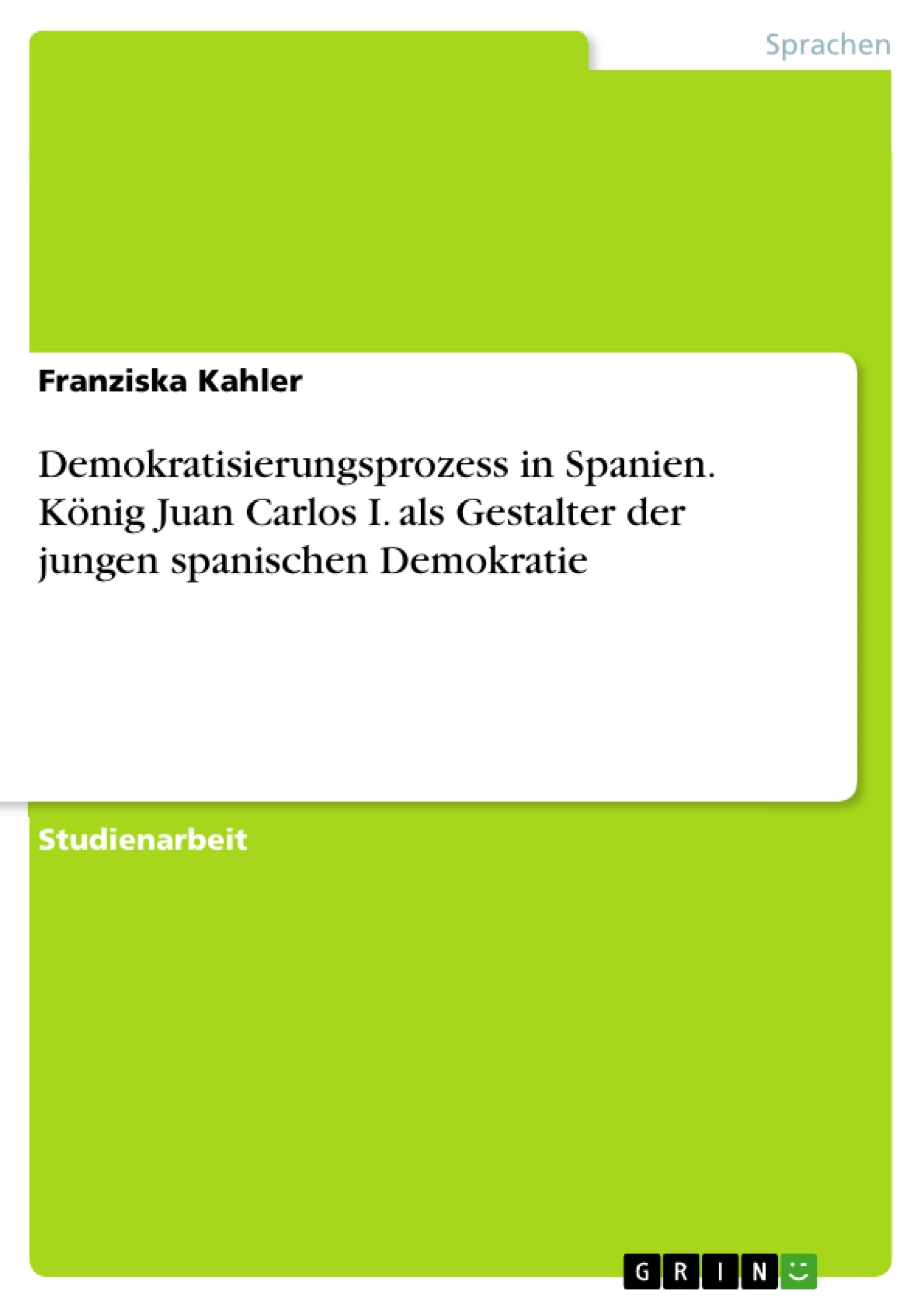In der Arbeit wird der Fokus auf der Rolle Juan Carlos‘ bei der Demokratisierung Spaniens und der Bewältigung des Putschversuches vom 23. Februar 1981 liegen. Dabei soll es um die Prüfung der These gehen, ob die Demokratisierung Spaniens und die Niederschlagung des Putsches in der Hauptsache als Verdienste des Königs angesehen werden können.
Dazu verschafft das erste Kapitel einen Überblick über die Franco-Ära und benennt die wichtigsten Stützen des Franco-Regimes. Zudem werden innen- wie außenpolitische Konsequenzen des Franquismus für Spanien aufgezeigt und schließlich die von Franco getroffene Nachfolgeregelung dargestellt. All dies zeichnet die Lage Spaniens zum Zeitpunkt der Inthronisation Juan Carlos‘ vor und bedingt die Anfänge des Demokratisierungsprozesses. Wie der König diesen gestaltete und seine neuen Befugnisse einsetzte, wird im darauffolgenden Kapitel skizziert. Im letzten Kapitel erfolgt der Blick auf den genannten Putschversuch. Dazu wird zunächst aufgezeigt, wie das Militär seine Funktion im spanischen Staat historisch begründet interpretierte, da sich daran das Instrument der Militärputsche rechtfertigen lässt.
Anschließend folgt eine Schilderung des Ablaufes des Putsches bis hin zu seiner Vereitelung durch König Juan Carlos I. und eine Darstellung der Folgen dieses Ereignisses. In der Zusammenfassung wird auf Grundlage der im Hauptteil gewonnenen Erkenntnisse die oben angeführte These bewertet werden, ob die Demokratisierung Spaniens und die Niederschlagung des Putsches hauptsächlich als Verdienste des Königs bewertet werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Franco-Ära
- Falange, Militär und Kirche – Die wichtigsten Stützen Francos
- Entwicklung spanischer Wirtschaft und Gesellschaft unter Franco
- Francos Nachfolge - Die Rolle der Monarchie
- Vom Franquismus zur Demokratie
- Die Machtfülle des königlichen Nachfolgers
- Demokratisierung Spaniens unter König Juan Carlos I
- Der Putschversuch vom 23. Februar 1981 als Bewährungsprobe für Spaniens junge Demokratie
- Die historische Bedeutung der Streitkräfte in Spanien
- Der Putschversuch vom 23. Februar 1981
- Die Folgen des gescheiterten Putsches
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Rolle von König Juan Carlos I. im Demokratisierungsprozess Spaniens, insbesondere im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom 23. Februar 1981. Die Arbeit analysiert, ob die erfolgreiche Demokratisierung und die Niederschlagung des Putsches als Verdienste des Königs angesehen werden können.
- Die Franco-Ära: Analyse des politischen und sozialen Kontextes unter Franco und die Herausforderungen, die dieser für die spätere Demokratisierung mit sich brachte.
- Der Wandel vom Franquismus zur Demokratie: Die Rolle von König Juan Carlos I. in der Gestaltung des Übergangs und die Herausforderungen, die sich während der Transition ergaben.
- Der Putschversuch vom 23. Februar 1981: Analyse der Hintergründe, des Verlaufs und der Folgen des Putsches und die Bedeutung des Königlichen Eingreifens.
- Der Einfluss des Militärs in Spanien: Historische Perspektive auf die Rolle der Streitkräfte und ihre Bedeutung für die Stabilität des politischen Systems.
- Bewertung der Rolle von Juan Carlos I.: Analyse seiner Leistungen bei der Demokratisierung Spaniens und der Bewältigung des Putschversuchs.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Franco-Ära und analysiert die wichtigsten Stützen des Franco-Regimes: Falange, Militär und Kirche. Es werden die innen- und außenpolitischen Konsequenzen des Franquismus für Spanien aufgezeigt und die von Franco getroffene Nachfolgeregelung dargestellt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Machtfülle des königlichen Nachfolgers, Juan Carlos I., und skizziert seine Rolle in der Gestaltung des Demokratisierungsprozesses Spaniens. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sich während der Transition vom Franquismus zur Demokratie ergaben.
Das letzte Kapitel behandelt den Putschversuch vom 23. Februar 1981. Es werden die historischen Wurzeln des Putsches im Kontext der Rolle des Militärs in Spanien aufgezeigt und der Ablauf des Putsches sowie seine Vereitelung durch König Juan Carlos I. geschildert. Schließlich werden die Folgen des gescheiterten Putsches für Spanien dargestellt.
Schlüsselwörter
Demokratisierung, Spanien, Juan Carlos I., Franco-Ära, Franquismus, Putschversuch, 23. Februar 1981, Militär, Guardia Civil, Übergang, Transition, Nachfolge, Monarchie, Republik, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Geschichte.
- Quote paper
- Franziska Kahler (Author), 2019, Demokratisierungsprozess in Spanien. König Juan Carlos I. als Gestalter der jungen spanischen Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/940964