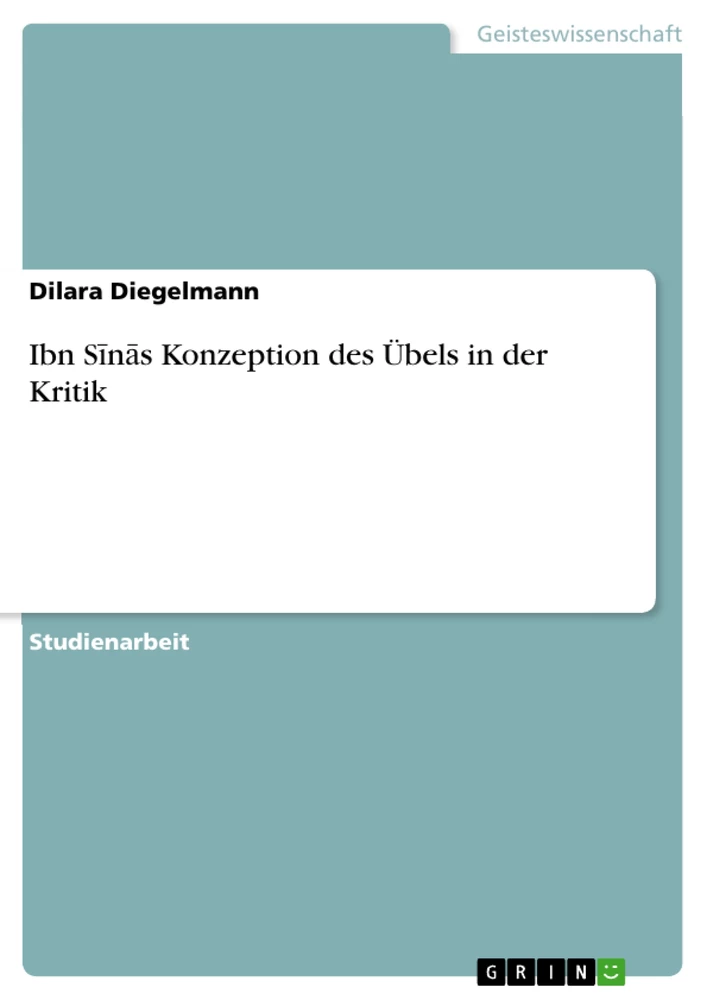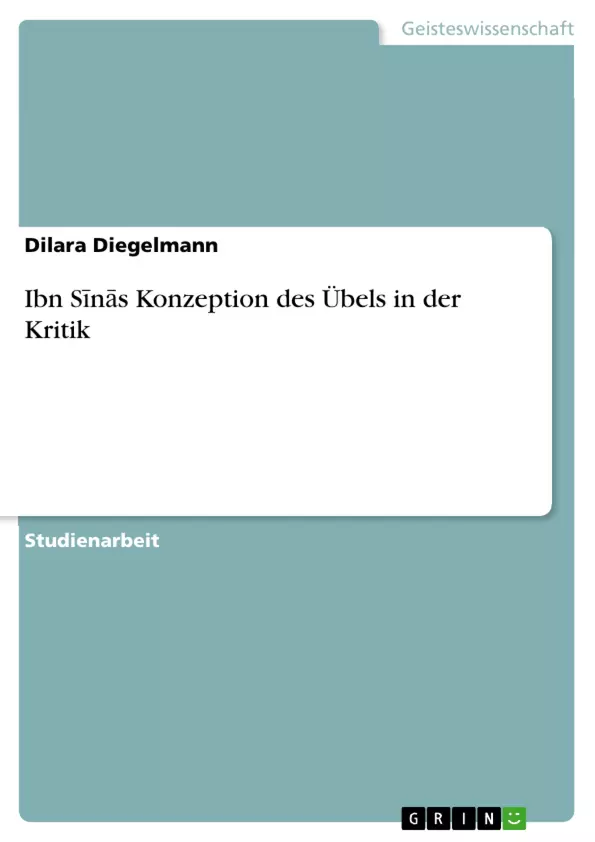Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Perspektive des Abū ‘Ali al-Ḥusayn Ibn Sīnā, der 370/980 im heutigen Usbekistan geboren wurde und im Westen vorwiegend unter dem latinisierten Namen Avicenna bekannt ist. Im Gegensatz zu den Ansätzen von Augustinus, Thomas von Aquin oder Leibniz hat Ibn Sīnās Konzeption des Übels im europäisch-amerikanischen Diskurs bisher wenig Beachtung gefunden. Dabei wurden eben jene Denker maßgeblich von Ibn Sīnā beeinflusst. Ibn Sīnā kommt in der Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und noch heute im muslimisch geprägten Kulturraum eine herausragende Stellung zu. Sein philosophisch relevantester Beitrag bezieht sich auf die Metaphysik, welche er als rationale Wissenschaft, die die innere Struktur der Welt erforscht, definiert. Zahlreiche Arbeiten des Ibn Sīnā zeichnen sich neben dem logisch-argumentativen Vorgehen durch ihre Einbettung in den arabisch-islamischen Kontext aus. Ibn Sīnā versteht sich an erster Stelle als Philosoph und wurde vor allem von Aristoteles stark beeinflusst. Sein Denken weist jedoch ebenso Züge des Neoplatonismus auf. Gleichzeitig behauptet er die Vereinbarkeit seiner Thesen mit dem Islam. Laut Ibn Sīnā bietet die Philosophie einen rationalen Zugriff auf den muslimischen Glauben.
Vor diesem Hintergrund soll die Frage beantwortet werden, inwiefern seine Sicht des Übels haltbar ist. Doch haltbar in Bezug auf was? Was aus dem einen Blickwinkel sinnvoll erscheint, mag aus dem anderen keineswegs überzeugend wirken. Schließlich sollte Ibn Sīnās Theorie an jenen Maßstäben gemessen werden, die er selbst dafür beansprucht. Aus diesem Grund widmet sich die Arbeit der Untersuchung, ob das vorgestellte Konzept vom Übel in der Welt a) unter philosophisch-rationalen und b) unter muslimischen Gesichtspunkten haltbar ist – oder genauer der Kohärenz der Argumentationsstruktur sowie der Vereinbarkeit mit dem Koran und der islamischen Tradition hadīth. Betrachtet werden vor allem das Buch der Heilung Kitāb al-šifā’, das den größten Einfluss auf die christlich-europäische Philosophie hatte, sowie das Buch der Hinweise und Mahnungen Kitāb al-išārāt wa'l-tanbīhāt, welches insbesondere im östlichen Kulturraum rezipiert wurde. Die Analyse beschränkt sich dabei in beiden Werken jeweils auf die Kapitel über die Metaphysik Ilāhiyyāt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ibn Sīnā über Gott und die Welt
- Abhandlungen über das Übel
- Aspekte des Übels
- Ibn Sīnās Theodizee
- Philosophische Diskussion der Theodizee
- Islamische Diskussion der Theodizee
- Handlungstheoretisches Übel
- Philosophische Diskussion der Handlungstheorie
- Islamische Diskussion der Handlungstheorie
- Ibn Sīnās Theodizee
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption des Übels bei Ibn Sīnā, einem bedeutenden Philosophen des Mittelalters, und beleuchtet sie sowohl aus philosophischer als auch aus muslimischer Perspektive. Sie befasst sich insbesondere mit der Frage, inwiefern Ibn Sīnās Theorie des Übels kohärent ist und mit dem Koran und der islamischen Tradition hadīth vereinbar ist.
- Ibn Sīnās Metaphysik und Gottesbegriff
- Ibn Sīnās Analyse des Übels in seinen Werken „Kitāb al-šifā'“ und „Kitāb al-išārāt wa'l-tanbīhāt“
- Die Theodizee und die Frage nach der Vereinbarkeit von Übel und einem allmächtigen, gütigen Gott
- Die Handlungstheorie und die Rolle des Menschen bei der Entstehung des Übels
- Die Relevanz von Ibn Sīnās Werk für die philosophische und theologische Diskussion des Übels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema, in der anhand eines aktuellen Beispiels die Aktualität des Problems des Übels aufgezeigt wird. Anschließend wird Ibn Sīnās Metaphysik und sein Gottesbegriff erläutert, die Grundlage für sein Verständnis des Übels bilden. Das dritte Kapitel fasst Ibn Sīnās Aussagen über das Übel in seinen beiden Hauptwerken, „Kitāb al-šifā'“ und „Kitāb al-išārāt wa'l-tanbīhāt“, zusammen. Es werden die verschiedenen Aspekte des Übels, wie die Theodizee und die Handlungstheorie, in den beiden folgenden Kapiteln näher beleuchtet. Das letzte Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und beantwortet die Untersuchungsfragen bezüglich der Haltbarkeit von Ibn Sīnās Konzept des Übels aus philosophischer und muslimischer Perspektive.
Schlüsselwörter
Ibn Sīnā, Avicenna, Übel, Theodizee, Handlungstheorie, Metaphysik, Ontologie, Gottesbegriff, Islam, Koran, hadīth, Kitāb al-šifā', Kitāb al-išārāt wa'l-tanbīhāt.
- Citation du texte
- Dilara Diegelmann (Auteur), 2020, Ibn Sīnās Konzeption des Übels in der Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/941384