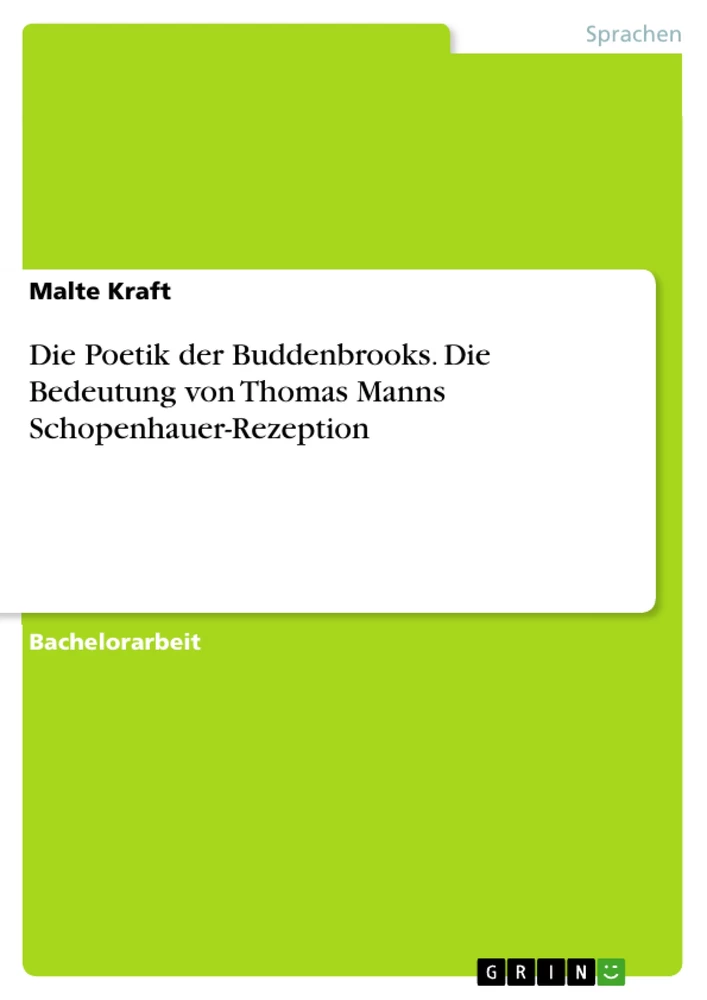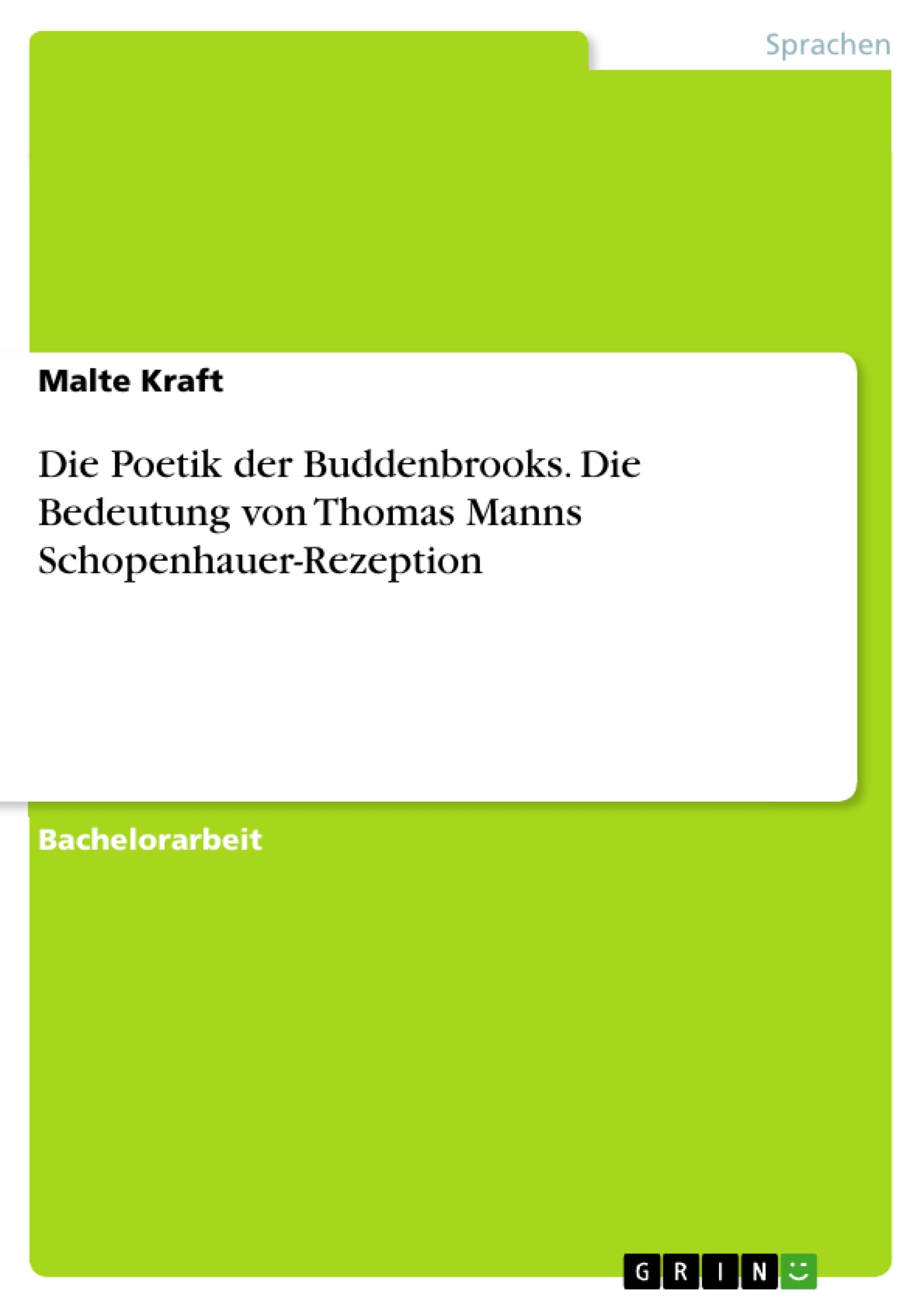Diese Arbeit widmet sich dem Einfluss Thomas Manns Rezeption der "Welt als Wille und Vorstellung" von Arthur Schopenhauer auf Manns Roman "die Buddenbrooks". Philosophische Inhalte der "Welt als Wille und Vorstellung" werden erörtert.
Einer zutiefst pessimistischen Metaphysik, die auf den Autor Thomas Mann, während des Verfassens seines Romans Buddenbrooks, eine unvergleichliche Anziehungskraft ausübte und von ihm in diesem verarbeitet wurde. Mit Manns Worten: „Es war ein großes Glück, und in meinen Erinnerungen habe ich gelegentlich davon erzählt, daß ich ein Erlebnis, wie dieses, nicht in mich verschließen brauchte, daß eine schöne Möglichkeit davon zu zeugen, dafür zu danken, sofort sich darbot, dichterische Unterkunft unmittelbar dafür bereit war.“ Der Einfluss Arthur Schopenhauers auf die Poesie des Buddenbrooks-Romans äußert sich nicht nur in jener Textstelle mit expliziter Erwähnung der WWV, er äußert sich in der Sinngebung des Leidens, des Verfalls und des Todes als praktische Seite der Philosophie im gesamten Roman. Dies erweitert die literarische Rezeption des Textes um eine philosophische Komponente, die es nachzuweisen gilt. Eben das ist Inhalt dieser Arbeit. Anhand von Textstellen aus der Buddenbrooks weise ich den Einfluss der Schopenhauer-Rezeption Manns auf die Poesie seines populärsten Romans nach. Bei der Realisierung der Buddenbrooks bediente sich der Eklektiker Mann nicht nur der Eindrücke seiner Schopenhauer-Rezeption. Auch Der Einfluss Nietzsches und Wagners ist erkennbar und verschwimmt mit der schopenhauerschen Philosophie.
Inhaltsverzeichnis
- 1. PROBLEMSTELLUNG
- 2. SCHOPENHAUERS „WELT ALS WILLE UND VORSTELLUNG“
- 2.1 Die Welt als Vorstellung
- 2.2 Die Welt als Wille
- 2.3 Ueber den Tod und sein Verhältniß zur Unzerstörbarkeit unseres Wesens an sich.
- 2.4. Die Verneinung des Willens.
- 3. THOMAS MANNS SCHOPENHAUER-EINFLÜSSE
- 4. THOMAS BUDDENBROOKS SCHOPENHAUER-LESEERLEBNIS
- 4.1 Charakterisierung des Thomas Buddenbrook.
- 4.2 Der Einfluss der Welt als Wille und Vorstellung auf Thomas Buddenbrook.
- 5. KONKLUSION.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Arthur Schopenhauers Philosophie, insbesondere seiner „Welt als Wille und Vorstellung“, auf Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“. Ziel ist es, die Bedeutung der Schopenhauer-Rezeption für die Poetik des Romans aufzuzeigen und zu belegen, wie Schopenhauers Ideen in der Gestaltung der Figuren, insbesondere in der Figur des Thomas Buddenbrook, und in der Darstellung von Themen wie Leid, Verfall und Tod zum Ausdruck kommen.
- Die Rezeption von Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung“ durch Thomas Mann
- Der Einfluss der schopenhauerschen Philosophie auf die Gestaltung der Figur des Thomas Buddenbrook
- Die Darstellung von Leid, Verfall und Tod im Roman im Kontext von Schopenhauers Philosophie
- Die Rolle der Schopenhauer-Rezeption für die Poetik des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Problemstellung
Das Kapitel führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein und beleuchtet den Einfluss von Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung“ auf die Poetik des Romans „Buddenbrooks“. Es stellt die Figur des Thomas Buddenbrook und dessen Lektüreerlebnis des Schopenhauer-Werkes in den Mittelpunkt und erläutert die Relevanz der Schopenhauer-Rezeption für die Interpretation des Romans.
- Kapitel 2: Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung“
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die wichtigsten Inhalte von Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung“. Es beleuchtet die erkenntnistheoretischen Grundlagen des Werkes, insbesondere den Satz vom Grunde, und erläutert zentrale Begriffe wie „Welt als Vorstellung“ und „Welt als Wille“.
- Kapitel 3: Thomas Manns Schopenhauer-Einflüsse
Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Arthur Schopenhauer auf Thomas Manns literarisches Schaffen im Allgemeinen. Es betrachtet Manns Auseinandersetzung mit der schopenhauerschen Philosophie und deren Einfluss auf seine Werke, insbesondere auf die Buddenbrooks.
- Kapitel 4: Thomas Buddenbrooks Schopenhauer-Leseerlebnis
Das Kapitel analysiert die Figur des Thomas Buddenbrook im Kontext der Schopenhauer-Rezeption. Es betrachtet die Rolle der Lektüre von „Welt als Wille und Vorstellung“ für die Entwicklung und das Verhalten des Protagonisten und beleuchtet, wie die Schopenhauer-Ideen in der Figur des Thomas Buddenbrook zum Ausdruck kommen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themengebiete der Schopenhauer-Rezeption, der philosophischen Einflüsse auf die Poetik von Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“, insbesondere auf die Figur des Thomas Buddenbrook, und die Darstellung von Leid, Verfall und Tod im Roman. Zentrale Begriffe sind „Welt als Wille und Vorstellung“, „Satz vom Grunde“, „Pessimismus“, „Verneinung des Willens“, „Lebenskrise“ und „Tod“.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Arthur Schopenhauer auf Thomas Mann?
Schopenhauers pessimistische Metaphysik beeinflusste Thomas Mann massiv während der Arbeit an „Buddenbrooks“, insbesondere bei der Darstellung von Leid, Verfall und Tod.
Wie spiegelt sich Schopenhauers Philosophie in der Figur Thomas Buddenbrook wider?
Thomas Buddenbrook erlebt eine existentielle Krise, die durch die Lektüre von „Die Welt als Wille und Vorstellung“ eine philosophische Deutung erfährt, was seinen Umgang mit dem Tod prägt.
Was bedeutet „Die Welt als Wille“ bei Schopenhauer?
Der Wille ist bei Schopenhauer ein blinder, unaufhörlicher Drang, der das Wesen der Welt ausmacht und die Ursache allen Leidens ist.
Was ist der „Satz vom Grunde“?
Es ist ein erkenntnistheoretisches Prinzip, das besagt, dass alles eine Erklärung oder einen Grund hat; für Schopenhauer gilt dies nur für die Welt als Vorstellung.
Welche Rolle spielt die „Verneinung des Willens“ im Roman?
Die Verneinung des Willens zum Leben ist ein zentrales Motiv, das den Niedergang der Familie Buddenbrook und die Hinwendung zum Geistigen oder zum Tod begleitet.
- Quote paper
- Malte Kraft (Author), 2019, Die Poetik der Buddenbrooks. Die Bedeutung von Thomas Manns Schopenhauer-Rezeption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/941448