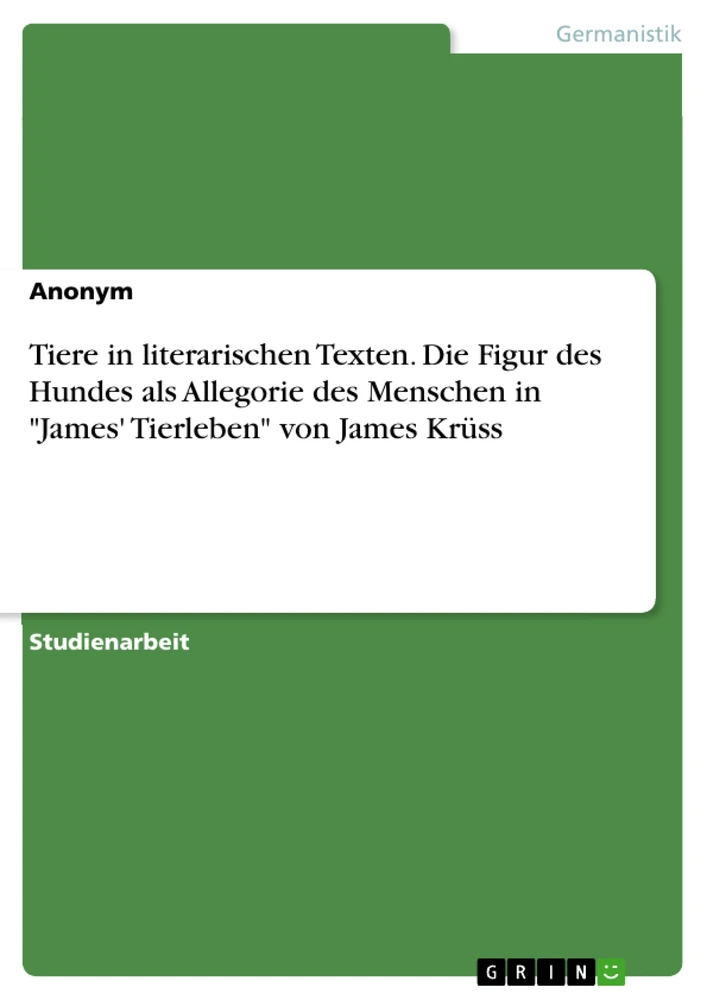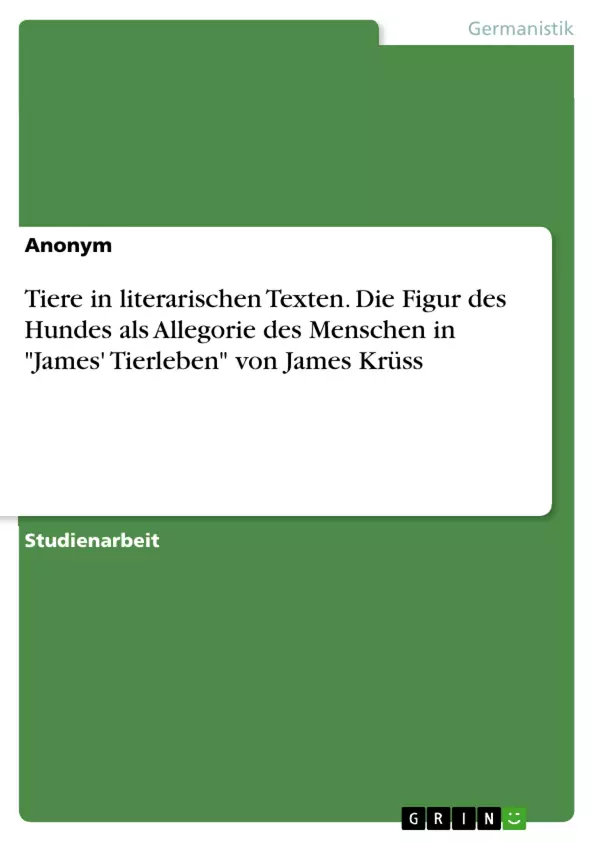Warum verwendet ein Autor ein Tier? Welche menschlichen Züge können an diesem Tier festgemacht werden? Wie schafft es der Autor, dass man im Verhalten des Tieres den Menschen sehen kann? Mithilfe dieser Fragestellen versucht die Arbeit herauszufinden, inwiefern sich die Figur des Hundes als Allegorie des Menschen lesen lässt.
Dabei unterzieht sich diese Arbeit der Analyse zweier ausgewählter Gedichte aus James Krüss Gedichtband. Um sich an die Forschungsfrage jedoch anzunähern, erscheint es als relevant, sich mit dem Forschungsgebiet der hierfür angebrachten „Cultural and Literary Animal Studies“ – vor allem nach Dr. Roland Borgards zitiert – auseinanderzusetzen. So versucht die Arbeit die hündischen Figuren aus textueller wie illustrativer Ebene zu verstehen und letztlich zu fragen, wie menschlich diese Figuren denn eigentlich dargestellt werden.
Egal ob Hund, Katz, Maus oder auch ein Pferd – Tiere begegnen uns Menschen ein Leben lang. Sei es als Haustier zu Hause, als exotisches Zootier, als Redewendung, in Filmen oder in Fabeln und Märchen. Tiere treten stets in unserem alltäglichen Dasein auf und nehmen dabei unterschiedliche Funktionen ein. Doch obwohl Tiere allgegenwärtig sind, konstituiert sich ein ungleiches Verhältnis von Menschen und Tier. So ist das Tier dem Menschen scheinbar unterlegen. Der Mensch kann sich mithilfe seines Verstandes und seiner Sprache deutlich vom Tier abheben. Dennoch steckt in jedem Menschen auch ein Tier. Evolutionsbiologisch betrachtet, stammt der Mensch vom Affen ab und kann sich so seiner tierischen Herkunft nicht leugnen. Umso erstaunter fällt es nun in der Literaturwissenschaft auf, dass sich viele Autoren – allen voran die Gebrüder Grimm – Tiere zu Nutzen machen, um bestimmte Inhalte zu transportieren.
Inhaltsverzeichnis
- Tiere in literarischen Texten
- Definition des Forschungsfeldes der Cultural and Literary Animal Studies nach Dr. Roland Borgards
- Figur des Hundes in den ausgewählten Gedichten als diegetische Tiere
- Hündische Protagonisten im Kontext eines realistischen Erzähluniversums
- Figur des Hundes als allegorischer Stellvertreter des Menschen mittels Kontextualisierung und Poetisierung
- Kontextualisierung
- Poetisierung
- Figuren des Bernhardiners und Dalmatiners in „Seltsames Zwiegespräch“ als Beispiel für Pluralität innerhalb der Gesellschaft
- Figurencharakterisierung auf Text- und Bildebene im Hinblick auf menschliche Attributzuschreibungen
- Der Bernhardiner als verunsicherte Figur
- Der Dalmatiner als aufgeschlossener Charakter
- Humor als wesentliches Stilmittel zur Verdeutlichung der Allegorie
- Bedeutung der Gedichtüberschrift „Seltsames Zwiegespräch“
- Humor als Spiegel menschlicher Stereotypien in Bezug auf die Protagonisten
- Abbilden des Themas Freundschaft am Beispiel eines Hunderudels im Gedicht „Der begossene Pudel“
- Stimmungsverlauf innerhalb des Gedichtes
- Markante Einzelstellung des Bildes im ganzen Gedichtband aufgrund der farblichen Gestaltung
- Aufmalen menschlicher Eigenschaften in der Illustration selbst
- Interpretation der sprachlichen Gestaltung ausgehend vom Erzählbericht
- Redensart im Titel des Gedichtes
- Abschließendes Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Figur des Hundes in zwei ausgewählten Gedichten aus James Krüss‘ Gedichtband „James' Tierleben“. Sie untersucht, inwiefern der Hund als allegorischer Stellvertreter des Menschen interpretiert werden kann. Dabei werden die hündischen Figuren auf ihre menschlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen hin analysiert, unter Berücksichtigung von Kontextualisierung und Poetisierung.
- Die Relevanz der Cultural and Literary Animal Studies für die Interpretation von Tierfiguren in literarischen Texten
- Die Darstellung von Hunden als diegetische Tiere in einem realistischen Erzähluniversum
- Die Verwendung von Humor als Stilmittel zur Verdeutlichung der Allegorie des Menschen
- Die Analyse der Figurencharakterisierung auf Text- und Bildebene
- Die Bedeutung von Freundschaft und Gemeinschaft im Kontext der hündischen Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema „Tiere in literarischen Texten“ ein und stellt das Forschungsfeld der Cultural and Literary Animal Studies vor. Insbesondere der Ansatz von Dr. Roland Borgards wird beleuchtet, um die Relevanz der Analyse von Tierfiguren in literarischen Texten zu unterstreichen. Im zweiten Kapitel werden die beiden ausgewählten Gedichte, „Seltsames Zwiegespräch“ und „Der begossene Pudel“, als Beispiele für die Darstellung von Hunden als diegetische Tiere vorgestellt. Dabei wird untersucht, wie die Figuren durch Kontextualisierung und Poetisierung als allegorische Stellvertreter des Menschen interpretiert werden können. Im dritten Kapitel wird die Figur des Hundes als Spiegelbild menschlicher Eigenschaften und Verhaltensweisen betrachtet, wobei der Fokus auf den Humor als Stilmittel liegt. Schließlich wird das Thema Freundschaft und Gemeinschaft im Gedicht „Der begossene Pudel“ untersucht, um die Bedeutung der Tierfigur im Kontext menschlicher Beziehungen zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Cultural and Literary Animal Studies, Tierfigur, Allegorie, Hund, Kontextualisierung, Poetisierung, Humor, Freundschaft, Gemeinschaft, James Krüss, „James' Tierleben“, „Seltsames Zwiegespräch“, „Der begossene Pudel“.
Häufig gestellte Fragen
Warum nutzen Autoren Tiere als Allegorien für Menschen?
Tiere dienen als Spiegel, um menschliche Verhaltensweisen, Stereotypen und soziale Dynamiken humorvoll oder kritisch zu verdeutlichen, ohne den Leser direkt anzugreifen.
Was sind "Cultural and Literary Animal Studies"?
Es ist ein Forschungsfeld, das das Verhältnis zwischen Mensch und Tier in der Kultur und Literatur untersucht, insbesondere wie Tiere textuell und illustrativ dargestellt werden.
Wie stellt James Krüss Hunde in seinem Werk dar?
In „James' Tierleben“ werden Hunde mit menschlichen Attributen versehen – etwa als verunsicherte oder aufgeschlossene Charaktere – um gesellschaftliche Pluralität abzubilden.
Was symbolisiert das Gedicht „Seltsames Zwiegespräch“?
Durch das Gespräch zwischen einem Bernhardiner und einem Dalmatiner werden menschliche Stereotypen und die Kommunikation innerhalb einer vielfältigen Gesellschaft thematisiert.
Welche Bedeutung hat Humor in der Tierdichtung?
Humor fungiert als wesentliches Stilmittel, um die Allegorie zugänglich zu machen und menschliche Schwächen durch die hündischen Protagonisten aufzuzeigen.
Was bedeutet die Redensart „Der begossene Pudel“ im literarischen Kontext?
Krüss nutzt diese Redewendung, um Themen wie Scham, Freundschaft und Gruppendynamik innerhalb eines Hunderudels auf menschliche Situationen zu übertragen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Tiere in literarischen Texten. Die Figur des Hundes als Allegorie des Menschen in "James' Tierleben" von James Krüss, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/941663