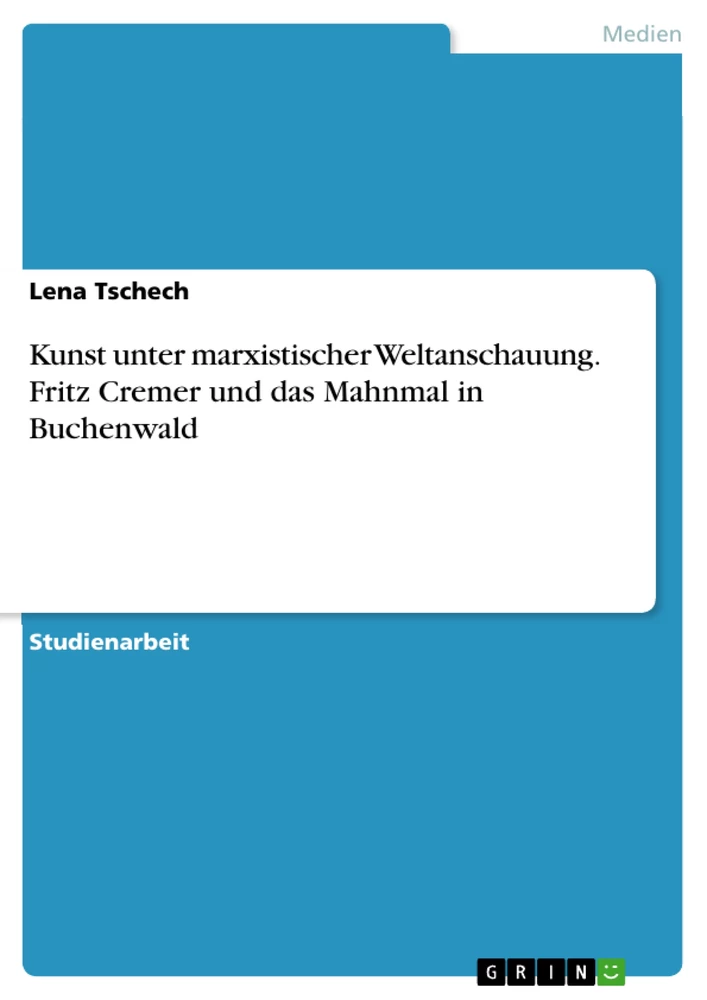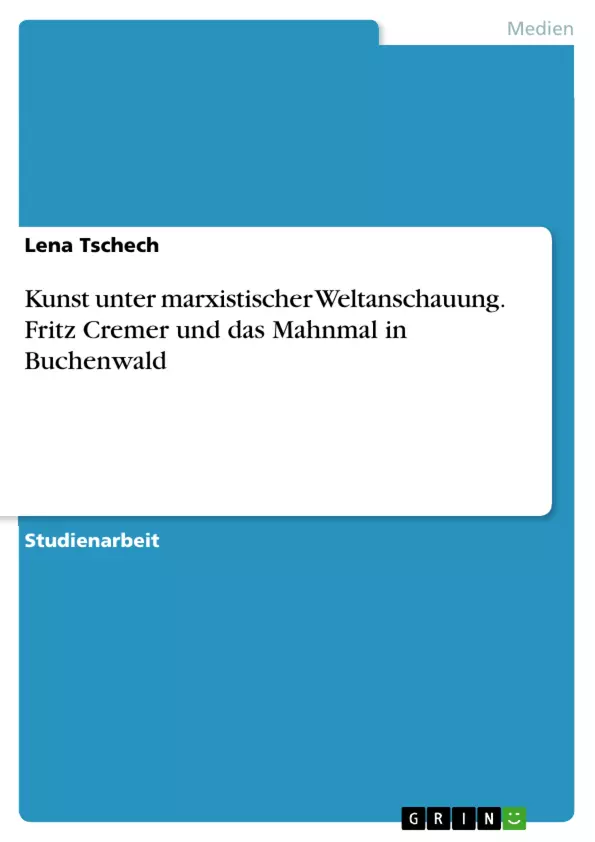Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Gruppenplastik für das Mahnmal im ehemaligen KZ Buchenwald, die der Künstler Fritz Cremer schuf. Um diese Plastik zu verstehen ist es notwendig den historischen Kontext sowie das Umfeld, in das sie eingebettet ist zu beleuchten.
So sollen zunächst das politische Leben und Werk des Künstlers betrachtet werden. Hier ist wichtig zu beachten, inwiefern die Werke unter dem Einfluss seiner marxistischen Weltanschauung standen. Es folgt ein Überblick über den gesamten Denkmalkomplex, in dem die Figurengruppe Cremers einen zentralen Platz einnimmt. Der Schaffensprozess des Künstlers wird anhand seiner drei Entwürfe verfolgt, die er für die Gruppenplastik schuf, von ihnen sollte der dritte verwirklicht werden. Als Inspiration für den ersten und zweiten Entwurf galten dem Künstler Rodins Plastik der "Bürger von Calais" und Eugène Delacroix` Gemälde "La Liberte guidant le peuple", so erscheint eine vergleichende Betrachtung der Entwürfe mit den Werken sinnvoll. Abschließend soll das Kunstwerk auf seine programmatische Nutzung in der DDR hin untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Leben und Werk
- Das Denkmal und sein Umfeld
- Die Buchenwald-Gruppe und ihre Vorgeschichte
- Erster Entwurf
- Der zweite Entwurf
- Der dritte Entwurf
- Buchenwald als nationale Mahn- und Gedenkstätte der DDR
- Ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gruppenplastik von Fritz Cremer für das Mahnmal in Buchenwald. Ziel ist es, die Plastik im historischen Kontext und ihrem Umfeld zu betrachten, Cremers Leben und Werk zu beleuchten, den Schaffensprozess anhand seiner drei Entwürfe zu verfolgen und die programmatische Nutzung des Kunstwerks in der DDR zu analysieren.
- Fritz Cremers Leben und künstlerische Entwicklung unter dem Einfluss seiner marxistischen Weltanschauung
- Der Schaffensprozess der Buchenwald-Plastik und die Inspiration durch Rodin und Delacroix
- Die Einbettung der Plastik in den Denkmalkomplex Buchenwald und seine Symbolik
- Die politische Instrumentalisierung des Mahnmals in der DDR
- Die Bedeutung von Cremers Mahnmal im Kontext anderer seiner Werke
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit analysiert Fritz Cremers Gruppenplastik für das Buchenwald-Mahnmal, indem sie den historischen Kontext, das Umfeld und den Schaffensprozess des Künstlers beleuchtet. Es werden Cremers politische Überzeugungen und deren Einfluss auf sein Werk untersucht, sowie ein Vergleich seiner Entwürfe mit Werken von Rodin und Delacroix gezogen. Abschließend wird die programmatische Nutzung des Kunstwerks in der DDR betrachtet.
Leben und Werk: Dieses Kapitel beschreibt das Leben von Fritz Cremer, beginnend mit seiner Ausbildung zum Steinbildhauer bis hin zu seiner Karriere als Professor und seine Mitgliedschaft in der KPD und später in der SED. Es wird auf die Entwicklung seines politischen Bewusstseins und dessen Einfluss auf sein sozialkritisches künstlerisches Schaffen eingegangen, welches stark von der Beschäftigung mit Denkmalplastiken für Konzentrationslager geprägt ist. Cremers Abkehr vom Glauben und seine Umdeutung christlicher Motive im marxistischen Sinne werden ebenfalls thematisiert.
Das Denkmal und sein Umfeld: Dieses Kapitel beschreibt den Denkmalkomplex Buchenwald als Ganzes, mit seiner Anordnung, beginnend beim Eingangstor und der Treppe, über die "Straße der Nationen" zu Cremers Figurengruppe und dem Turm der Freiheit. Die Symbolik des Leidenswegs der Häftlinge, die nationale und internationale Solidarität und der Kampf gegen den Faschismus werden im Kontext der Architektur und Gestaltung des Mahnmals herausgestellt.
Schlüsselwörter
Fritz Cremer, Buchenwald, Mahnmal, DDR, Skulptur, Gruppenplastik, Marxismus, Sozialismus, Konzentrationslager, Denkmalpflege, politische Kunst, Rodin, Delacroix, Historischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Fritz Cremers Buchenwald-Plastik"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gruppenplastik von Fritz Cremer für das Mahnmal in Buchenwald. Sie untersucht die Plastik im historischen Kontext, beleuchtet Cremers Leben und Werk, verfolgt den Schaffensprozess anhand seiner drei Entwürfe und analysiert die programmatische Nutzung des Kunstwerks in der DDR. Der Fokus liegt auf der Verbindung von Cremers marxistischer Weltanschauung und seiner künstlerischen Gestaltung des Mahnmals.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Cremers Leben und künstlerische Entwicklung unter dem Einfluss seiner marxistischen Weltanschauung; den Schaffensprozess der Buchenwald-Plastik und die Inspiration durch Rodin und Delacroix; die Einbettung der Plastik in den Denkmalkomplex Buchenwald und seine Symbolik; die politische Instrumentalisierung des Mahnmals in der DDR; und die Bedeutung von Cremers Mahnmal im Kontext anderer seiner Werke.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung, Leben und Werk, Das Denkmal und sein Umfeld (inkl. Unterkapitel zu den Entwürfen), Buchenwald als nationale Mahn- und Gedenkstätte der DDR und ein Fazit. Jedes Kapitel beleuchtet einen Aspekt der Buchenwald-Plastik und ihres Kontextes.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Arbeit und ihre Zielsetzung. Sie skizziert die Analyse der Gruppenplastik im historischen Kontext, untersucht Cremers politische Überzeugungen und ihren Einfluss auf sein Werk und betrachtet die programmatische Nutzung des Kunstwerks in der DDR.
Was erfährt man im Kapitel "Leben und Werk"?
Dieses Kapitel beschreibt Cremers Leben, von seiner Ausbildung bis zu seiner Karriere als Professor und seinen politischen Engagements (KPD, SED). Es analysiert die Entwicklung seines politischen Bewusstseins und dessen Einfluss auf sein sozialkritisches künstlerisches Schaffen, insbesondere im Hinblick auf Denkmalplastiken für Konzentrationslager. Seine Abkehr vom Glauben und die Umdeutung christlicher Motive im marxistischen Sinne werden ebenfalls thematisiert.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Das Denkmal und sein Umfeld"?
Dieses Kapitel beschreibt den Denkmalkomplex Buchenwald als Ganzes, von Eingangstor und Treppe bis zur Figurengruppe und dem Turm der Freiheit. Die Symbolik des Leidenswegs der Häftlinge, die nationale und internationale Solidarität und der Kampf gegen den Faschismus werden im Kontext der Architektur und Gestaltung des Mahnmals herausgestellt. Es beinhaltet detaillierte Informationen zu den drei Entwürfen der Plastik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Fritz Cremer, Buchenwald, Mahnmal, DDR, Skulptur, Gruppenplastik, Marxismus, Sozialismus, Konzentrationslager, Denkmalpflege, politische Kunst, Rodin, Delacroix, Historischer Kontext.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für die Kunstgeschichte der DDR, politische Kunst, Skulptur und die Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald interessiert. Die umfassende Analyse eignet sich für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen befassen.
- Quote paper
- Lena Tschech (Author), 2013, Kunst unter marxistischer Weltanschauung. Fritz Cremer und das Mahnmal in Buchenwald, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/941774