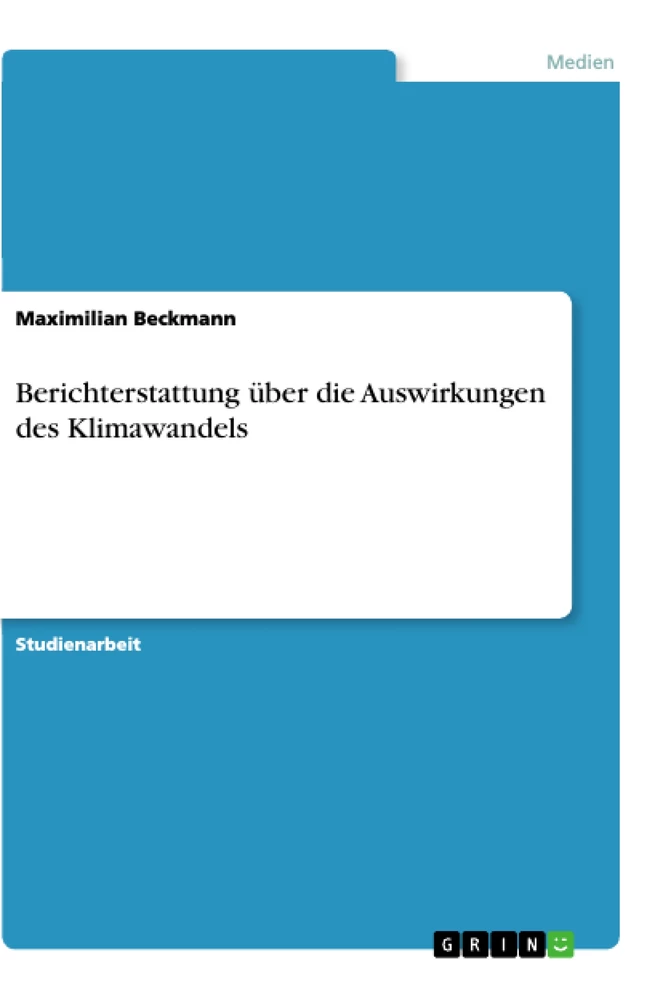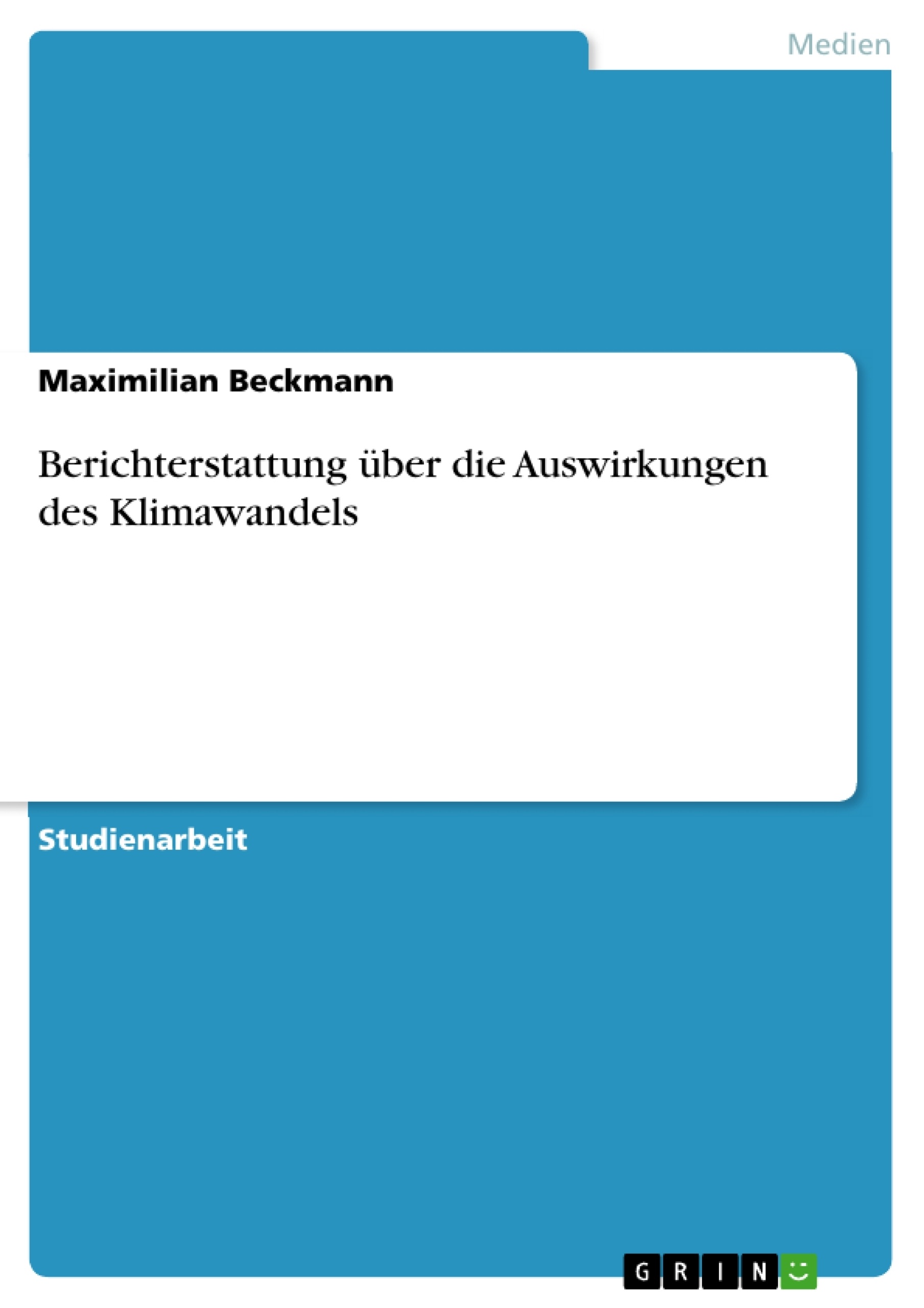Aufgrund der steigenden Nachfrage nach einer aussagekräftigen Klimaberichterstattung ist eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema geboten. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die derzeitige Ausgestaltung der Berichterstattung über negative Auswirkungen des Klimawandels in der EU hinsichtlich ihrer Entscheidungsnützlichkeit aus Sicht von Investoren kritisch zu analysieren.
Die Analyse soll auch darauf eingehen, ob die Leitlinien der EU-Kommission zu einer höheren Entscheidungsnützlichkeit führen. Zunächst werden mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf Unternehmen und mögliche inhaltliche Elemente einer Berichterstattung in Form der Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures und deren Integration in die zur Corporate Social Responsibility-Berichterstattung vorgestellt. Dann sollen in einer kritischen Analyse die aktuellen Problemfelder einer aussagekräftigen Klimaberichterstattung aufgezeigt und auch denkbare Lösungsansätze diskutiert werden. Abschließend soll neben einem Fazit ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der europäischen Klimaberichterstattung erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitun
2 Grundlagen der Anal
2.1 Auswirkungen des Klimawandels auf Unternehmen
2.2 Empfohlene Inhalte klimabezogener Berichterstattung
3 Analyse und kritische Würdigung der Problemfelder klimabezogener Berichterstatt
3.1 Analysekriterien entscheidungsnützlicher Berichterstattung
3.2 Problemfelder einer entscheidungsnützlichen Berichterstattung über die Auswirkungen des Klimawandels
3.2.1 Prognosefähigkeit der Auswirkungen des Klimawandels
3.2.2 Aussagekraft von klimabezogenen Leistungsindikatoren
3.2.3 Bedeutung des Klimawandels in der Risikoberichterstattung
3.2.4 Regulierung klimabezogener Berichterstattung in der EU
4 Fazit und Ausbl
Literaturverzeichnis
Rechtsquellen- und Normenverzeichn
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Das Phänomen des Klimawandels hat im Jahr 2019 erhebliche politische Beachtung erfahren. Agenden wie der geschlossene Green Deal der EU-Kommission und das damit verbundene Ziel, bis 2050 in der EU Klimaneutralität zu erreichen, belegen die politisch forcierte Vision einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsordnung.1 Neben Politik und Öffentlichkeit legenjedoch auch andere Informationsadressaten wie Investoren zunehmend Wert auf eine transparente und aussagekräftige klimabezogene Berichterstattung.2 Die Auswirkungen des Klimawandels werden als äußerst bedeutsames Risiko erachtet3 und finden somit vermehrt Eingang in Anlegerentscheidungen.4 Eine aktuell vielbeachtete Grundlage zur Berichterstattung über die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels stellen die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) dar, die v. a. den Informationsbedürfnissen von Investoren Rechnung tragen5 und bereits von vielen Parteien unterstützt werden.6 Gleichwohl besteht de lege lata noch keine EU-weite Verpflichtung zu einer Klimaberichterstattung. Im Bestreben, die Relevanz und Qualität klimabezogener Angaben in der nichtfinanziellen Berichterstattung zu erhöhen7, veröffentlichte die EU-Kommission im Juni 2019 unverbindliche Leitlinien, in denen sie vorschlägt, wie über die Auswirkungen des Klimawandels entsprechend den Anforderungen der CSR-Richtlinie berichtet werden kann. Diese Leitlinien übernehmen wesentliche Kernempfehlungen der TCFD.8 Mangels normativer Verbindlichkeit stellen sie allerdings kein finales Regelwerk dar.9 Darüber hinaus ist trotz umfangreicher Rahmenwerke noch immer eine weitreichende Heterogenität und ein Mangel an Aussagekraft in der Praxis der klimabezogenen Berichterstattung festzustellen.10 Aufgrund der steigenden Nachfrage nach einer aussagekräftigen Klimaberichterstattung ist eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema geboten. Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die derzeitige Ausgestaltung der Berichterstattung über negative Auswirkungen des Klimawandels in der EU hinsichtlich ihrer Entscheidungsnützlichkeit aus Sicht von Investoren kritisch zu analysieren. Die Analyse soll auch darauf eingehen, ob die o. g. Leitlinien der EU-Kommission zu einer höheren Entscheidungsnützlichkeit führen. Zunächst werden mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf Unternehmen und mögliche inhaltliche Elemente einer Berichterstattung in Form der Empfehlungen der TCFD und deren Integration in die o. g. Leitlinien zur CSR-Berichterstattung vorgestellt. Dann sollen in einer kritischen Analyse die aktuellen Problemfelder einer aussagekräftigen Klimaberichterstattung aufgezeigt und auch denkbare Lösungsansätze diskutiert werden. Abschließend soll neben einem Fazit ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der europäischen Klimaberichterstattung erfolgen.
2 Grundlagen der Analyse
2.1 Auswirkungen des Klimawandels aufUnternehmen
Einleitend soll ein kurzer Überblick darüber gewährt werden, inwieweit der Klimawandel negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens haben und damit eine Berichterstattung hierüber für Investoren relevant sein kann. Die TCFD unterscheidet in dieser Hinsicht zwischen sogenannten Übergangsrisiken („Transition Risks“) und physischen Risiken („Physical Risks“) des Klimawandels.11 Übergangsrisiken kennzeichnen mögliche mittelbare Auswirkungen des Klimawandels infolge des Übergangs zu einer karbonärmeren Gesellschaft. Diese Risiken können in folgenden Ausprägungen konkret Gestalt annehmen:
a) Politisch-rechtliche Risiken (z. B. höhere Kosten durch Strafzahlungen für Unternehmen, die gesetzliche Emissionsgrenzwerte überschreiten)
b) Technologische Risiken (z. B. Abschreibungsbedarf auf technische Anlagen bei Überalterung gegenüber neuen, CO2-ärmeren Technologien)
c) Marktrisiken (z. B. Umsatzeinbußen durch veränderte Kaufentscheidungen von Kunden hin zu klimaneutral hergestellten Produkten)
d) Reputationsrisiken (z. B. das Risiko, Stakeholder-Interessen zu verletzen, wenn eigene Geschäftspraktiken im Ruf stehen, klimaschädlich zu sein).
Physische Risiken stellen dagegen auf die unmittelbaren, d. h. physikalischen Folgen des Klimawandels ab. Diese kann man unterscheiden in:
a) Akute (physische) Risiken (z. B. Vermögensschäden durch akute Wetterextreme wie Sturmfluten, Hurrikans oder Dürren)
b) Chronische (physische) Risiken (z. B. Vermögensschäden durch langfristige globale Erwärmung, steigenden Meeresspiegel oder Ressourcenknappheit).
2.2 Empfohlene Inhalte klimabezogener Berichterstattung
Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Als Ausgangspunkt der Analyse klimabezogener Berichterstattung soll an dieser Stelle zunächst eine kurze Darstellung der TCFD und ihrer Kernempfehlungen erfolgen. Die TCFD wurde im Jahr 2015 vom Financial Stability Board (FSB) der G20 als Expertenkommission mit dem Ziel ins Leben gerufen, ein Rahmenwerk entscheidungsnützlicher klimabezogener Angaben zu entwerfen, um Kapitalmarktadressaten zu ermöglichen, materielle (Unternehmens-)Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel besser zu verstehen.12 Die 2017 veröffentlichten Final Recommendations der TCFD enthalten freiwillig anzuwendende Angaben zu den vier Kernbereichen der Governance, der Strategie (Darstellung tatsächlicher und potentieller Auswirkungen klimabezogener Chancen und Risiken), dem Risikomanagement (Prozesse zur Identifikation, Beurteilung und Handhabung von Klimarisiken) sowie den Kennzahlen und Zielen zur Beurteilung und Handhabung klimabezogener Chancen und Risiken.13 Im Besonderen schlägt die TCFD die Anwendung klimabezogener Szenarien vor, um die zukünftige Betroffenheit der Unternehmensstrategie von Auswirkungen des Klimawandels zu modellieren.14 Zugleich befürwortet die Task Force eine integrierte Berichterstattung, d. h. die zu machenden Angaben sollten möglichst im „mainstream report“ des Unternehmens mit der finanziellen Berichterstattung verknüpft werden.15 Eine detaillierte Darstellung der Empfehlungen der TCFD erfolgt im Rahmen dieser Arbeit aus Platzgründen nicht. Wie einleitend erwähnt, hat die EU-Kommission jedoch wesentliche TCFD-Emp- fehlungen in ihre Leitlinien zur nichtfinanziellen Berichterstattung übernommen. Insofern kann auf die folgenden Ausführungen verwiesen werden. Inwieweit sich diese Empfehlungen in das bestehende gesetzlich normierte Gerüst der nichtfinanziellen Erklärung einbetten, soll im Folgenden grob erläutert werden.
Zielsetzung und Hintergrund der nichtfinanziellen Berichterstattung Als Beweggrund für die Implementierung der CSR-Berichtspflicht galt v. a. ein Transparenzgewinn über die Nachhaltigkeit unternehmerischen Handels und dessen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.16 Kajüter identifiziert neben der Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen auch die Intention, durch die Offenlegungspflicht das Verhalten von Unternehmen hin zu nachhaltigem Wirtschaften zu steuern.17 Die Berichtspflicht nach der CSR-Richtlinie wurde mit dem CSR-RUG 2017 in deutsches Recht umgesetzt (§§ 289b-289e HGB), wonach auch bestimmte Unternehmen in Deutschland zur Aufstellung einer nichtfinanziellen Erklärung bzw. eines nichtfinanziellen Berichts verpflichtet sind.
Verknüpfung der gesetzlichen Anforderungen des CSR-RUG mit den unverbindlichen EU-Leitlinien zur klimabezogenen Berichterstattung Nun soll dargestellt werden, inwieweit die EU-Kommission eine klimabezogene Berichterstattung i. S. d. Leitlinien zur CSR-Richtlinie empfiehlt.
Gesetzlich vorgeschrieben ist i. S. d. § 289c HGB zunächst nur ein Mindestberichtserstattungsrahmen. Thematisch grenzt der § 289c Abs. 2 HGB fünf nichtfinanzielle Aspekte ein, über die die Gesellschaft regelmäßig mindestens zu berichten hat, darunter Umweltbelange gern. Nr. 1. Der Klimawandel als Teilaspekt der „Umweltbelange“ ist gesetzlich nicht normiert. Der deutsche Gesetzgeber hat die Bedeutung dieses Begriffs nur beispielhaft in einer nicht endlichen Aufstellung ausgeführt, u. a. nennt er hier Treibhausgasemissionen als möglichen Themenbereich der Berichterstattung. Gleichwohl subsumiert die EU-Kommission den Klimawandel in ihren Leitlinien unter die „Umweltbelange“ i. S. d. CSR-Richtlinie.18
Bei der Frage, welche Angaben (u. a.) zu Umweltbelangen zu machen sind, grenzt dies der § 289c Abs. 3 S. 1 HGB im Wege einer zweistufigen bzw. doppelten Wesentlichkeit auf Angaben ein, die sowohl für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses und der Lage des Unternehmens als auch für das Verständnis der Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf Umweltbelange erforderlich sind. Die h. M. im deutschen Schrifttum geht bei wortgetreuer Auslegung der Gesetzesnorm von einer kumulativen Definition der Wesentlichkeit aus, d. h. beide Perspektiven müssten gleichzeitig erfüllt sein, damit eine Angabe geboten ist.19 Entgegen des vorherrschenden Verständnisses dieser zweifachen Wesentlichkeitsperspektive in der nichtfinanziellen Berichterstattung decken die in den Leitlinien übernommenen empfohlenen Angaben der TCFD in erster Linie nur eine finanzielle Perspektive, also die Auswirkungen des Klimawandels auf das Unternehmen ab.20
Sodann verlangt das Gesetz neben einer Darstellung des Geschäftsmodells der Gesellschaft (§ 289c Abs. 1 HGB) nach § 289c Abs. 3 S. 2 HGB Einzelangaben zu den verfolgten Konzepten und Due-Diligence-Prozessen einschl. deren Ergebnissen (Nr. 1 und 2) und zu den wesentlichen Risiken aus der eigenen Geschäftstätigkeit und Geschäftsbeziehungen sowie den eigenen Produkten und Dienstleistungen (Nr. 3 und 4). Auch die bedeutsamsten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren (Nr. 5) sind anzugeben. Die EU-Kommission empfiehlt nun in ihren Leitlinien, den gesetzlichen Rahmen durch klimabezogene Angaben auszufüllen. Dabei werden u. a. wesentliche Empfehlungen der TCFD in die Einzelangaben integriert:
a) Geschäftsmodell:21 Unternehmen können die Auswirkungen klimabedingter Risiken und Chancen auf ihr Geschäftsmodell, ihre Strategie und ihre Finanzplanung darstellen. Die Anwendung von klimabezogenen Szenarioanalysen zur Prüfung der Resilienz des Geschäftsmodells gegenüber dem Klimawandel wird ebenfalls empfohlen.
b) Konzepte und Due-Diligence Prozesse:22 Unternehmen können ihre klimabezogenen Ziele, insbesondere für THG-Emissionen, sowie Konzepte zur Anpassung an den Klimawandel oder zum Klimaschutz offenlegen. Sie sollen weiterhin den Prozess der Identifikation und Bewertung klimabedingter Chancen und Risiken darstellen.
c) Ergebnisse:23 Unternehmen können die Ergebnisse ihrer klimabezogenen Konzepte sowie insbesondere ihre Zielerreichung (siehe b) darstellen.
d) Wesentliche Risiken und Handhabung dieser Risiken:24 die EU-Kommission hat klimabezogene Risiken u. a. über den Risikobegriff der TCFD (siehe voriger Abschnitt) typologisiert. Hierbei wird zwischen Risiken unterschieden, die sich in negativen Auswirkungen des Klimawandels auf das Unternehmen sowie in negativen Auswirkungen des Geschäftsbetriebs bzw. der Wertschöpfungskette auf das Klima äußern können. Für erstere Kategorie zieht die EU- Kommission die im vorigen Abschnitt erläuterten konkreten Risikodimensionen der Übergangsrisiken und physischen Risiken heran. Unternehmen sollen neben den eigentlichen Risiken des Klimawandels auch den Prozess zu ihrer Identifikation und Handhabung darstellen.
e) Wichtigste Leistungsindikatoren:25 in den Leitlinien wird zuletzt ein Katalog möglicher Indikatoren aufgeführt, die das Unternehmen im Einklang mit seiner Strategie und seinen klimabezogenen Risiken offenlegen kann. Darunter befinden sich u. a. verursachte THG-Emissionen, der Energieverbrauch sowie eine Buchwertquote von durch physische Risiken des Klimawandels gefährdeten Sachgütern des Unternehmens.
3 Analyse und kritische Würdigung der Problemfelder klimabezogener Berichterstattung
3.1 Analysekriterien entscheidungsnützlicher Berichterstattung
Zur Beurteilung, wie entscheidungsnützlich Klimaangaben aus Sicht von Investoren sind, ist zunächst geboten, einen Rahmen geeigneter Gütekriterien zu definieren. Hilfsweise möglich wäre hier ein Rückgriff auf das Zwecksystem der IFRS- Rechnungslegung, deren Ziel in der Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen besteht. Für die reine Analyse von Inhalten klimabezogener Berichterstattung erscheint ein Rückgriff auf das Zwecksystem der IFRS insoweit sachgerecht, als dass etwa die TCFD im Rahmen ihrer Final Recommendations selbst Grundsätze effektiver Berichterstattung festgesetzt hat, die inhaltlich deutliche Parallelen zu den nachfolgend dargestellten Gütekriterien des IFRS-Zwecksystems aufweisen.26
Maßgeblich sind nach den IFRS für die Entscheidungsnützlichkeit die Informationsbedürfnisse der Adressaten der Rechnungslegung, zu denen v. a. tatsächliche und potentielle Investoren, Kreditgeber und andere Gläubiger zählen.27 Abschlussinformationen sollen eine realitätsgetreue Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bezwecken und dem Adressaten ermöglichen, die Fähigkeit des Unternehmens abzuschätzen, zukünftige Einzahlungsüberschüsse zu erwirtschaften.28 Wie nützlich Informationen sind, wird am Maßstab sogenannter Fundamental- und Erweiterungsgrundsätze bemessen.29 Die Fundamentalgrundsätze bestimmen die grundlegende Entscheidungsnützlichkeit von Informationen. Zu unterscheiden sind die Grundsätze der Relevanz und der glaubwürdigen Darstellung. Abschlussinformationen gelten als relevant, wenn sie dazu in der Lage sind, die Entscheidung eines Adressaten zu beeinflussen. Konkret wird die Relevanz einer Information an ihrer Vorhersage- und ihrer Bestätigungskraft gemessen. Ergänzt wird der Grundsatz der Relevanz wird durch den Grundsatz der glaubwürdigen Darstellung. Dieser Grundsatz wird dann als erfüllt angesehen, wenn die Informationen vollständig, neutral sowie fehlerfrei dargestellt werden.
Neben den Fundamentalgrundsätzen sollen die vier Erweiterungsgrundsätze einen möglichst hohen Nutzen der Abschlussinformationen sicherstellen. Die Vergleichbarkeit von Abschlussinformation soll es dem Adressaten ermöglichen, diese sowohl im Zeitablauf als auch mit den Abschlüssen anderer Unternehmen vergleichen zu können. Das Kriterium der Nachprüfbarkeit fordert, dass externe, fachkundige Betrachter Einigkeit darüber erzielen können, dass die Darstellung einer Abschlussinformation glaubwürdig ist. Weiterhin stellt der Grundsatz der Zeitnähe auf den sinkenden Nutzen von Informationen ab,je mehr Zeit zwischen der Entstehung eines Sachverhalts und der darauf bezogenen Berichterstattung vergeht, während der Grundsatz der Verständlichkeit verlangt, Abschlussinformationen in einer klaren, präzisen und für den fachkundigen Leser begreifbaren Art und Weise darzustellen.
3.2 Problemfelder einer entscheidungsnützlichen Berichterstattung über die Auswirkungen des Klimawandels
Nun sollen Limitationen der Entscheidungsnützlichkeit in der gegenwärtigen klimabezogenen Berichterstattung kritisch analysiert werden. Dabei sollen zunächst inhärente Herausforderungen einer aussagekräftigen Klimaberichterstattung aufgrund des Wesens des Klimawandels und seiner Folgen analysiert werden. Dann wird der Fokus auf spezifischere Problemfelder in der gegenwärtigen Berichtspraxis gelenkt. Zuletzt erfolgt eine explizite kritische Würdigung der zuvor vorgestellten klimabezogenen Leitlinien der EU-Kommission.
3.2.1 Prognosefähigkeit der Auswirkungen des Klimawandels
Eine der größten Herausforderungen entscheidungsnützlicher Berichterstattung über Auswirkungen des Klimawandels dürfte zunächst darin bestehen, dass der Klimawandel komplexe und v. a. noch in der Zukunft liegende Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft besitzt. Akute physische Schäden durch Wetterextreme erreichen einerseits schon heutzutage eine signifikante Größenordnung30, sind aber andererseits recht schwierig vorherzusagen.31 Selbst vergleichsweise berechenbare Übergangsrisiken durch Politikmaßnahmen (wie z. B. durch eine mögliche zukünftige CO2-Besteuerung) bergen Ungewissheit für Unternehmen. Doch auch in fernerer Zukunft liegende (chronische) physische Risiken des Klimawandels werden von langfristig orientierten Investoren bereits in Entscheidungen berücksichtigt.32 Zugleich sind aber besonders diese langfristigen Auswirkungen für ein Unternehmen möglicherweise schwierig zu beziffern. Wenn der Klimawandel bspw. in den nächsten Jahrzehnten zu einem graduellen Anstieg der Temperaturen führt, ist nicht unmittelbar ersichtlich, welche Folgen sich für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage konkret ergeben könnten.
Die der EFRAG anhängige Arbeitsgruppe der European Lab Project Task Force on Climate-related Reporting (PTF-CRR) stellt in einer empirischen Untersuchung zum Stand der Klimaberichterstattung in der EU fest, dass viele Unternehmen ihren Planungshorizont für ein aussagekräftiges Klima-Reporting deutlich stärker ausweiten müssen, da die Langfristigkeit des Klimawandels und seiner Auswirkungen die üblichen Zeiträume der Unternehmensplanung überschreitet.33 Empirisch ist z. B. für Deutschland festzustellen, dass der Zeithorizont der umweltbezogenen Berichterstattung des DAX 30 nach dem CSR-RUG nur selten einen Zeitraum von fünf Jahren überschreitet.34 Daraus kann mitunter geschlossen werden, dass besonders die langfristige Natur des Klimawandels bislang wenig Beachtung findet und über damit verbundene Ziele und Konzepte überwiegend mittelfristig berichtet wird. Diese Problematik schwächt die Relevanz der Angaben über Auswirkungen des Klimawandels mitunter besonders für institutionelle Investoren ein, die einen durchaus langfristigen Zeithorizont für ihre Anlageentscheidungen zugrunde legen. Ein rege diskutierter und vielfach unterstützter35 Lösungsansatz, um die Unsicherheit der Auswirkungen des Klimawandels „beherrschbarer“ zu machen, besteht darin, über die schon erwähnten klimabezogenen Szenarioanalysen mögliche Zukunftsszenarien mit deren erwarteten Folgen für das Unternehmen zu verknüpfen. Derartige Analysen können sowohl Übergangsrisiken als auch physische Risiken des Klimawandels abbilden: vertreten wird z. B. eine Darstellung der Effekte der globalen Erwärmung auf das Geschäftsmodell von Unternehmen in Abhängigkeit verschiedener prognostizierter Temperaturanstiege.36 Auch die EU-Kommission empfiehlt - wie im Grundlagenteil gezeigt - die Aufnahme derartiger Analysen in die Berichterstattung. Eine solche Methodik kann die Relevanz der klimabezogenen Berichterstattung mitunter erhöhen, indem sie die Betroffenheit eines Unternehmens durch zukünftige Auswirkungen des Klimawandels modelliert. Andererseits geht auch sie mit erheblichen praktischen Herausforderungen einher.
Verlässlichkeit -von Datenfür die Durchführung -von Szenarioanalysen Zunächst bedarf es verlässlicher Daten zur Aufstellung einer klimabezogenen Szenarioanalyse, die in der Praxisjedoch nicht immer unmittelbar verfügbar sind und im Reporting auch nicht immer vollständig offengelegt werden.37 Sowohl für die Abbildung von Übergangsrisiken als auch physischen Risiken unterliegen zukunftsorientierte Daten zudem weiterhin erheblicher Unsicherheit. Übergangsrisiken hängen u. a. besonders mit einer konkreten regulatorischen Antwort auf den Klimawandel zusammen, z. B. in Form einer möglichen zukünftigen CO2-Steuer.38 Auch wenn ein allgemeiner Trend zu einer strikteren Klimapolitik besteht, können Art und Zeitpunkt von Politikmaßnahmenjedoch nicht exakt hervorgesagt werden. Dadurch gestaltet es sich schwierig, präzise Implikationen auf das Unternehmen abzuleiten, zumal Unternehmen dann u. U. individuelle und zueinander inkonsistente Annahmen treffen müssen. Bei chronischen physischen Risiken mag diese Problematik zusätzlich verschärft sein, da - wie oben gezeigt - der Planungshorizont vieler Unternehmen nicht dem von langfristigen Klimamodellen entspricht. Somit sind derartige Analysen grundsätzlich ermessensbehaftet, da sie notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen beruhen.39 Aus Sicht eines Investors kann dies die Relevanz, die glaubwürdige Darstellung (Objektivität) und auch die Vergleichbarkeit der Informationen erheblich beeinträchtigen.
Herstellung einer Kausalität zwischen klimabezogenen Szenarien und Auswirkungen des Klimawandels auf das Unternehmen
Als besonders herausfordernd kann dabei zudem die Herstellung einer Kausalität zwischen den erwarteten Klimaveränderungen und den wirtschaftlichen Folgen für das Unternehmen angesehen werden. Zunächst untersuchen viele klimabezogene Prognosemodelle die Auswirkungen des Klimawandels eher aus einer makroökonomischen, globalen Perspektive, was es deutlich erschweren kann, daraus exakte Auswirkungen auf ein individuelles Unternehmen abzuleiten.40 Darüber hinaus erfordert die Herstellung einer möglichst aussagekräftigen Kausalität enormes Ermessen des Anwenders: will ein Unternehmen in einer quantitativen Szenarioanalyse die zukünftigen monetären Folgen des Klimawandels beziffern, muss es Annahmen über Umsatzeinbußen, Mehrkosten und Vermögensschäden treffen41 und die Ergebnisse der Analyse auf zukünftige strategische Entscheidungen übertragen.42 Zum einen erhöht dies die Unsicherheit in der Planung, zum anderen birgt es u. U. die Gefahr einer bewussten Parametrisierung von Prognosen, um die Folgen auf das Unternehmen möglicherweise positiver darzustellen. Besonders herausfordernd stellt sich auch der Umstand dar, dass Übergangsrisiken und physische Risiken in einer wechselseitigen Beziehung stehen und für eine vollständige Abschätzung der zukünftigen Betroffenheit eines Unternehmens beide Risikogruppen gleichermaßen berücksichtigt werden müssen.43 Gleichwohl dominieren in der europäischen Berichtspraxis bislang überwiegend Analysen, die v. a. die Auswirkungen von Übergangsrisiken untersuchen.44 Die genannten Punkte könnten die Relevanz, die glaubwürdige Darstellung (Neutralität und Objektivität) und die Vergleichbarkeit für den Investor abermals erheblich einschränken. Komplexere Analysen mit vielen Annahmen könnten überdies die Verständlichkeit für den externen Betrachter beeinträchtigen. Zudem ist die Nachprüfbarkeit solcher Analysen fragwürdig. Aus der Praxis ist letztlich zu erkennen, dass klimabezogene Szenarien im Reporting europäischer Unternehmen noch wenig Verbreitung finden.45 Die PTF-CRR konkludiert, dass Szenarioanalysen zwar ein sinnvolles Instrument zur Klimaberichterstattung darstellen, sie aber aufgrund ihrer Komplexität und der bislang geringen Anwendererfahrung oft noch nicht hinreichend aussagekräftig sind.46
3.2.2 Aussagekraft von klimabezogenen Leistungsindikatoren
Eine weitere Einschränkung der Entscheidungsnützlichkeit für Investoren besteht möglicherweise darin, dass nichtfinanzielle Leistungsindikatoren im Zusammenhang mit dem Klimawandel auch inhaltlich i. S. ihrer Messbarkeit und Aussagekraft Probleme aufwerfen können.
Wie eingangs erläutert, besteht keine explizite Verpflichtung nach der CSR-Richt- linie, bestimmte klimabezogene Leistungsindikatoren offenzulegen. Nichtsdestotrotz wird gegenwärtig auch ohne gesetzliche Verpflichtung fast durchgehend über Treibhausgasemissionen berichtet.47 Obgleich die Angabe von Emissionen zunächst nur eine Auswirkung des Unternehmens auf das Klima und nicht umgekehrt abdeckt, kommt der CO2-Bilanz des Unternehmens im Lichte der Übergangsrisiken doch mittelbar eine finanzielle Bedeutung zu: so werden v. a. infolge restriktiverer Regulierungen Unternehmen mit einem großen Carbon Footprint in Zukunft stärker ihr Geschäftsmodell überdenken müssen und zusätzlichen Kostenfaktoren ausgesetzt sein.48 In der Berichterstattung stellt sich in Bezug auf Emissionen die Frage, wie entsprechende Indikatoren sinnvoll abgegrenzt werden können. Die CSR-Berichterstattung fordert einen recht holistischen Ansatz ein: Unternehmen sollen bei nichtfinanziellen Angaben möglichst auch ihre Lieferkette berücksichtigen.49 Das schließt im Fall von Treibhausgasen neben selbst verursachten Emissionen auch solche ein, die bei Zulieferern und Kunden anfallen.50 Allerdings sind gerade diese Informationen oft schwierig zu beschaffen. Emissionen der Zulieferer werden u. U. nicht oder nicht nach den gleichen Standards wie beim berichtenden Unternehmen erfasst51, zumal keine gesetzliche Verpflichtung zur Angabe an das Berichtsunternehmen besteht.52 Die Emissionslast bei Nutzung der Produkte durch Kunden muss dagegen oft durch Hochrechnungen ermittelt werden. So hängen bspw. die Emissionen eines PKW auch von der Nutzung durch den Fahrer ab, für die ein Automobilkonzern Annahmen treffen muss.53 In der Berichtspraxis ist festzustellen, dass viele Unternehmen den Carbon Footprint ihrer Wertschöpfungskette nicht quantifizieren, also die Emissionen ihrer Zulieferer und Kunden nicht konkret beziffern.54 Die damit verbundene Schwierigkeit, ein vollständiges Bild über die CO2-Bilanz eines Unternehmens zu gewinnen, kann die glaubwürdige Darstellung und die Vergleichbarkeit aus Sicht eines Investors einschränken. Selbst unter der Angabe vollständiger Emissionsangaben ist fraglich, inwieweit ein Adressat solche Indikatoren in der klimabezogenen Berichterstattung konkret in seine Entscheidungen einbeziehen kann. Niehues/Dutzi/Schwoy haben im Falle der freiwilligen CO2-Berichterstattung über Expertenbefragungen untersucht, wie gut sich Emissionsangaben dazu eignen, die CO2-Effizienz eines Unternehmens zu beurteilen. Dabei stellt sich heraus, dass infolge einer Vielzahl spezifischer Berichtsstandards sowie unterschiedlicher Wertschöpfungstiefen die angegebenen Emissionen oftmals die Umweltleistung des Unternehmens nicht vergleichbar widerspiegeln.55
Die PTF-CRR bemängelt zudem, dass Indikatoren wie Emissionen zwar häufig angegeben werden, sie allerdings oft nicht im Zusammenhang mit einem Ziel oder Konzept bzw. den damit verbundenen klimabezogenen Risiken stehen.56 Ein Investor könnte aus den o. g. Gründen Schwierigkeiten haben, aus einer isolierten, vergangenheitsorientierten Angabe von Emissionen ohne Verknüpfung mit den dazugehörigen Zielen und Maßnahmen im Lichte politischer Ziele (z. B. denen des Pariser Klimaschutzabkommens) und zukünftiger Übergangsrisiken Rückschlüsse auf die Risikoposition eines Unternehmens zu ziehen, was die Relevanz der Berichterstattung vermindert. Indikatoren, die unmittelbar die physischen Risiken des Klimawandels abbilden sollen, denen ein Unternehmen ausgesetzt ist, erweisen sich in ihrer Darstellung als ähnlich problembehaftet. Die EU-Kommission schlägt in ihren Leitlinien z. B. den Anteil der durch physische Klimarisiken bedrohten Sachgüter an der Bilanzsumme vor.57 Solche Angaben bergen erheblichen Definitions- bzw. Interpretationsspielraum. Dies kann einer vergleichbaren und auch neutralen Berichterstattung abträglich sein.
3.2.3 Bedeutung des Klimawandels in der Risikoberichterstattung
Wie einleitend erwähnt, stellt der Klimawandel ein erhebliches finanzielles Risiko dar. So erklärt das Weltwirtschaftsforum in seinem Global Risks Report 2020 klimabezogene Veränderungen zum größten weltweiten Risiko in Bezug auf Eintrittswahrscheinlichkeit und Ausmaß.58 Nichtsdestotrotz zeigt ein Blick in die bisherige Praxis, dass mit dem Klimawandel verbundene Risiken noch nicht flächendeckend in der Berichterstattung behandelt werden: eine im Mai 2020 erschienene empirische Analyse des Climate Disclosure Standards Board (CDSB), die untersucht, inwieweit die größten 50 Unternehmen in der EU die klimabezogenen CSR-Leitlinien und die TCFD-Empfehlungen erfüllen, stellt fest, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf das Geschäftsmodell und die damit verbundenen Risiken noch unzureichend von Unternehmen in der EU offengelegt werden. Während nur 30% der betrachteten Unternehmen präzise Aussagen darüber machen, wie der Klimawandel ihr Geschäftsmodell beeinflusst, berichten nur 54% sowohl über Übergangsrisiken als auch über physische Risiken und nur 6% unterteilen diese Risiken zusätzlich nach ihrem Zeithorizont.59 Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt die PTF- CRR in ihrer im Februar 2020 veröffentlichten Analyse zur europäischen Klimaberichterstattung.60
Kritik wird auch daran geübt, dass angegebene Risiken tendenziell generisch und unspezifisch bleiben sowie selten quantifiziert werden.61 Zudem sei die Risikoberichterstattung noch sehr von einer klassischen Nachhaltigkeitsperspektive geprägt, wie Unternehmen negativ auf die Umwelt wirken, während die strategischen Risiken des Klimawandels auf das Unternehmen zu kurz kommen.62 Aus Sicht der Berichtsadressaten mindert dies letztlich die Entscheidungsnützlichkeit: Anleger erhalten aus der klimabezogenen Risikoberichterstattung bislang noch nicht durchgehend relevante und vergleichbare Informationen.
3.2.4 Regulierung klimabezogener Berichterstattung in der EU
Bereits in der Einleitung und im Grundlagenteil wurde mehrfach auf den Umstand verwiesen, dass eine gesetzlich verpflichtende EU-weite Klimaberichterstattung noch nicht besteht. Die EU-Kommission hat lediglich die im Grundlagenteil vorgestellten unverbindlichen Leitlinien zur Klimaberichterstattung festgesetzt. Führen diese dennoch zu einer Verbesserung der Berichterstattung? Im Positiven ist anzumerken, dass wesentliche TCFD-Empfehlungen durch Integration in die EU-Leitlinien i. S. eines „Soft Law“ zu einer stärkeren Beachtung in der Unternehmenspraxis führen könnten. Möglicherweise bilden die Empfehlungen vor dem Hintergrund des European Green Deal auch die Vorstufe zu einer zukünftig verpflichtenden Anwendung.63 Aus Sicht von Investoren wären verbindlichere Normen mitunter zu begrüßen: würden z. B. nach sorgfältiger Abwägung einige der in den Leitlinien übernommenen Empfehlungen der TCFD auf das Niveau rechtsverbindlicher Vorgaben erhöht64 oder eine „Apply-or-explain“-Regelung geschaffen, könnte dies sowohl die inhaltliche Aussagekraft (Relevanz) als auch die Vergleichbarkeit klimawandelbezogener Berichterstattung für Investoren steigern.
Andererseits sahen sich die konkreten Empfehlungen der EU-Kommission auch deutlicher Kritik ausgesetzt.65 Das DRSC bemängelt insbesondere, dass die Leitlinien den gesetzlichen Rahmen der CSR-Richtlinie stark überspannen und zudem deren Zielsetzung zuwiderlaufen, auch die Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt, nicht aber nur die Auswirkungen des Klimawandels auf das Unternehmen abzubilden, wie esjedoch Primärziel der TCFD-Empfehlungen ist.66 Dies gefährde letztlich die europaweite Akzeptanz der Leitlinien in der Unternehmenspraxis. Im Hinblick auf die vorgenannten Problemfelder der Klimaberichterstattung (insbesondere die Anwendung von Klimaszenarien) erscheinen die Leitlinien als intendierte Anwendungshilfe auch zu knapp und können Unternehmen im Vergleich zu den ohnehin schon bestehenden TCFD-Empfehlungen keinen echten Mehrwert bieten, ihre Betroffenheit vom Klimawandel aussagekräftig zu artikulieren. Eine Verbesserung der Berichtsqualität durch die Leitlinien ist deshalb - besonders aufgrund ihrer freiwilligen Anwendung - eher in Frage zu stellen.
4 Fazit und Ausblick
Abschließend ist der Hergang der vorliegenden Arbeit zusammenzufassen. Ausgehend von der Frage der Entscheidungsnützlichkeit der Berichterstattung über die Auswirkungen des Klimawandels wurde zunächst aufgezeigt, welchen klimabezogenen Risiken Unternehmen ausgesetzt sein können. Danach erfolgte eine kurze Darstellung empfohlener klimabezogener Berichtselemente der TCFD sowie deren möglicher Integration in die nichtfinanzielle Erklärung. Ergänzt wurde diese Darstellung durch einen Analyserahmen von Gütekriterien entscheidungsnützlicher Informationen. Vor diesem Hintergrund analysiert die Arbeit vier Problembereiche in der klimabezogenen Berichterstattung: der Klimawandel als komplexes und zukunftsbezogenes Phänomen birgt zunächst die Schwierigkeit, dass dessen Auswirkungen auf Unternehmen nur begrenzt prognostiziert werden können. Eine Erhöhung der Relevanz der Klimaberichterstattung durch den Einsatz von Szenarioanalysen wird zwar empfohlen, beinhaltet allerdings praktische Herausforderungen, da diese komplex sowie ermessensbehaftet sind und sich die Berichtspraxis in ihrer Anwendung noch in der Implementierungsphase befindet. Auch die Messbarkeit der klimabezogenen „Leistung“ von Unternehmen unterliegt gewissen Schwierigkeiten in Bezug auf die Datenbeschaffung und die letztliche Aussagekraft für den Adressaten. Zudem werden die finanziellen Risiken des Klimawandels für Unternehmen bislang noch nicht flächendeckend und eher vage berichtet. Ob die empfohlene Integration klimabezogener Angaben in die CSR-Berichterstattung die Entscheidungsnützlichkeit erhöht, ist eher fragwürdig: die in 2019 verlautbarten Leitlinien der EU-Kommission zur klimabezogenen Berichterstattung dürften nur eine begrenzte Verbesserung der Situation bewirken, da sie einerseits zwar die Relevanz des Klimawandels in der Berichtspraxis unterstreichen, sie als unverbindliche Empfehlungen andererseits aber keinen Normencharakter entfalten können und möglicherweise auch inhaltlich im Widerspruch zum geltenden gesetzlichen Rahmen der CSR-Richtlinie stehen. Bislang erfüllt die klimabezogene Berichterstattung in der EU damit die Informationsbedürfnisse von Kapitalgebern sicher noch nicht vollständig. Ein Ausblick ist u. a. auf die Regulierungsbemühungen der EU-Kommission zu richten, die seit Anfang 2020 Stellungnahmen zu einer möglichen Überarbeitung der CSR-Richtlinie einholt. Ob dies letztlich - wie teilweise befürwortet - zu einer verbindlichen Integration der TCFD-Empfehlungen in die europäische CSR-Richtlinie führen wird, ist mit Spannung zu erwarten.
Literaturverzeichnis
Alliance for Corporate Transparency (2020): 2019 Research Report - An analysis of the sustainability reports of 1000 companies pursuant to the EU NonFinancial Reporting Directive, URL: https://www.allianceforcorpo- ratetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alli- ance_for_Corporate_Transparencv- 7d9802a0cl8c9fl3017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48blc 7.pdf (26.06.2020).
Aviva Group pic (2018): Aviva’s Climate-Related Financial Disclosure 2018, URL: https://www.aviva.com/social-purpose/climate-related-financial-dis- closure/ (30.06.2020).
Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2016): Bilanzen, 14. Aufl., Düsseldorf2016.
Barckow, A. (2019): Prima Klima oder dicke Luft - was unverbindliche Leitlinien der Europäischen Kommission an Überraschungen für die Unternehmensberichterstattung bergen, in: Betriebs-Berater, 74. Jg., Heft31, 2019, S. 1.
BMW Group (2020): Sustainable Value Report 2019, URL: https://www.bmw- group.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibil- ity/downloads/de/2020/2020-BMW-Group-SVR-2019-Deutsch.pdf (26.06.2020).
Boecker, C./Zwirner, C. (2019): Nichtfinanzielle Berichterstattung nach dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, in: IRZ - Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung, 14. Jg., Heft 6, 2019, S. 233-237.
Carbon Disclosure Project (2020): CDP Europe’s response to the public consultation on the revision of the Non-Financial Reporting Directive, URL: https://6fefcbb86e61aflb2fc4- c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcddld.ssl.cf3.rack- cdn.com/comfy/cms/files/files/000/003/518/original/2020-05-08_EU-AN- NEX-to-CDP-response-NFRD-revision.pdf (26.06.2020).
Climate Action 100+ (2019): 2019 Progress Report, URL: http://www.climate- actionlOO.org (26.06.2020).
Climate Disclosure Standards Board (2020a): Falling short? Why environmental and climate-related disclosures under the EU Non-Financial Reporting Directive must improve, URL: https://www.cdsb.net/sites/default/files/fall- ing_short_report_double_page_spread.pdf (26.06.2020).
Climate Disclosure Standards Board (2020b): CDSB response to Inception Impact Assessment on the Revision of the Non-Financial Reporting Directive, URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initia- tives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/F506687 (26.06.2020).
Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2016): Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse. Betriebswirtschaftliche, handelsrechtliche, steuerrechtliche und internationale Grundlagen - HGB, IAS/IFRS, US-GAAP, DRS, 24. Auf!., Stuttgart2016.
Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (2019): Stellungnahme des DRSC vom 14. März 2019 zum Entwurf der Europäischen Kommission „Consultation document on the update of the guidelines on non-financial reporting“, URL: https://www.drsc.de/app/up- loads/2019/03/190314_ASCG_CL_EU_NBGL.pdf (26.06.2020).
European Financial Reporting Advisory Group (2020a): How to improve climate-related reporting - a summary of good practices from Europe and beyond, URL: http://www.efrag.org/Assets/Download7as- setUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/European%20Lab%20PTF- CRR%20%28Main%20Report%29,pdf (26.06.2020).
European Financial Reporting Advisory Group (2020b): How to improve climate-related reporting - a summary of good practices from Europe and beyond - Supplement 2: Scenario Analysis Practices, URL: http://www.ef- rag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Euro- pean%20Lab%20PTF-CRR%20%28Supplement%202%29.pdf (26.06.2020).
Europäische Kommission (2019): Mitteilung der Kommission - Der europäische Grüne Deal, (COM/2019/640 final), URL: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640 (26.06.2020).
Europäische Kommission (2019): Leitlinien für die Berichterstattung über nichtfinanzielle Informationen: Nachtrag zur klimabezogenen Berichterstattung, (2019/C209/01), URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-con- tentZDE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN (30.06.2020).
Europäische Kommission (2020): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1999 (Europäisches Klimagesetz), (COM/2020/80 final), URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-con- tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN (26.06.2020).
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (2017): IDW Positionspapier: Pflichten und Zweifelsfragen zur nichtfmanziellen Erklärung als Bestandteil der Unternehmensführung, URL: https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/idw- positionspapier-zur-nichtfmanziellen-erklaerung/101500 (26.06.2020).
The Institutional Investors Group on Climate Change (2020): Consultation Document - Review of the Non-Financial Reporting Directive, URL: https://www.iigcc.org/download/iigcc-response-to-the-renewed-sustaina- ble-finance-consultation-paper/?wpdmdl=3494&re- fresh=5ef5fae04d2441593178848 (26.06.2020).
The Institutional Investors Group on Climate Change (2018): 2018 Global Investor Statement to Governments on Climate Change, URL: https://www.iigcc.org/download/global-investor-statement-to-govern- ments-on-climate-change/?wpdmdl=1826&re- fresh=5efb4c5aa70001593527386 (30.06.2020).
Kajüter, P. (2017): Nichtfinanzielle Berichterstattung nach dem CSR-Richtlinie- Umsetzungsgesetz, in: DerBetrieb, 70. Jg., Heft 12, 2017, S. 617-624.
Kirchhoff Consult AG/BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2020): Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz im DAX 30 - Die praktische Ausgestaltung der nichtfinanziellen Berichtspflicht - Fokusthema Umwelt, URL: https://www.bdo.de/de-de/insights-de/weitere-veroffentlichungen/stu- dien/studie-zur-gesetzlichen-nichtfmanziellen-berichterstattung-der-dax- 30-untemehmen (26.06.2020).
Löw, P. (2019): The natural disasters of2018 in figures, URL: https://www.muni- chre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/natural- disasters/the-natural-disasters-of-2018-in-figures.html (26.06.2020).
Marsh & McLennan Companies (2018): Reporting Climate Resilience: The Challenges ahead, URL: https://www.oliverwyman.com/con- tent/dam/mmc-web/Global-Risk-Center/Files/reporting-climate-resili- ence.pdf (26.06.20201.
Mercer LLC (2019): Investing in a Time of Climate Change - The Sequel 2019, URL: https://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/insights/publica- tions/2019/apr/FINAL_Investing-in-a-Time-of-Climate-Change-2019- Full-Report.pdf (26.06.20201.
Network for Greening the Financial System (2019): A call for action - Climate change as a source of financial risk, URL: https://www.ngfs.net/sites/de- fault/files/medias/documents/ngfs_first_comprehensive_report_- _17042019_0.pdf (26.06.2020).
Niehues, N. A./Dutzi, A./Schwoy, S. (2018): Aussagekraft der C02-Berichterstat- tung als Element der nichtfmanziellen Erklärung, in: Der Konzern, 16. Jg., Heft7, 2018, S. 296-304.
Pellens, B./Fülbier, R. U./Gassen, J./Sellhorn, T. (2017): Internationale Rechnungslegung, 10. Aufl., Stuttgart2017.
Schäfer, N./Schönberger, M. W. (2020): Green and more: Klimaberichterstattung mit Luft nach oben, in: Die Wirtschaftsprüfung (WPg), 73. Jg., Heft 10, 2020, S. 549-551.
Sopp, K./Baumüller, J. (2019): Nichtfinanzielle Berichterstattung: Kritik an den Leitlinien zu klimabezogenen Angaben, in: Der Betrieb, 72. Jg., Heft 33, 2019, S. 1801-1809.
Speich, I. (2020): Ein Plädoyer für mehr Klimaberichterstattung - Anmerkungen aus der Sicht des Kapitalmarkts, in: Die Wirtschaftsprüfung (WPg), 73. Jg., Heftö, 2020, S. 341-345.
Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung (2020): Zwischenbericht - die Bedeutung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft für die große Transformation, URL: https://sustainable-fmance-beirat.de/wp-content/uplo- ads/2020/03/200306_SFB-Zwischenbericht_DE.pdf (26.06.2020).
Symon, C. (2013): Climate Change: action, trends and implications for business, URL: https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transfor- mation/ipcc-climate-science-business-briefings/pdfs/briefings/Science_Re- port__Briefing _WEB_EN.pdf (26.06.2020).
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2019): 2019 Status Report, URL: https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2Q19- TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdf (26.06.2020).
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2017a): Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures - Final Report, URL: https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FI- NAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf (26.06.2020).
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2017b): The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities - Technical Supplement, URL: https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/up- loads/2017/06/FINAL-TCFD-Technical-Supplement-062917.pdf (26.06.2020).
United Nations Environment Programme Finance Initiative/Oliver Wyman (2018): Extending our horizons - Assessing credit risk and opportunity in a changing climate: Outputs of a working group of 16 banks piloting the TCFD Recommendations, URL: https://www.unepfi.org/wordpress/wp- content/uploads/2018/04/EXTENDING-OUR-HORIZQNS.pdf (26.06.2020).
Veite, P./Stawinoga, M. (2019): Wird die nichtfinanzielle Berichterstattung durch die neuen EU-Leitlinien zu klimabezogenen Angaben entscheidungsnützlicher?, in: Die Wirtschaftsprüfung (WPg), 72. Jg., Heft 16, 2019, S. 879-885.
Volkswagen AG (2020): Nachhaltigkeitsbericht 2019, URL: https://www.volks- wagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/sustainability-re- port/2019/Nichtfmanzieller_Bericht_2019_d.pdf (26.06.2020).
World Economic Forum (2020): The Global Risks Report 2020, URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf (26.06.2020).
Rechtsquellen- und Normenverzeichnis
CSR-Richtlinie: Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen, vom 22.10.2014, in: Amtsblatt der Europäischen Union vom 15.11.2014, L 330/1.
HGB: Handelsgesetzbuch vom 10.05.1897 (RGBl., S. 219) mit allen späteren Änderungen, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2019, in: BGBl. I, S. 2637.
[...]
1 Vgl. COM (2019) 640 final, S. 2 ff., COM (2020) 80 final, Art. 2.
2 Vgl. TCFD (2019), S. 2-3.
3 Vgl. WEF (2020), S. 2-3; NGFS (2019), S. 11-17.
4 Vgl. IIGCC (2018), S. 1-2; Mercer (2019), S. 12-17; Climate Action 100+ (2019), S. 8-13.
5 Vgl. TCFD (2017a), S. 9.
6 Vgl. TCFD (2019), S. 6.
7 Vgl. AB1.C209 (2019), S. 2.
8 Vgl. ABI. C 209 (2019), S. 2, 4.
9 Vgl. AB1.C209 (2019), S. 3.
10 Vgl. CDSB (2020a), S. 1-2, 26-27; ACT (2020), S. 5, 16-17, 42-48; EFRAG (2020a), S. 6-9; Schäfer/Schönberger (2020), S. 550-551.
11 Die hier genannten sowie folgenden Ausführungen des Abschnitts 2.1 wurden i. W. übernommen aus TCFD (2017a), S. 5-9 und ABI. C 209 (2019), S. 6.
12 Vgl. TCFD (2017a), S. 4.
13 Vgl. TCFD (2017a), S. 5-6.
14 Vgl. TCFD (2017a), S. 6.
15 Vgl. TCFD (2017a), S. 5.
16 Vgl. ABl.L330(2014), S. 1.
17 Vgl. Kajüter (2017), S. 617.
18 Vgl. ABI. C 209 (2019), S. 4.
19 Vgl. Kajüter(2017), S. 621; IDW (2017), S. 14; Sopp/Baumüller (2019), S. 1804.
20 Vgl. ABI. C 209 (2019), S. 4.
21 Vgl. fürdiesenAbsatz ABI. C 209 (2019), S. 9.
22 Vgl. für diesen Absatz ABI. C 209 (2019), S. 10.
23 Vgl. für diesen Absatz ABI. C 209 (2019), S.ll.
24 Vgl. für diesen Absatz ABI. C 209 (2019), S. 11.
25 Vgl. für diesen Absatz ABI. C 209 (2019), S. 12-19.
26 Vgl. TCFD (2017a), S. 59-61.
27 Vgl. Pellens et al. (2017), S. 99.
28 Vgl. Pellens et al. (2017), S. 100-101.
29 Die hier folgenden Ausführungen wurden i. W. Baetge/Kirsch/Thiele (2016), S. 147-150 und Coenenberg/Haller/Schultze (2016), S. 68-70 entnommen.
30 Vgl. Löw (2019), S. 1 ff.; WEF (2020), S. 36.
31 Vgl. EFRAG (2020b), S. 32.
32 Vgl. Mercer (2019), S. 12-17.
33 Vgl. EFRAG (2020a), S. 8.
34 Vgl. Kirchhoff Consult/BDO (2020), S. 12.
35 Vgl. etwa auch durch den Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung (2020), S. 4, 19, 20.
36 Vgl. beispielhaft Aviva (2018), S. 16-22.
37 Vgl. EFRAG (2020b), S. 36-37, TCFD (2019), S. 74.
38 Vgl. EFRAG (2020a), S. 8.
39 Vgl. Schäfer/Schönberger(2020), S. 551.
40 Vgl. TCFD (2017b), S. 11; MMC (2018), S. 10; UNEP Fl/OliverWyman (2018), S. 15.
41 Vgl. TCFD (2017b), S. 8-9.
42 Vgl. EFRAG (2020b), S. 42.
43 Vgl. TCFD (2017b), S. 13; Symon(2013), S. 14.
44 Vgl. EFRAG (2020a), S. 8.
45 Vgl. CDSB (2020a), S. 21; ACT (2020), S. 45.
46 Vgl. EFRAG (2020a), S. 18.
47 Nach CDSB (2020a), S. 17 geben 100% der 50 größten EU-Unternehmen unter dem Regime der CSR-Richtlinie Kennzahlen über ihre THG-Emissionen an. Das Carbon Reporting von Unternehmen ist auch fester Bestandteil der Empfehlungen der TCFD, siehe TCFD (2017a), S. 30-31.
48 Vgl. Speich (2020), S. 342-344; ABI. C 209 (2019), S. 4, 6; TCFD (2017a), S. 30.
49 § 289c Abs. 3 Nr. 4 HGB, zusätzlich aus Empfehlungen in ABI. C 209 (2019), S. 5-8.
50 Sogenannte „Scope 3-Emissionen“, vgl. ABI. C 209 (2019), S. 14.
51 Vgl. Speich (2020), S. 342.
52 Vgl. Boecker/Zwimer (2019), S. 236.
53 Vgl. bspw. AnnahmenzurLaufleistunginBMW (2020), S. 69-70; VW (2020), S. 62, 71.
54 Nach Kirchhoff Consult/BDO (2020), S. 15 machen im DAX 30 nur 9 von 27 Unternehmen quantitative Angaben unter Einbezug der Lieferkette. CDSB (2020a), S. 17 gibt im EU-weiten Vergleich an, dass nur 54% der betrachteten Unternehmen explizit THG-Emissionen unter Einbezug der Lieferkette angeben.
55 Vgl. Niehues/Dutzi/Schwoy (2018), S. 303-304.
56 Vgl. EFRAG (2020a), S. 15, 17.
57 Vgl. ABI. C 209 (2019), S. 17.
58 Vgl. WEF (2020), S. 2-3.
59 Vgl. CDSB (2020a), S. 8-9, 14-16.
60 Vgl. EFRAG (2020a), S. 6-7.
61 Vgl. CDSB (2020a), S. 14.
62 Vgl. CDSB (2020a), S. 14, 26.
63 Vgl. Velte/Stawinoga (2019), S. 885.
64 Einige Stellungnahmen zur Überarbeitung der CSR-RL befürworten eine stärkere Integration der TCFD-Empfehlungen: CDP (2020), S. 2, 7; CDSB (2020b), S. 3; IIGCC (2020), S. 7, 8, 11.
65 Vgl. DRSC (2019), S. 1-3; Sopp/Baumüller (2019), S. 1808-1809; Barckow (2019).
Häufig gestellte Fragen zum Language Preview
Was ist das Thema des Language Preview?
Der Language Preview behandelt die klimabezogene Berichterstattung in der EU, insbesondere die Analyse und kritische Würdigung der Problemfelder aus Sicht von Investoren. Es geht darum, die Entscheidungsnützlichkeit dieser Berichterstattung zu bewerten und die Auswirkungen der EU-Leitlinien zu untersuchen.
Welche Hauptpunkte werden im Inhaltsverzeichnis erwähnt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Abkürzungs- und Symbolverzeichnisse, eine Einleitung, Grundlagen der Analyse (inkl. Auswirkungen des Klimawandels auf Unternehmen und empfohlene Inhalte klimabezogener Berichterstattung), eine Analyse und kritische Würdigung der Problemfelder klimabezogener Berichterstattung, ein Fazit mit Ausblick, sowie Literatur- und Rechtsquellenverzeichnisse.
Welche Arten von Risiken des Klimawandels für Unternehmen werden unterschieden?
Die TCFD unterscheidet zwischen Übergangsrisiken (Transition Risks) und physischen Risiken (Physical Risks) des Klimawandels. Übergangsrisiken sind mittelbare Auswirkungen infolge des Übergangs zu einer karbonärmeren Gesellschaft, während physische Risiken unmittelbare, physikalische Folgen des Klimawandels darstellen.
Was sind die Kernbereiche der Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)?
Die TCFD-Empfehlungen umfassen vier Kernbereiche: Governance, Strategie (Darstellung der Auswirkungen klimabezogener Chancen und Risiken), Risikomanagement (Prozesse zur Identifikation, Beurteilung und Handhabung von Klimarisiken) sowie Kennzahlen und Ziele zur Beurteilung und Handhabung klimabezogener Chancen und Risiken.
Wie verknüpfen sich die gesetzlichen Anforderungen des CSR-RUG mit den EU-Leitlinien zur klimabezogenen Berichterstattung?
Die EU-Kommission empfiehlt, den gesetzlichen Rahmen des CSR-RUG durch klimabezogene Angaben auszufüllen. Dabei werden wesentliche Empfehlungen der TCFD integriert, z. B. zur Darstellung des Geschäftsmodells, der verfolgten Konzepte und Due-Diligence-Prozesse, der wesentlichen Risiken und der wichtigsten Leistungsindikatoren.
Welche Analysekriterien werden zur Beurteilung der Entscheidungsnützlichkeit herangezogen?
Zur Beurteilung der Entscheidungsnützlichkeit werden die Informationsbedürfnisse der Adressaten der Rechnungslegung (v. a. Investoren) und die Grundsätze der Relevanz (Vorhersage- und Bestätigungskraft), der glaubwürdigen Darstellung (Vollständigkeit, Neutralität, Fehlerfreiheit), der Vergleichbarkeit, Nachprüfbarkeit, Zeitnähe und Verständlichkeit herangezogen.
Welche Problemfelder werden hinsichtlich einer entscheidungsnützlichen Berichterstattung über die Auswirkungen des Klimawandels identifiziert?
Zu den Problemfeldern gehören die Prognosefähigkeit der Auswirkungen des Klimawandels, die Aussagekraft von klimabezogenen Leistungsindikatoren, die Bedeutung des Klimawandels in der Risikoberichterstattung und die Regulierung klimabezogener Berichterstattung in der EU.
Welche Kritik wird an den klimabezogenen Leitlinien der EU-Kommission geäußert?
Es wird kritisiert, dass die Leitlinien den gesetzlichen Rahmen der CSR-Richtlinie stark überspannen und deren Zielsetzung zuwiderlaufen, auch die Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt abzubilden. Außerdem erscheinen die Leitlinien als intendierte Anwendungshilfe zu knapp und können Unternehmen im Vergleich zu den ohnehin schon bestehenden TCFD-Empfehlungen keinen echten Mehrwert bieten.
- Quote paper
- Maximilian Beckmann (Author), 2020, Berichterstattung über die Auswirkungen des Klimawandels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/941843