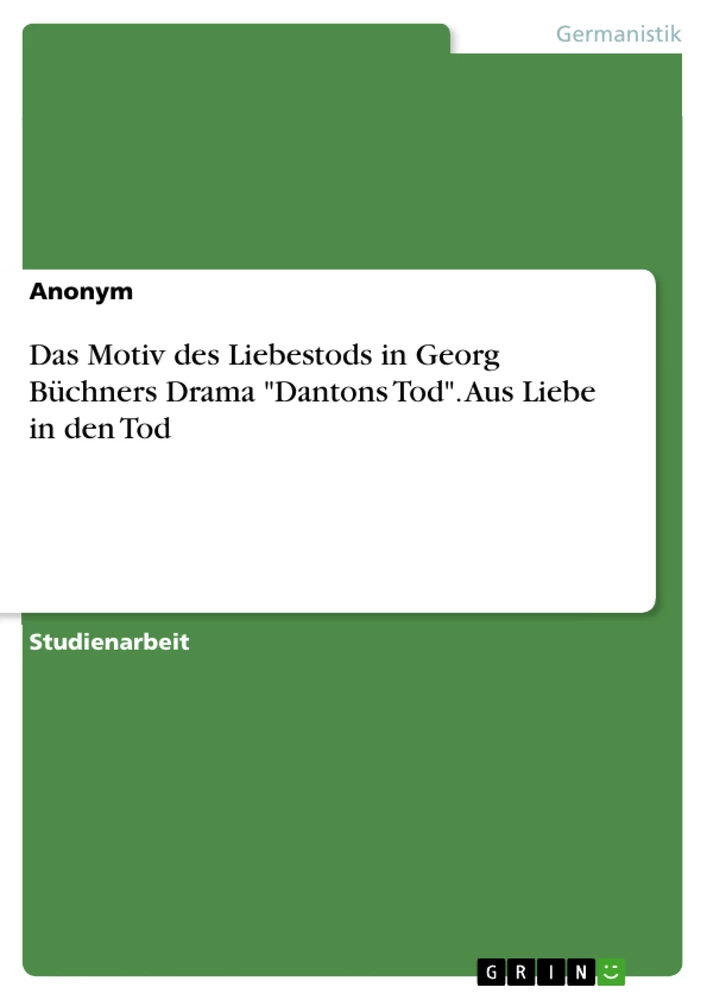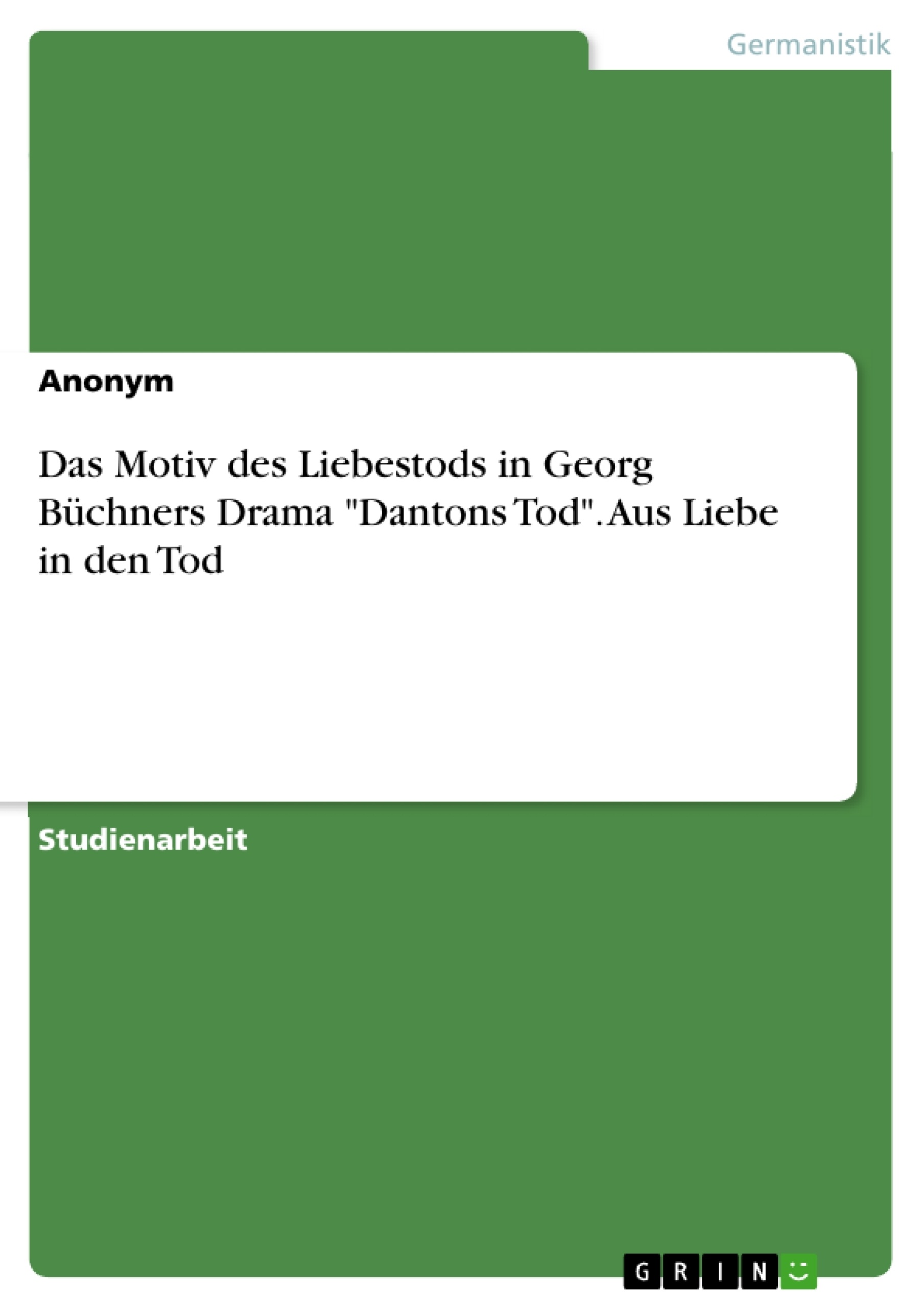Die vorliegende Arbeit konzentriert sich ausgehend von dieser Beobachtung auf die Frage, aus welchen Beweggründen sich die Figuren für den Liebestod entscheiden und welche Bedeutung dies für die Interpretation des Gesamttexts hat. Gestützt wird sich hierzu auf die Methode der Psychoanalyse Freuds, der sich in seiner Triebtheorie mit dem Liebes- und Todestrieb auseinandersetzt. Die Analyse wird anhand der drei „Selbstmordszenen“ von Marions Liebhaber, Lucile und Julie durchgeführt. Hierbei wird jeweils die Liebesbeziehung zu deren Partnern, die Umstände ihres Todes und ihre innere Gefühlswelt betrachtet. Mittels der gewonnenen Erkenntnisse wird abschließend in einem Fazit die Forschungsfrage beantwortet.
Liebe und Tod – Zwei Phänomene, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Doch treten sie oft in Verbindung miteinander auf, denn Liebe bedeutet nicht nur Harmonie, Erfüllung und Freude, sie ist auch oft Anlass für Leid, Schmerz sowie den Tod. Ob im Theater oder in der Literatur, der sogenannte „Liebestod“ stellt dabei wohl die faszinierendste Verbindung zwischen Eros und Thanatos her. Bereits in der Antike war er Gegenstand von Mythen und bis heute ist er als zentrales Motiv in vielen literarischen Werken großer Schriftsteller aufzufinden: von Tristan und Isolde, über Shakespeares Romeo und Julia bis hin zu Goethes Die Leiden des jungen Werthers. In der deutschen Literatur wird er vor allem im 18. und 19. Jahrhundert thematisiert, denn zu dieser Zeit galt der Liebestod in Europa als „Faszinosum besonderer Art“ . So verwendet auch Georg Büchner in Dantons Tod dieses literarische Motiv. In seinem Drama gibt es drei Szenen, in denen aus Liebe zu einem Partner Selbstmord begangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Freuds Psychoanalyse
- Büchner und Freud
- Triebtheorie
- Lebenstrieb
- Todestrieb
- Zusammenhang Eros und Thanatos
- Liebestod in Dantons Tod
- Liebestod der Ehefrauen
- Gifttod
- ,,Es lebe der König!“
- Der ersäufte Liebhaber
- Liebestod der Ehefrauen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Motiv des Liebestodes in Georg Büchners Drama Dantons Tod anhand der psychoanalytischen Triebtheorie Freuds. Dabei wird untersucht, aus welchen Beweggründen sich die Figuren für den Liebestod entscheiden und welche Bedeutung dieser für die Interpretation des Gesamttextes hat.
- Bedeutung des Liebestodes als literarisches Motiv
- Analyse der Selbstmordszenen in Dantons Tod
- Anwendung der psychoanalytischen Triebtheorie Freuds auf die Figuren
- Beziehung zwischen Eros und Thanatos in den Selbstmordszenen
- Zusammenhang zwischen Liebe und Tod in Büchners Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Liebestod ein und stellt die Forschungsfrage: Aus welchen Beweggründen entscheiden sich Figuren in Dantons Tod für den Liebestod und welche Bedeutung hat dies für die Interpretation des Gesamttextes?
- Freuds Psychoanalyse: Dieses Kapitel stellt die Beziehung zwischen Georg Büchners Werk und Sigmund Freuds Psychoanalyse dar, wobei insbesondere die Triebtheorie Freuds im Fokus steht. Das Kapitel beleuchtet die zwei gegensätzlichen Triebe, den Lebenstrieb (Eros) und den Todestrieb (Thanatos), und deren Bedeutung für die menschliche Psyche.
- Liebestod in Dantons Tod: Dieses Kapitel analysiert die Selbstmordszenen in Dantons Tod, wobei die Motivationen und inneren Gefühlswelten der Figuren untersucht werden. Hierbei werden die Liebesbeziehungen, die Umstände der Selbstmorde und die Rolle des Liebestodes in der Gesamtinterpretation des Dramas beleuchtet.
Schlüsselwörter
Liebestod, Georg Büchner, Dantons Tod, Sigmund Freud, Triebtheorie, Eros, Thanatos, Selbstmord, Liebe, Tod, Psychoanalyse, Literaturanalyse, Interpretation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Das Motiv des Liebestods in Georg Büchners Drama "Dantons Tod". Aus Liebe in den Tod, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/942266