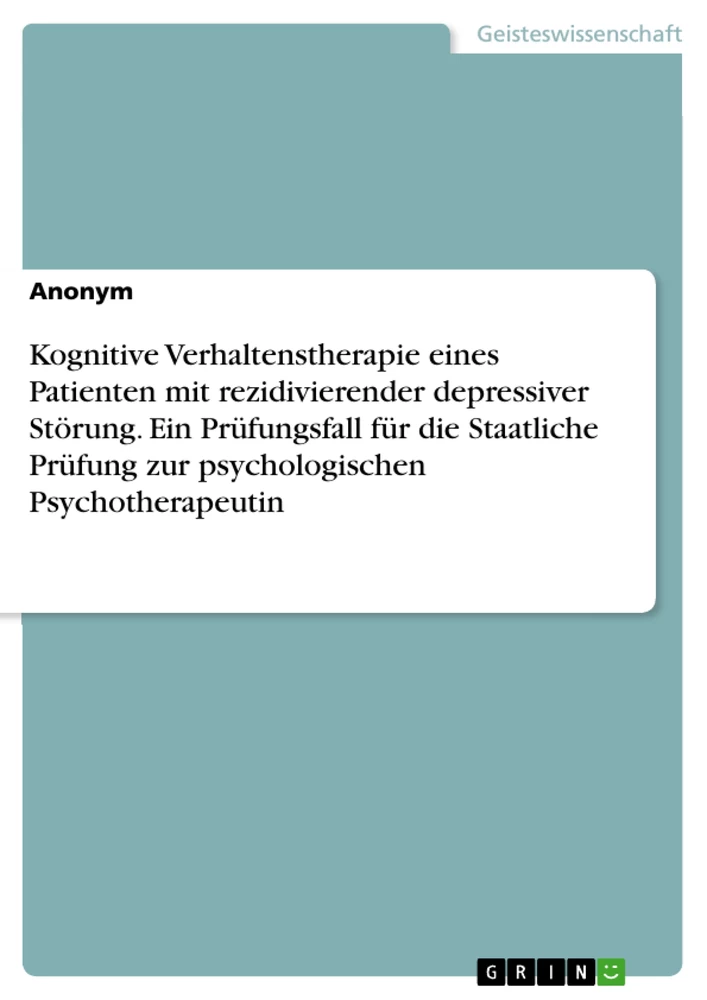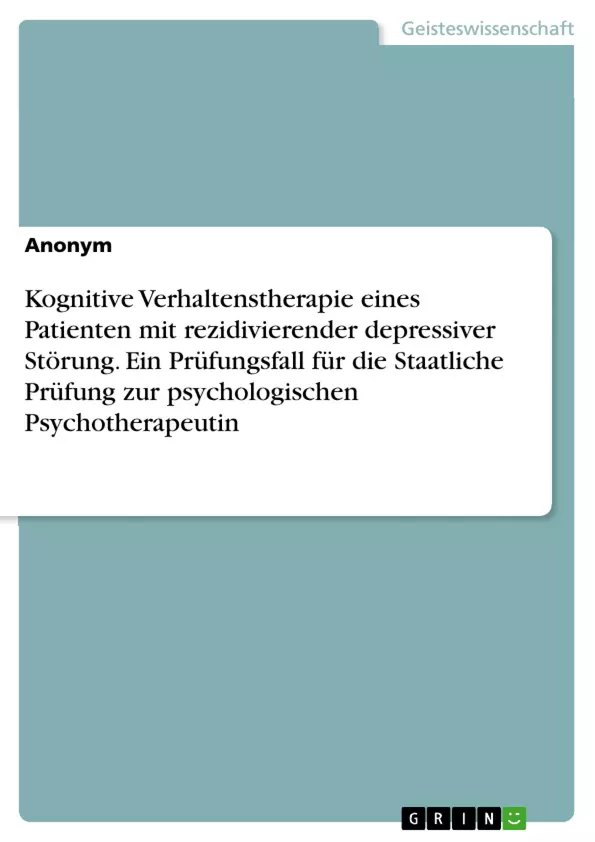Diese Arbeit stellt einen Beispielfall für das Examen zum Psychotherapeuten dar.
Im Aufnahmegespräch berichtet der Patient, an Depressionen zu leiden. Er sei 2016 bereits aufgrund depressiver Beschwerden in einer sechswöchigen teilstationären psychosomatischen Behandlung gewesen, woraufhin sich seine Beschwerden gebessert hätten. Seit Mai 2018 leide er erneut an starker Erschöpfung, wiederkehrenden Grübelgedanken, starken Magenbeschwerden, Kopfschmerzen sowie an einem ausgeprägten Unwohlsein bis hin zu Gefühlen von Panik, wenn er zur Arbeit gehe. Er habe einen großen Widerwillen, zur Arbeit zu gehen und eine innere Stimme sage „Du kannst jetzt nicht arbeiten gehen.“. Sobald er bei der Arbeit sei werde ihm übel, er beginne vermehrt zu schwitzen und habe den Gedanken „Ich muss hier weg.“. Er empfinde seine Leistungsfähigkeit als eingeschränkt und sei seit Mai 2018 arbeitsunfähig. Der Patient grüble vermehrt über die Zukunft und seine Arbeitsfähigkeit und mache sich große Sorgen. Er fühle sich hilflos und könne sich seine psychosomatischen Beschwerden nicht erklären. Für die ambulante Therapie wünsche er sich, einen Grund für seine Beschwerden zu finden und diese zu akzeptieren.
Inhaltsverzeichnis
- Aktuelle Anamnese
- Biographische & soziale Anamnese
- Psychopathologischer Befund
- Diagnostik
- Therapieziele
- Therapieverlauf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Prüfungsfall analysiert die kognitive Verhaltenstherapie eines Patienten mit rezidivierender depressiver Störung, aktuell in einer leichten Episode. Ziel ist es, den Behandlungsprozess zu dokumentieren, die diagnostischen Schritte und therapeutischen Interventionen zu erläutern und die Ergebnisse der Therapie zu präsentieren.
- Entwicklung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung
- Erarbeitung eines Störungsmodells der Depression
- Identifizierung und Modifikation dysfunktionaler Gedankenmuster
- Ressourcenaktivierung und Verbesserung der emotionalen Wahrnehmung
- Entwicklung von Strategien zur Depressionsbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
Aktuelle Anamnese
Der Patient berichtet von wiederkehrenden depressiven Beschwerden, die sich in Erschöpfung, Grübelgedanken, körperlichen Symptomen und Angstgefühlen äußern. Er beschreibt einen großen Widerwillen gegenüber der Arbeit und eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit.
Biographische & soziale Anamnese
Der Patient schildert eine behütete Kindheit und ein erfolgreiches Studium. Er hat eine leitende Position innegehabt, jedoch unter großem Stress und Überlastung gearbeitet. Nach ersten depressiven Beschwerden im Jahr 2015 erfolgte eine teilstationäre psychosomatische Behandlung. Der Patient hat in der Vergangenheit seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt und ein starkes Leistungsstreben gezeigt.
Psychopathologischer Befund
Der Patient ist im Erstgespräch gepflegt und allseits orientiert. Es bestehen keine Auffälligkeiten in der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Konzentration. Die Stimmung ist niedergeschlagen, die emotionale Schwingungsfähigkeit reduziert. Der Patient berichtet emotionsarm, detailliert und teils weitschweifig.
Diagnostik
Die Ergebnisse des KPD-38 weisen überdurchschnittlich erhöhte Werte auf der Skala allgemeine Lebenszufriedenheit auf. Der BDI-II ergibt einen Summenscore von 17, der auf eine „milde / leichte“ Ausprägung depressiver Symptome hinweist. Die Diagnose lautet: Rezidivierende depressive Störung, ggw. leichte Episode (F33.0).
Therapieziele
- Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung
- Erarbeiten eines psychosomatischen Krankheitsmodells in Bezug auf die depressiven Beschwerden
- Psychoedukation
- Erarbeitung funktionaler Strategien zur Depressionsbewältigung
- Verbesserung der Wahrnehmung eigener Emotionen und Bedürfnisse
- Ressourcenaktivierung
Therapieverlauf
Der Patient erschien stets pünktlich und zuverlässig zu den vereinbarten Terminen. Es konnte eine vertrauensvolle, tragfähige therapeutische Beziehung entwickelt werden. Es wurde ein Störungsmodell der Depression mit zugrundeliegenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren erarbeitet. Im Störungsmodell wurden vor allem dysfunktionale Gedanken des Patienten („Ich hätte mich mehr anstrengen sollen. Ich mache nicht genug“) und der daraus resultierende Leidensdruck deutlich. Biografisch konnte eine Verknüpfung zu den leistungsorientierten, erfolgreichen Eltern gefunden werden. Aufbauend auf ausführlicher Psychoedukation und mit Hilfe von Techniken der Sokratischen Gesprächsführung (Stavemann, 2008) sowie dem Einüben von Techniken der kognitiven Umstrukturierung (Hautzinger, 2013) konnten die dysfunktionalen, automatischen Gedanken hinterfragt und beginnend modifiziert werden (Überprüfung und Realitätstestung automatischer Gedanken, Reattribuierung und dem Finden alternativer Erklärungen, Erkennen von Doppelstandards sowie Entkatastrophisieren). Durch diese Erarbeitung konnte der Patient im Sinne einer motivationalen Klärung sein Krankheitsverständnis erweitern und vertiefen. Methoden der Gedankenkontrolle wurden erarbeitet (Gedankenstop, Einrichten von Grübelzeiten, Achtsamkeitsübungen) und durch das Einsetzen der erarbeiteten Strategien bemerkte der Patient eine Reduktion des Grübelns und verspürte eine erstmalige Entlastung.
Im Verlauf der Therapie fand der Patient einen neuen Arbeitsplatz, an dem er keine Mitarbeiterverantwortung innehatte. Er hatte für sich erkannt, dass er versuche, es „allen recht zu machen“ und sich hierbei oftmals selbst vergaß. Ein ausgeprägtes Leistungsstreben mit perfektionistischen, phasenweise zwanghaft anmutenden Persönlichkeitszügen wurden deutlich und mit dem Patientin wiederkehrend unter Einsatz der Sokratischen Gesprächsführung kritisch reflektiert und modifiziert.
Weiterhin äußerte der Patient den Wunsch, sich selbst besser zu verstehen. Er habe in der Vergangenheit Emotionen immer als „unnötige Zeitverschwendung“ erlebt. Psychoedukativ wurde über die Relevanz von Emotionen informiert. Angelehnt an Storch (2016) wurde der Patient angeleitet, verstärkt auf eigene Wünsche und Bedürfnisse zu achten. Eigeninitiativ entwickelte der Patient die Vorstellung eines „Arbeitsmeetings“ in seinem Kopf, in dem auch die Abteilungen „Bauchgefühl“ und „Kopf /Verstand“ vertreten waren. Der Patient erklärte sich die depressiven Einbrüche dadurch, dass die Abteilung „Bauchgefühl“ in der Vergangenheit stets übergangen worden sei und nahm sich fest vor, dieser in der Zukunft mehr Raum zu lassen. Auf der Verhaltensebene zeigten sich erste Erfolge, indem der Patient an einem vereinbarten Tennisspiels trotz seines ausgeprägten Pflichtgefühls nicht teilnahm, da er die Zeit lieber mit seiner Familie verbringen wollte. Auch auf kognitiver Ebene zeigte sich im Verlauf eine deutliche Verbesserung bezogen auf die Flexibilität der dysfunktionalen Kognitionen.
Schlüsselwörter
Rezidivierende depressive Störung, Kognitive Verhaltenstherapie, Dysfunktionale Gedankenmuster, Psychoedukation, Ressourcenaktivierung, Störungsmodell, Sokratische Gesprächsführung, Kognitive Umstrukturierung, Gedankenkontrolle, Emotionale Wahrnehmung, Leistungsstreben, Perfektionismus, Arbeitsstress, Krankheitsverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser kognitiven Verhaltenstherapie?
Ziel war die Behandlung einer rezidivierenden depressiven Störung durch den Aufbau eines Störungsmodells, Ressourcenaktivierung und kognitive Umstrukturierung.
Welche Rolle spielt Leistungsstreben bei der Entstehung der Depression?
Beim Patienten wurde ein ausgeprägtes Leistungsstreben und Perfektionismus identifiziert, das zur Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und schließlich zur Erschöpfung führte.
Was versteht man unter kognitiver Umstrukturierung?
Dabei werden dysfunktionale Gedanken (z.B. „Ich mache nicht genug“) identifiziert, hinterfragt und durch funktionalere, realistischere Denkmuster ersetzt.
Wie wurde die emotionale Wahrnehmung des Patienten verbessert?
Durch Psychoedukation und Übungen wurde der Patient angeleitet, sein „Bauchgefühl“ stärker in Entscheidungen einzubeziehen und Emotionen nicht als Zeitverschwendung zu sehen.
Welche Techniken wurden zur Bewältigung von Grübelgedanken eingesetzt?
Zum Einsatz kamen Methoden wie der Gedankenstopp, das Einrichten fester Grübelzeiten sowie gezielte Achtsamkeitsübungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Kognitive Verhaltenstherapie eines Patienten mit rezidivierender depressiver Störung. Ein Prüfungsfall für die Staatliche Prüfung zur psychologischen Psychotherapeutin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/942315