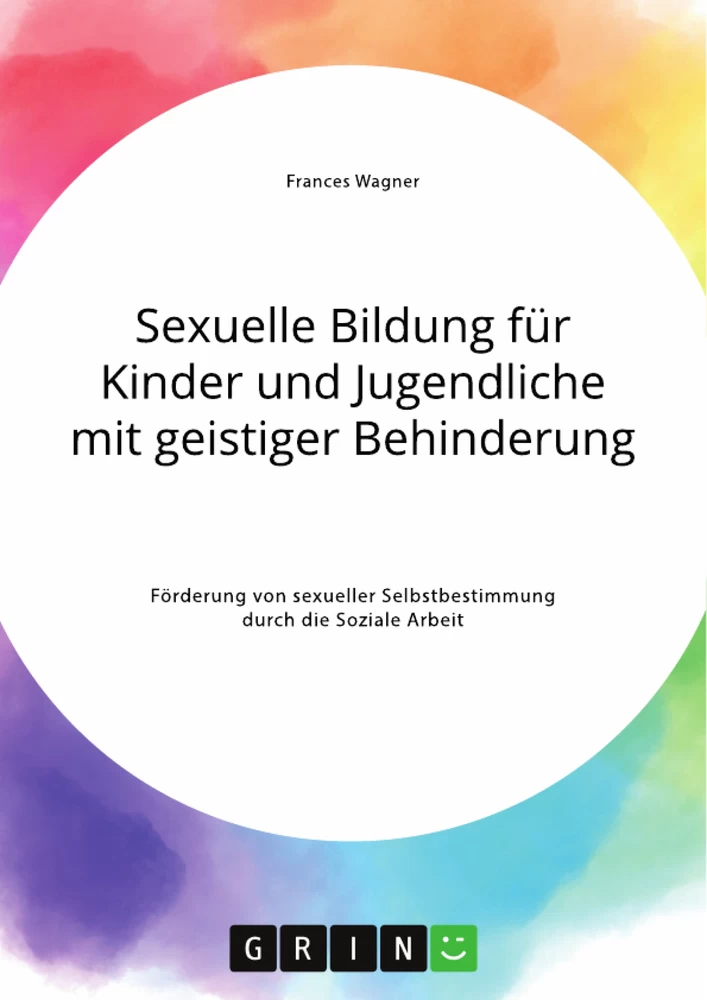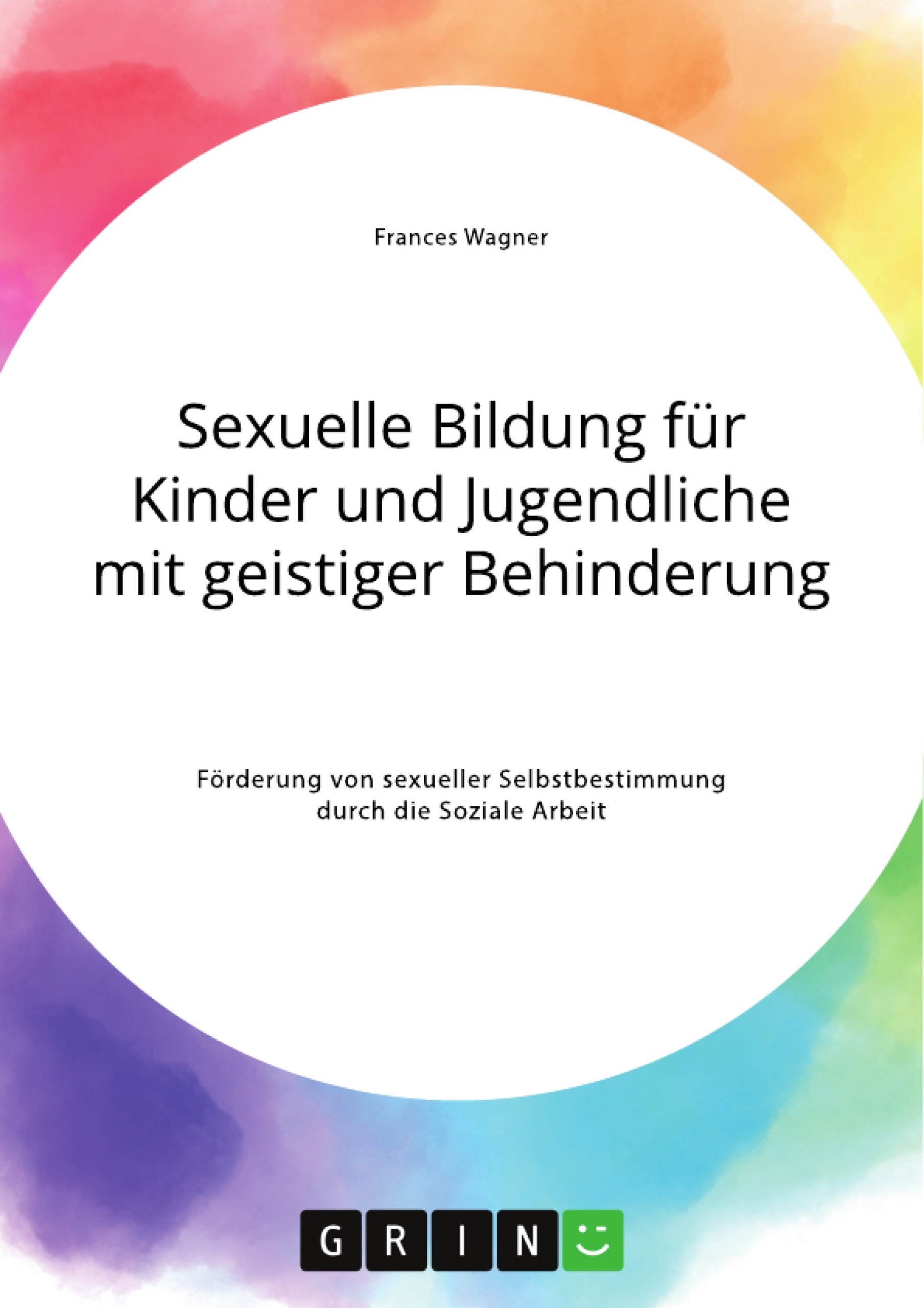Diese Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, welche besonderen Bedürfnisse Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung bezüglich sexueller Bildung haben und wie die Soziale Arbeit die sexuelle Selbstbestimmung dieses Personenkreises im Alltag fördern kann. Menschen mit geistiger Behinderung sind selbst im Erwachsenenalter oftmals noch sehr unaufgeklärt. Sexualität ist allerdings ein wichtiger Faktor für die Identitätsentwicklung und entgegen verbreiteter Vorurteile auch für Menschen mit Behinderung von erheblicher Bedeutung. Aufgrund von jahrelangen Stigmatisierungsprozessen dominierten lange Zeit repressive Konzepte sowohl die Theorie als auch die Praxis der Sexualpädagogik. In den letzten Jahren wurde das Thema Sexualität in Bezug auf Menschen mit Behinderung allerdings zunehmend enttabuisiert und eine Normalisierung der Lebensverhältnisse angestrebt. Aufgrund dessen wird Selbstbestimmung mittlerweile als zentrales Leitprinzip für die pädagogische Arbeit postuliert.
Sowohl Sexualität als auch sexuelle Bildung und sexuelle Selbstbestimmung stellen ein menschliches Grundrecht dar. Trotzdem ist in der pädagogischen Praxis ein (wohlmeinender) Paternalismus gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung noch häufig vertreten. Eine (sexuell) selbstbestimmte Lebensführung kann allerdings nur realisiert werden, wenn andere Menschen dies auch zulassen und fördern. Zudem findet die gesellschaftliche Vermittlung von Sexualität als soziale Kompetenz vor allem im Kindes- und Jugendalter statt, weshalb die Wissensvermittlung und Ermöglichung von Erfahrungsräumen in dieser Zeitspanne besonders bedeutsam ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung und -diskussion
- Sexualität
- Geistige Behinderung
- Personenkreis der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung
- Sexuelle Selbstbestimmung
- Sexualpädagogik
- Sexuelle Bildung
- Rechtliche Rahmenbedingungen sexueller Bildung
- Recht auf Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung
- Recht auf Bildung und Sexualaufklärung
- Merkmale von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung
- Sexualität und sexuelle Entwicklung
- Lebenslagen und deren mögliche Auswirkungen auf die Sexualität
- Einfluss von gesellschaftlichen Normen und Stigmata
- Familiäre Bedingungen
- Institutionelle Versorgung
- Pädagogische Verhältnisse
- Fehlen von Lern- und Erfahrungsräumen
- Bedürfnisse bezüglich sexueller Bildung
- Bedeutung für die Soziale Arbeit
- Empowerment
- Fallbeispiele
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der sexuellen Bildung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung und untersucht, wie die Soziale Arbeit die sexuelle Selbstbestimmung dieser Personengruppe im Alltag fördern kann.
- Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe wie Sexualität, geistige Behinderung, sexuelle Selbstbestimmung und sexuelle Bildung
- Relevante rechtliche Rahmenbedingungen, die das Recht auf Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung sowie das Recht auf Bildung und Sexualaufklärung gewährleisten
- Spezifische Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung im Kontext der sexuellen Bildung, die durch ihre individuelle Entwicklung und Lebenslagen beeinflusst werden
- Einsatz von Empowerment-Ansätzen in der Sozialen Arbeit, um die sexuelle Selbstbestimmung der Zielgruppe in konkreten Alltagssituationen zu fördern
- Zusammenführung der Ergebnisse und Analyse der Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit bei der Förderung der sexuellen Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe der Arbeit, wie Sexualität, geistige Behinderung, sexuelle Selbstbestimmung und sexuelle Bildung. Die Vielfältigkeit menschlicher Sexualität wird beleuchtet und die unterschiedlichen Perspektiven und Begriffsverständnisse im Fachdiskurs diskutiert.
Kapitel zwei präsentiert die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, die das Recht auf Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung sowie das Recht auf Bildung und Sexualaufklärung für alle Menschen gewährleisten. Es wird untersucht, ob die Zielgruppe aus rechtlicher Perspektive zur Selbstbestimmung fähig ist und welche Konsequenzen sich daraus für die Soziale Arbeit ergeben.
In Kapitel drei wird die sexuelle Entwicklung sowie die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung genauer betrachtet, um die besonderen Bedürfnisse dieses Personenkreises bezüglich sexueller Bildungsangebote herauszufinden. Hierbei werden die Einflüsse von gesellschaftlichen Normen, familiären Bedingungen, institutioneller Versorgung, pädagogischen Verhältnissen und dem Fehlen von Lern- und Erfahrungsräumen analysiert.
Kapitel vier konkretisiert, wie SozialarbeiterInnen die sexuelle Selbstbestimmung der Zielgruppe in konkreten Alltagssituationen fördern können. Hierfür werden Empowerment-Ansätze vorgestellt und an Fallbeispielen illustriert.
Schlüsselwörter
Sexuelle Bildung, geistige Behinderung, sexuelle Selbstbestimmung, Empowerment, Soziale Arbeit, Inklusion, Teilhabe, Recht auf Sexualität, Lebenslagen, Bedürfnisse, Fallbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist sexuelle Bildung für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig?
Sexualität ist ein wesentlicher Teil der Identitätsentwicklung und ein menschliches Grundrecht. Bildung ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung und schützt vor Ausbeutung.
Was bedeutet sexuelle Selbstbestimmung in diesem Kontext?
Es bedeutet, dass Menschen mit Behinderung das Recht haben, eigene Entscheidungen über ihren Körper und ihre Beziehungen zu treffen, sofern sie dabei unterstützt und nicht bevormundet werden.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei der sexuellen Bildung?
Sozialarbeiter fördern die sexuelle Bildung durch Empowerment-Ansätze, die Bereitstellung von Erfahrungsräumen und die Aufklärung über Rechte und Normen.
Welche Barrieren gibt es für die sexuelle Entwicklung betroffener Jugendlicher?
Barrieren sind oft gesellschaftliche Stigmata, ein wohlmeinender Paternalismus in Institutionen sowie ein Mangel an altersgerechten Lern- und Informationsangeboten.
Gibt es einen rechtlichen Anspruch auf Sexualaufklärung?
Ja, das Recht auf Bildung und Information umfasst auch die Sexualaufklärung, um die Teilhabe und Selbstbestimmung aller Menschen zu gewährleisten.
- Quote paper
- Frances Wagner (Author), 2020, Sexuelle Bildung für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/942620