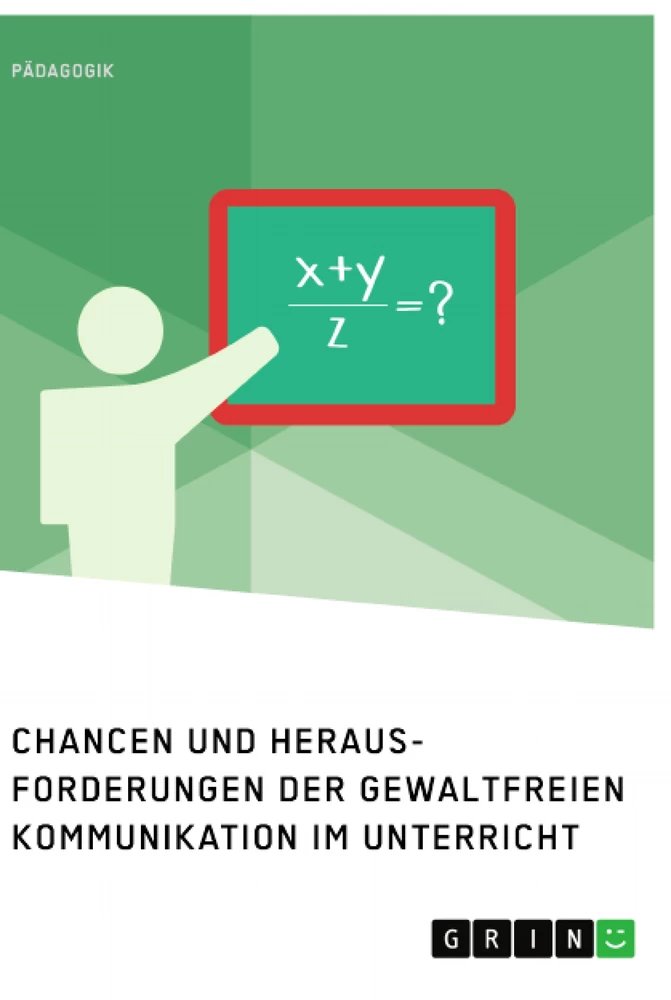In dieser Arbeit soll untersucht werden, welche Chancen und Herausforderungen im Unterricht durch Lehrende, die sich in der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) weitergebildet haben, entstehen. Das Sprachhandlungsmodell der GFK ist insbesondere in der Äußerung von Rückmeldungen Lehrender gegenüber Lernenden abweichend von „normalen“ Rückmeldungen im Unterricht, da hier auf Beurteilungen wie beispielsweise „richtig“ oder „falsch“ verzichtet wird. Inwieweit ein Verzicht von Beurteilungen im Kontext Schule überhaupt möglich ist, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Dazu wird im theoretischen Teil der Arbeit das Modell der Gewaltfreien Kommunikation, insbesondere das Vier-Schritte-Modell, erläutert, da das Modell einen wichtigen Beitrag zur späteren Herleitung der GFK-spezifischen Rückmeldung bildet. Der zweite Teil der Theorie bildet das Grundgerüst für die Darstellung der GFK im Unterricht. Hier werden Aspekte betrachtet, die sich auf das GFK-spezifische Rollenbild des Lehrenden beziehen und die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden darstellen. Anschließend wird der Begriff „Feedback“ definiert, um im weiteren Verlauf eine Definition des Feedbacks o.a. der Rückmeldung in der GFK darzustellen. Anschließend wird das zuvor erläuterte Modell der GFK kritisch betrachtet.
Der Abschluss des theoretischen Teils wird durch die Fragestellung gebildet. Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine qualitative Forschung. Die Methode der Datenerhebung, die Auswahl der Interviewten sowie die Methode der Datenauswertung werden in Kapitel 7 dargestellt. Die Daten wurden anhand von Interviews erhoben und mit Hilfe der Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Hierfür wurde ein Kategoriensystem erstellt, dessen Ergebnisse in Kapitel 8 erläutert und zusammengefasst werden und anschließend in der Diskussion in Bezug zu der Theorie und der Forschungsfrage gesetzt werden. Im Fazit werden die Ergebnisse der Forschung zusammengefasst und es wird ein Ausblick darüber gegeben, wie dieses Feld zukünftig erforscht werden könnte. Eine Beschäftigung mit dem Thema der Gewaltfreien Kommunikation im Unterricht ist besonders relevant, da es bisher nur wenige wissenschaftliche Auseinandersetzungen zu diesem Thema gibt und diese meist sehr spezifisch sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell der Gewaltfreien Kommunikation
- Begriffsdefinition „Gewaltfreie Kommunikation“
- Marshall B. Rosenberg und die Entstehung der GFK
- Prämissen, Menschenbild und Haltung in der GFK
- Das Vier-Schritte-Modell
- Beobachten ohne zu bewerten
- Gefühle erkennen und ausdrücken
- Bedürfnisse benennen
- Eine konkrete Bitte formulieren
- Empathie
- Ziele und Absichten der GFK
- Zwischenfazit
- Gewaltfreie Kommunikation im Unterricht
- Rollenverständnis des Lehrkörpers in der GFK
- Unterrichtsgestaltung im Sinne der GFK mit besonderem Fokus auf die LehrerInnen-SchülerInnen Beziehung
- Der Umgang mit Macht
- Zwischenfazit
- Das Feedback
- Definition Feedback
- Kriterien effektiver Rückmeldung im Unterricht
- Das Feedback in der GFK
- Lob und die Anwendung strafender Macht
- Wertschätzung und Anerkennung ausdrücken in der GFK
- Der Umgang mit Fehlern in der GFK
- Zwischenfazit
- Kritische Betrachtung der Gewaltfreien Kommunikation
- Forschungsfrage
- Methode
- Datenerhebung
- Sampling
- Interviewumstände
- Datenauswertung
- Codierleitfaden
- Kategoriensystem
- Forschungsergebnisse
- Kennenlernen der GFK
- Gewaltfreie Kommunikation im Unterricht
- Unterrichtssituationen
- Methoden und Übungen
- Umgang mit Verweigerung im Unterricht
- Rückmeldung in der GFK
- Chancen und Stärken der GFK
- Grenzen und Herausforderungen der GFK
- Im Unterricht
- In der Rückmeldung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) im Unterricht. Ziel ist es, die Anwendung der GFK im schulischen Kontext zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Lehrer-Schüler-Beziehung sowie die Gestaltung des Unterrichts zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die praktische Umsetzung der GFK und deren spezifische Herausforderungen.
- Anwendung der Gewaltfreien Kommunikation im Unterricht
- Auswirkungen der GFK auf die Lehrer-Schüler-Beziehung
- GFK-spezifische Rückmeldungen im Unterricht
- Chancen und Stärken der GFK im schulischen Kontext
- Grenzen und Herausforderungen der GFK im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) im Kontext Schule ein. Sie beschreibt, wie unser Menschenbild unsere Interaktion mit anderen beeinflusst und wie die GFK eine neue Interpretation menschlichen Verhaltens ermöglicht, insbesondere bei Normüberschreitungen von Schülern. Die Arbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen der GFK im Unterricht, insbesondere im Hinblick auf die Rückmeldung von Lehrkräften an Schüler, und fragt nach der Möglichkeit des Verzichts auf Bewertungen im schulischen Kontext.
Das Modell der Gewaltfreien Kommunikation: Dieses Kapitel erläutert das Modell der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Es definiert die GFK, beschreibt ihre Prämissen und ihr Menschenbild, und detailliert das Vier-Schritte-Modell (Beobachten ohne Werten, Gefühle erkennen und ausdrücken, Bedürfnisse benennen, konkrete Bitte formulieren). Die Bedeutung von Empathie und die Ziele der GFK werden ebenfalls behandelt, um ein umfassendes Verständnis des Modells zu schaffen. Das Kapitel legt die theoretische Grundlage für die spätere Analyse der GFK-spezifischen Rückmeldung im Unterricht.
Gewaltfreie Kommunikation im Unterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Anwendung der GFK im Unterricht. Es analysiert das Rollenverständnis von Lehrkräften im Kontext der GFK und untersucht, wie die GFK die Unterrichtsgestaltung und insbesondere die Lehrer-Schüler-Beziehung beeinflusst. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Macht im Klassenzimmer unter Berücksichtigung der Prinzipien der GFK. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Interaktionsdynamik zwischen Lehrenden und Lernenden.
Das Feedback: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Feedback“ und legt Kriterien für effektive Rückmeldungen im Unterricht dar. Im Zentrum steht die Betrachtung von Feedback aus der Perspektive der GFK, im Gegensatz zu traditionellen Rückmeldungen. Es werden die Unterschiede zwischen Lob (als Anwendung strafender Macht) und der wertschätzenden Anerkennung im Rahmen der GFK beleuchtet. Der Umgang mit Fehlern unter Anwendung der GFK-Prinzipien wird ebenfalls diskutiert.
Kritische Betrachtung der Gewaltfreien Kommunikation: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen der Gewaltfreien Kommunikation. Es beleuchtet potenzielle Limitationen und Herausforderungen, die bei der praktischen Umsetzung im schulischen Alltag auftreten können. Dies bildet den wichtigen Gegenpol zu den vorangegangenen Kapiteln, die sich primär mit den positiven Aspekten der GFK befassen.
Schlüsselwörter
Gewaltfreie Kommunikation (GFK), Marshall B. Rosenberg, Unterricht, Lehrer-Schüler-Beziehung, Feedback, Rückmeldung, Empathie, Bedürfnisse, Chancen, Herausforderungen, Schulalltag, Macht, Normüberschreitungen, Beobachtung, Bewertung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Gewaltfreie Kommunikation im Unterricht
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Anwendung der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) im Unterricht, analysiert deren Auswirkungen auf die Lehrer-Schüler-Beziehung und die Unterrichtsgestaltung, und beleuchtet sowohl Chancen als auch Herausforderungen der GFK im schulischen Kontext. Ein besonderer Fokus liegt auf der GFK-spezifischen Rückmeldung.
Welche Aspekte der Gewaltfreien Kommunikation werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Modell der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, inklusive des Vier-Schritte-Modells (Beobachten ohne Werten, Gefühle erkennen und ausdrücken, Bedürfnisse benennen, konkrete Bitte formulieren), die Bedeutung von Empathie, und die Ziele der GFK. Sie analysiert die Anwendung der GFK im Unterricht, das Rollenverständnis von Lehrkräften, den Umgang mit Macht und die Gestaltung von Feedback im Sinne der GFK.
Wie wird Feedback im Kontext der GFK betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen traditionellem Feedback und Feedback im Rahmen der GFK. Sie beleuchtet kritisch den Unterschied zwischen Lob (als Anwendung strafender Macht) und wertschätzender Anerkennung, und diskutiert den Umgang mit Fehlern unter Anwendung der GFK-Prinzipien. Kriterien für effektive Rückmeldungen im Unterricht werden ebenfalls dargelegt.
Welche Forschungsmethoden wurden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die angewendeten Methoden der Datenerhebung und -auswertung. Details zum Sampling, den Interviewumständen, dem Codierleitfaden und dem Kategoriensystem werden erläutert.
Welche Forschungsergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Forschungsergebnisse zum Kennenlernen der GFK, zur Anwendung der GFK im Unterricht (einschließlich Unterrichtsmethoden, Umgang mit Verweigerung), zur Rückmeldung in der GFK, sowie zu Chancen und Stärken, aber auch Grenzen und Herausforderungen der GFK im Unterricht und in der Rückmeldung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, dem Modell der Gewaltfreien Kommunikation, der Gewaltfreien Kommunikation im Unterricht, dem Feedback, einer kritischen Betrachtung der GFK, der Forschungsfrage, der Methode und den Forschungsergebnissen. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewaltfreie Kommunikation (GFK), Marshall B. Rosenberg, Unterricht, Lehrer-Schüler-Beziehung, Feedback, Rückmeldung, Empathie, Bedürfnisse, Chancen, Herausforderungen, Schulalltag, Macht, Normüberschreitungen, Beobachtung, Bewertung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Anwendung der GFK im schulischen Kontext zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Lehrer-Schüler-Beziehung und die Unterrichtsgestaltung zu beleuchten. Sie untersucht die Chancen und Herausforderungen der GFK in der Praxis.
Gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit der GFK?
Ja, die Arbeit enthält ein separates Kapitel, das sich kritisch mit den Stärken und Schwächen der Gewaltfreien Kommunikation auseinandersetzt und potenzielle Limitationen und Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung im schulischen Alltag beleuchtet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Chancen und Herausforderungen der Gewaltfreien Kommunikation im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/942793