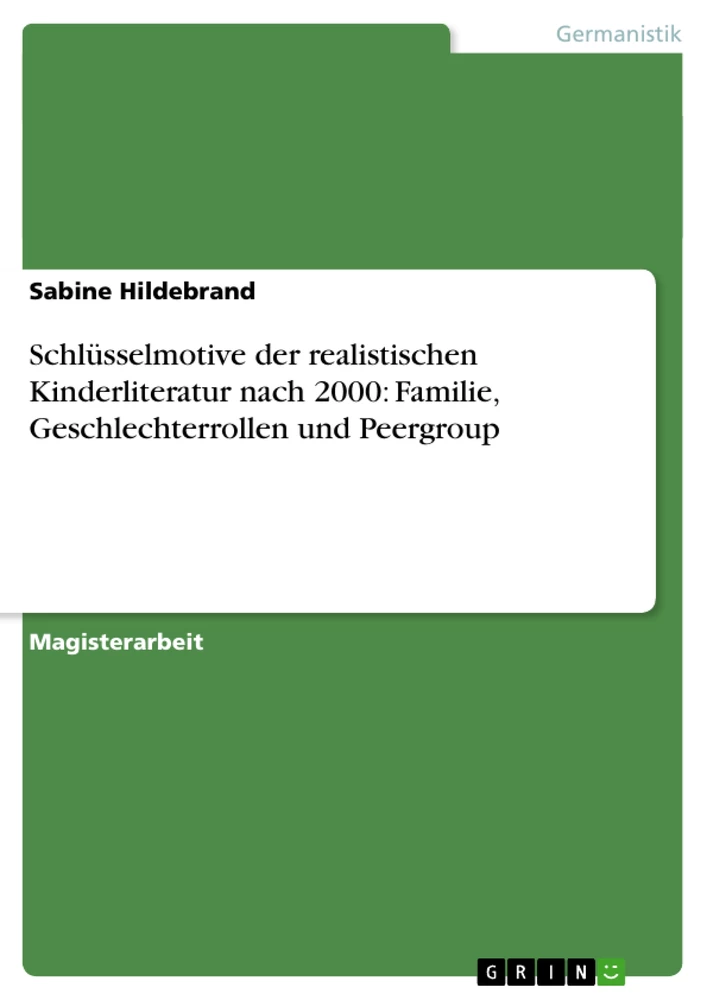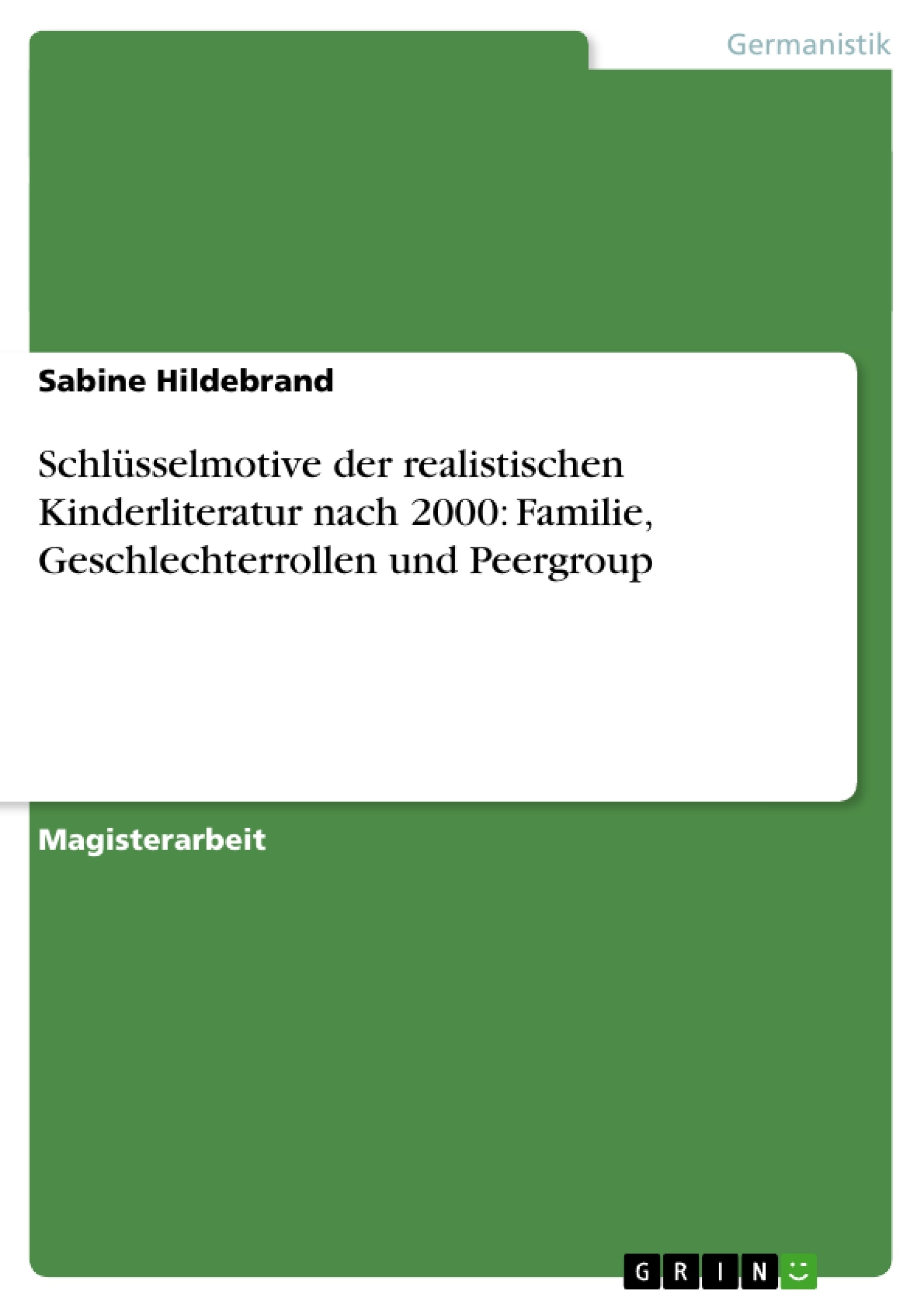Einhergehend mit dem von der 68er Bewegung hervorgebrachten Wandel des pädagogischen Grundverständnisses, welches im Zuge einer sich parallel zur Frauenemanzipation vollziehenden Emanzipation des Kindes entsteht , erfährt die Kinder- und Jugendliteratur in den 70er Jahren eine deutliche Aufwertung. War es zuvor zentrales Anliegen der KinderbuchautorInnen, Kindheit in einem Freiraum fernab sozialer Lebenswirklichkeit abzubilden und kindliche Autonomiebestrebungen außerhalb dieser darzustellen, geht es nun vorrangig um eine literarische Vergegenwärtigung eines absolut gleichberechtigten Kindheitsverständnisses. Nach dieser neuen Kindheitsauffassung sollen Heranwachsende zunehmend in den Erwachsenenalltag integriert werden. Die primäre Intention der Kinderliteratur unterscheidet sich nun insofern von der der bis dato verbreiteten „kindertümlichen“ Literatur, als letztere sich zwar ebenso für die Rechte Heranwachsender aussprach, diese aber ausschließlich in einem Erfahrungsraum außerhalb der Gesellschaft realisiert wurden. Hierbei handelte es sich vorrangig z.B. um das Recht auf „Unbeschwertheit“, „Naivität“ oder darauf,„an das Wunderbare zu glauben“ ; um andere Rechte also, als diejenigen, welche im ,realen’ sozialen Kontext der Erwachsenenwelt von primärer Relevanz sind. Im Kontrast dazu begreift die Kinderliteratur nach 1970 Kinder zunehmend als vollkommen gleichgestellte Individuen und sieht gerade im „Zusammenleben mit den Erwachsenen“ außerhalb eines solchen Schonraumes die zu bewältigende Herausforderung für Kinder. Sie gewährt ihnen diese speziellen Rechte somit nicht, wie bisher, lediglich innerhalb einer isolierten, rein kindlichen Welt, sondern gesteht ihnen fortan exakt dieselben Rechte wie Erwachsenen in einem identischen sozialen Kontext zu . Hans-Heino Ewers spricht in diesem Zusammenhang von einer „Liquidierung des Standes der Kindheit als einer Gegenwelt“. Im Fokus der Kinderliteratur stehen nunmehr dieselben gesellschaftlichen Themen, welche auch die Erwachsenenliteratur behandelt, wobei auf eine „allgemeine Kindgemäßheit“ verzichtet wird. Die Kinderliteratur soll fortan einen unbeschönigten Wirklichkeitsbezug aufweisen und erhebt den Anspruch, Alltagsprobleme in ebenso kritischer Weise wie die Erwachsenenliteratur zu beleuchten. So führt die Kinderliteratur der 70er Jahre ihren kindlichen LeserInnen laut Isa Schikorsky „auch die dunklen Seiten des Alltags in Familie und Gesellschaft“ vor.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Vorbemerkung: Kinderliteratur im Wandel...
- 1.2 Vorgehensweise
- 2 Textanalyse
- 2.1 Beate Dölling: „Anpfiff für Ella“
- 2.1.1 Zum Text - Aktualitätskriterien eines zeitgemäßen Kinderbuches
- 2.1.2 Die familiäre Situation – der moderne Verhandlungshaushalt im,intakten’ familiären Umfeld.
- 2.1.3 Geschlechterrollen – die berufstätigen Eltern, das,starke' Mädchen und der,schwache' Junge..
- 2.1.4 Freundschaft als Sozialisationsfaktor....
- 2.2 Joachim Masannek: „Die Wilden Fussballkerle“
- 2.2.1 Zum Text – Anatomie einer erfolgreichen Kinderbuchreihe...
- 2.2.2 Familienkonstellationen.
- 2.2.2.1 Der Tod eines Elternteils. Der freundschaftliche Vater, die wertkonservative Großmutter ....
- 2.2.2.2 Der liberale Vater und die Geschwisterbeziehung
- 2.2.2.3 Weitere Familien- und Erziehungsformen: Vom hierarchischen Befehlshaushalt bis zum Laissez-Faire..
- 2.2.3 Kindliche Sozialisation und Identitätskonstruktion im Kontext von Peerbeziehungen – Individualität in der Gleichaltrigengruppe...
- 2.2.4 Kontextualisierte Geschlechtersozialisation
- 2.2.4.1 Geschlechterrollen der Eltern- und Großelterngeneration ......
- 2.2.4.2 Androgynität eines Mädchens – Positiv verstandene Emanzipation oder Weiblichkeitsverleugnung?
- 2.2.4.3 Das,starke schwache' Mädchen – Weiblichkeit als neue' Tugend
- 2.2.4.4 Der dominante Junge als Anführer.
- 2.2.4.5 Der vernünftige Bruder
- 2.3 Beate Dölling: „Kaninchen bringen Glück“
- 2.3.1 Zum Text - ein Kinderbuch als Plädoyer für Nonkonformität
- 2.3.2 Familiäre Konflikte und deren Bewältigung: Trennung der Eltern und konfliktäre Mutter-Tochter-Beziehung...
- 2.3.3 Zwischen traditionellen und modernen Geschlechterrollenkonzepten ........
- 2.4 Sigrid Zeevaert: „Mia Minzmanns Mäusezucht“.
- 2.4.1 Zum Text – ein kindgerechtes, Problembuch'
- 2.4.2 Die allein erziehende Mutter.
- 2.4.3 Geschlechterrollen – die lebenstüchtige Mutter, das starke, einfühlsame Mädchen und der hilfsbereite Junge
- 2.4.4 Konfliktbewältigung in der Freundschaft – die reziproke Freundschaft als Wert oberster Priorität
- 2.5 Vanessa Walder: „Ferien, Chaos und Familie“
- 2.5.1 Zum Text - kindliche Lebenswelten: urbaner Lebensraum versus ländliches Idyll
- 2.5.2 Familiäre Geborgenheit statt elterliches Karrierestreben……………..\n
- 2.5.3 Die,chaotische Heldin', die,perfekte' Mutter und die unkonventionelle Großmutter..\n
- 2.5.4 Die Mädchenfreundschaft als zentraler Wert..\n
- 3 Resümee: Familie, Geschlechterrollen und Peergroup im Kinderbuch nach 2000
- 3.1 Formale Aspekte............
- 3.2 Figurenzeichnungen
- 3.3 Familien- und Erziehungsformen........
- 3.4 Geschlechterrollen....
- 3.5 Freundschaft, Peergroup und erste Liebe.…………………………….\n
- 2.1 Beate Dölling: „Anpfiff für Ella“
- 4 Kinderliteratur nach 2000 im Kontext gesellschaftlicher Realität
- 4.1 Geschlechterrollenwandel: von einer Entpolarisierung der Geschlechterrollen zu einer neuen Mehrdimensionalität.\n
- 4.2 Chancen und Risiken des Individualismus – Konsumkindheit, Medienkindheit und Multioptionalismus als kinderliterarische Herausforderungen......................\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Abschlussarbeit befasst sich mit der realistischen Kinderliteratur nach dem Jahr 2000 und untersucht, wie die Themen Familie, Geschlechterrollen und Peergroup in diesem Genre dargestellt werden. Die Arbeit analysiert ausgewählte Kinderbücher und beleuchtet die jeweiligen Darstellungen im Kontext der zeitgenössischen gesellschaftlichen Entwicklungen.
- Die Darstellung von Familienformen und -konstellationen in der Kinderliteratur nach 2000.
- Die Evolution der Geschlechterrollen in modernen Kinderbüchern und deren Reflexion der gesellschaftlichen Veränderungen.
- Die Bedeutung der Peergroup in der kindlichen Sozialisation und Identitätsentwicklung, wie sie in der analysierten Literatur zum Ausdruck kommt.
- Die Wechselwirkung zwischen den Themen Familie, Geschlechterrollen und Peergroup und deren Einfluss auf die kindliche Entwicklung.
- Die Rolle der Kinderliteratur als Spiegelbild und zugleich als Gestaltungselement der gesellschaftlichen Realität.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit der Einleitung. Es skizziert den Wandel der Kinderliteratur im Laufe der Zeit und erläutert die methodische Vorgehensweise. Die anschließende Textanalyse widmet sich verschiedenen Kinderbüchern, wobei die jeweiligen Kapitel die Themen Familie, Geschlechterrollen und Peergroup in den Vordergrund stellen. So werden in Kapitel 2.1 die Themen im Kinderbuch „Anpfiff für Ella“ von Beate Dölling behandelt, während Kapitel 2.2 die „Wilden Fussballkerle“ von Joachim Masannek in den Fokus rückt. Weiterhin analysiert Kapitel 2.3 das Werk „Kaninchen bringen Glück“ von Beate Dölling, und Kapitel 2.4 widmet sich dem Buch „Mia Minzmanns Mäusezucht“ von Sigrid Zeevaert. Zuletzt beleuchtet Kapitel 2.5 das Buch „Ferien, Chaos und Familie“ von Vanessa Walder. Das dritte Kapitel fasst die Ergebnisse der Textanalysen zusammen und stellt die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit dar. Das vierte Kapitel betrachtet die Kinderliteratur im Kontext der gesellschaftlichen Realität und analysiert die Entwicklung von Geschlechterrollen sowie die Chancen und Risiken des Individualismus.
Schlüsselwörter
Realistische Kinderliteratur, Familie, Geschlechterrollen, Peergroup, Sozialisation, Identitätskonstruktion, Konsumkindheit, Medienkindheit, Multioptionalismus, Kinderbuchforschung, zeitgenössische Kinderliteratur, gesellschaftliche Entwicklungen, Familienformen, Familienkonflikte.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Kinderliteratur seit den 1970er Jahren verändert?
Sie wandelte sich von einer "kindertümlichen" Gegenwelt zu einer realistischen Darstellung, die Kinder als gleichberechtigte Individuen in der Erwachsenenwelt zeigt.
Welche Rolle spielt die Familie in der Kinderliteratur nach 2000?
Die Literatur thematisiert moderne Familienformen, den "Verhandlungshaushalt", Trennungen der Eltern sowie Einelternfamilien und deren Konfliktbewältigung.
Wie werden Geschlechterrollen in modernen Kinderbüchern dargestellt?
Es zeigt sich ein Wandel hin zu mehrdimensionalen Rollen, wie z.B. berufstätige Eltern, "starke" Mädchen und einfühlsame Jungen, die traditionelle Konzepte aufbrechen.
Was bedeutet "Liquidierung des Standes der Kindheit" nach Hans-Heino Ewers?
Es beschreibt das Ende der Kindheit als isolierter Schonraum; Kinderliteratur behandelt nun dieselben kritischen gesellschaftlichen Themen wie die Erwachsenenliteratur.
Welche Bedeutung hat die Peergroup in diesen Büchern?
Die Peergroup (Gleichaltrigengruppe) wird als zentraler Sozialisationsfaktor und Ort der Identitätskonstruktion außerhalb der Familie dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Sabine Hildebrand (Autor:in), 2007, Schlüsselmotive der realistischen Kinderliteratur nach 2000: Familie, Geschlechterrollen und Peergroup, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94333