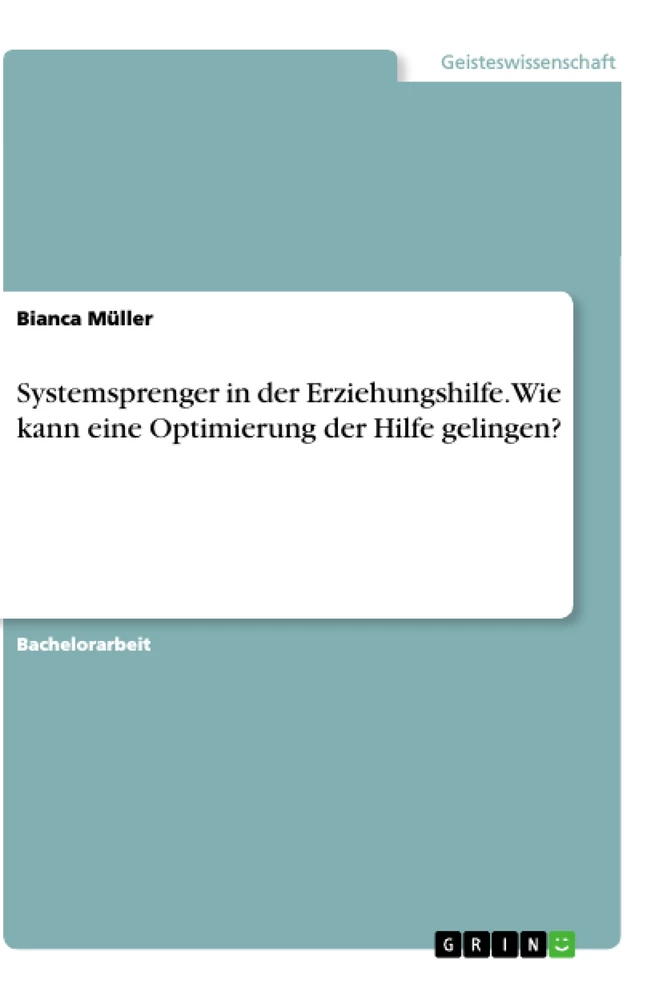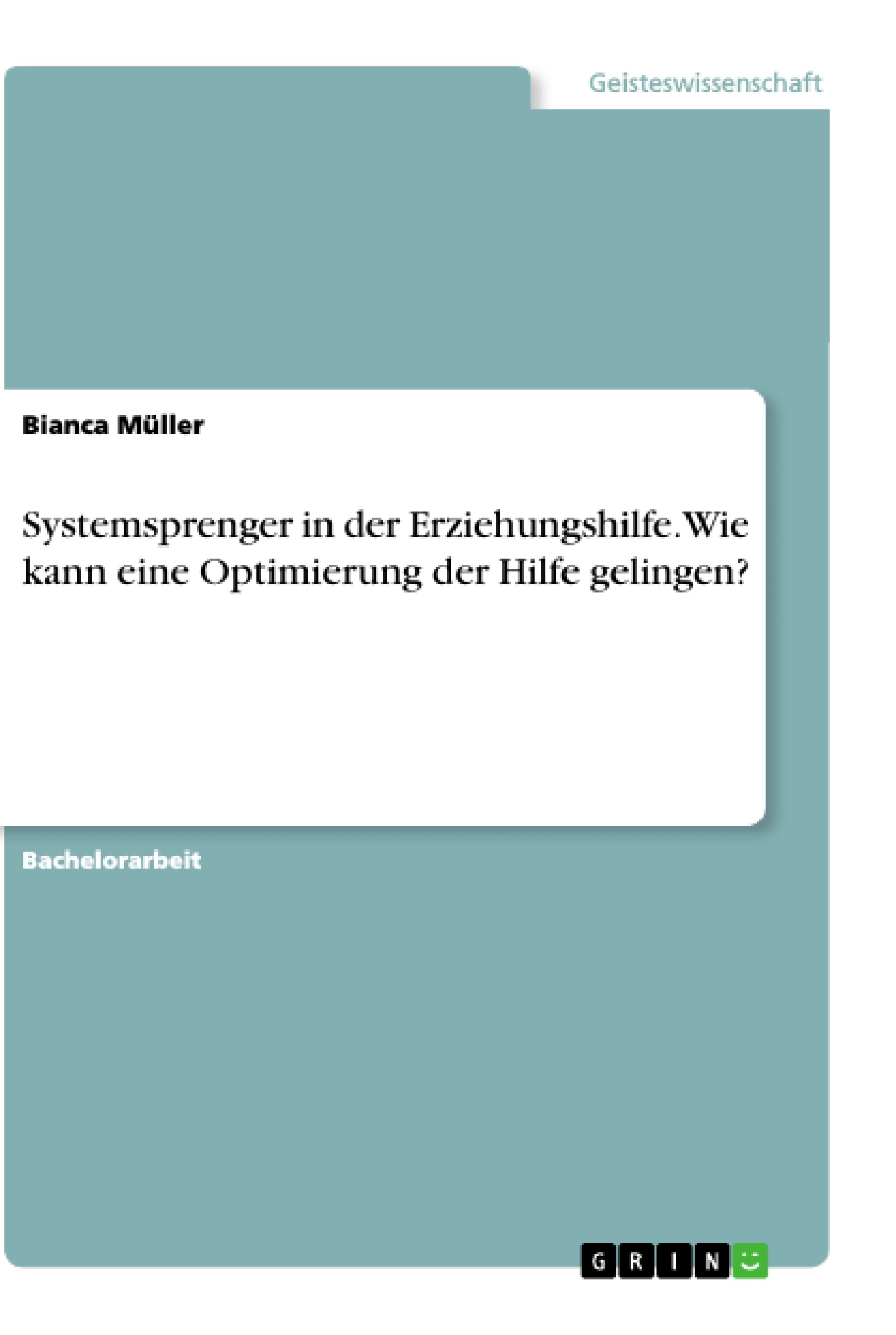Diese Arbeit soll sich der Frage annehmen, wie für diese Kinder- und Jugendlichen eine Passung der Hilfe gelingen kann. Eine Passung beschreibt die Notwendigkeit, Brüche zwischen den Lebenswelten des Kindes/ Jugendlichen und seiner Familie zu vermeiden und die Anschlussfähigkeit zwischen den Unterstützungsangeboten und der biografischen Vorgeschichte zu gewährleisten. Es wird sich also mit der Frage befasst, welche Strukturelemente gegeben sein müssen, damit eine Hilfe auch für diese Gruppe gelingen kann und ein weiteres Herausfallen vermieden wird.
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde einerseits auf bestehende Vorschläge zurückgegriffen und andererseits ein empirisches Forschungsvorgehen ausgewählt. Es wurden zwei leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt und mittels des Instruments der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse daraus zeigen unter anderem die Notwendigkeit der Implementierung einer sozialpädagogischen Diagnostik für ein tieferes Fallverstehen und die Öffnung der Strukturen von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Dies würde zum einen erlauben, die Bedürfnisse der Adressat*innengruppe besser ermitteln und zum anderen auch Strukturen auf den Einzelfall abstimmen zu können.
Von der Pflegefamilie in eine Wohngruppe, von dort aus in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und wieder zurück in eine andere stationäre Wohnform. Dieser Hilfeverlauf ist für die Gruppe der sogenannten jugendlichen „Systemsprenger typisch. Diese Kinder und Jugendliche haben ein erhöhtes Gewaltpotenzial und verweigern oftmals den Schulbesuch. Sie sind eigen- und fremdgefährdend, laufen häufig weg und bleiben auch mal tagelang fern.
Oftmalig werden sie zwischen ambulanten und (teil-) stationären Hilfen zur Erziehung und der Kinder- und Jugendpsychiatrie hin und hergeschoben. In regelmäßigen Abständen werden Hilfen aus unterschiedlichen Gründen beendet. Aufgrund ihrer Verhaltensweisen werden ihnen vielfältige psychiatrische Diagnosen zugewiesen. Für sie kann scheinbar keine passende Hilfeform gefunden werden und der Verbleib in der Familie ist auch keine Option.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract...
- 1. Einleitung...
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Biografie und Lebenslauf...
- 2.2. Lebensphase Jugend...
- 2.3. Konzept der Lebensbewältigung
- 2.4. (Norm-) abweichendes Verhalten...
- 2.5. Lebensweltorientierung...
- 2.6. Verstehende subjektlogische Diagnostik...
- 3. Das System,,Hilfen zur Erziehung“ nach SGB VIII
- 3.1. Das Herausfallen aus dem System...
- 3.2. Heranführung an den Begriff „,Systemsprenger“
- 4. Zum wissenschaftlichen Diskurs...
- 5. Hilfreiche Strukturen...
- 5.1. Die pädagogische Haltung...
- 5.2. Die institutionelle Ebene...
- 5.3. Das Betreuungssetting...
- 5.4. Die Entstehung des Leitfadens aus den Erkenntnissen...
- 6. Empirisches Vorgehen...
- 6.1. Erhebungsinstrument: Experteninterview...
- 6.2. Auswertungsinstrument: Qualitative Inhaltsanalyse...
- 6.3. Gütekriterien und Reflexion...
- 7. Ergebnisse.......
- 7.1. Fallzusammenfassungen.....
- 7.2. Analyse.
- 7.2.1. Vorbereitung der Hilfe...
- 7.2.2. Durchführung der Hilfe
- 7.2.3. Umgang mit dem Kostenträger ......
- 7.2.4. Diagnostik
- 7.2.5. Partizipation des jungen Menschen….......
- 7.2.6. Elternarbeit.
- 7.2.7. Beziehungsqualität
- 7.2.8. Persönlichkeit und Qualifikation der Professionellen.
- 7.3. Interdisziplinäre Fallberatung.
- 7.4. Theorie-Praxis-Transfer
- 7.4.1. Kritische Betrachtung der Ergebnisse......
- 7.4.2. Wie kann eine Passung der Hilfe gelingen?...
- 8. Schlussbetrachtung und Ausblick.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Herausforderung, Kindern und Jugendlichen mit komplexen Lebens- und Hilfeverläufen, oft als „Systemsprenger“ bezeichnet, eine angemessene Unterstützung zukommen zu lassen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Faktoren zu identifizieren, die eine gelingende Passung der Hilfe gewährleisten und somit einen positiven Einfluss auf den Hilfeverlauf dieser Gruppe haben.
- Die Schwierigkeiten der „Systemsprenger“ im Umgang mit dem System der Kinder- und Jugendhilfe.
- Die Notwendigkeit einer umfassenden Diagnostik, um die Bedürfnisse der Adressat*innengruppe besser zu verstehen.
- Die Bedeutung einer flexiblen und individuell angepassten Hilfestruktur, die auf die Bedürfnisse der „Systemsprenger“ eingeht.
- Die Rolle der pädagogischen Haltung und der Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren im Hilfesystem.
- Die Analyse und Interpretation empirischer Daten aus Experteninterviews, um Erkenntnisse über die Herausforderungen und Lösungsansätze in der Praxis zu gewinnen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Problematik von „Systemsprengern“ in der Erziehungshilfe aufzeigt. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis der Adressat*innengruppe und des Problems relevant sind. Dazu gehören Themen wie Biografie, Lebenslauf, Lebensbewältigung, (norm-) abweichendes Verhalten, Lebensweltorientierung und die verstehende subjektlogische Diagnostik. Kapitel 3 beleuchtet das System „Hilfen zur Erziehung“ nach SGB VIII und analysiert das Herausfallen von „Systemsprengern“ aus dem System. In Kapitel 4 wird der wissenschaftliche Diskurs zum Thema „Systemsprenger“ behandelt. Kapitel 5 widmet sich der Darstellung hilfreicher Strukturen, wie der pädagogischen Haltung, der institutionellen Ebene, dem Betreuungssetting und der Entstehung des Leitfadens.
Kapitel 6 erläutert das empirische Vorgehen der Arbeit, wobei Experteninterviews als Erhebungsinstrument und die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsinstrument verwendet wurden. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Analyse und diskutiert die Herausforderungen und Möglichkeiten einer passgenauen Hilfe. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen Kinder- und Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung, „Systemsprenger“, stationäre Hilfen, (norm-) abweichendes Verhalten, verstehende subjektlogische Diagnostik und empirische Forschungsmethoden. Die Ergebnisse der Arbeit tragen dazu bei, die Herausforderungen und Lösungsansätze für die Unterstützung von „Systemsprengern“ in der Praxis zu verstehen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Systemsprenger“?
Es handelt sich um Kinder und Jugendliche mit komplexen Hilfeverläufen, die oft zwischen verschiedenen stationären Einrichtungen und der Psychiatrie hin- und hergeschoben werden und aus dem bestehenden Hilfesystem herausfallen.
Wie kann eine „Passung der Hilfe“ für diese Jugendlichen gelingen?
Eine gelingende Passung vermeidet Brüche zwischen den Lebenswelten und stellt sicher, dass Unterstützungsangebote an die biografische Vorgeschichte des Jugendlichen anknüpfen.
Welche Rolle spielt die sozialpädagogische Diagnostik?
Sie ist notwendig für ein tieferes Fallverstehen, um die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen besser zu ermitteln und Strukturen auf den Einzelfall abzustimmen.
Welche strukturellen Änderungen werden in Einrichtungen vorgeschlagen?
Vorgeschlagen wird eine Öffnung der Strukturen und eine flexiblere Gestaltung der Betreuungssettings, um ein erneutes Herausfallen zu vermeiden.
Warum ist die Beziehungsqualität zwischen Profis und Jugendlichen so wichtig?
Da Systemsprenger oft Beziehungsabbrüche erlebt haben, ist eine stabile pädagogische Haltung und hohe Qualifikation der Professionellen entscheidend für den Erfolg der Hilfe.
Was sind typische Verhaltensweisen von Systemsprengern?
Häufige Merkmale sind erhöhtes Gewaltpotenzial, Schulverweigerung, Weglaufen sowie Eigen- und Fremdgefährdung.
- Quote paper
- Bianca Müller (Author), 2020, Systemsprenger in der Erziehungshilfe. Wie kann eine Optimierung der Hilfe gelingen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/943448