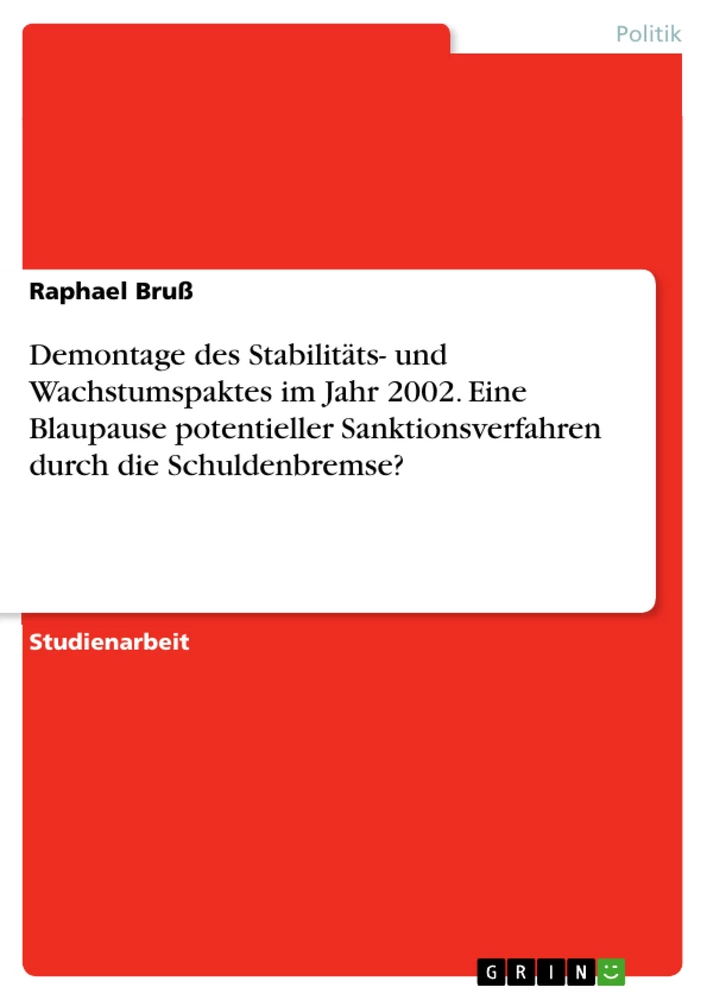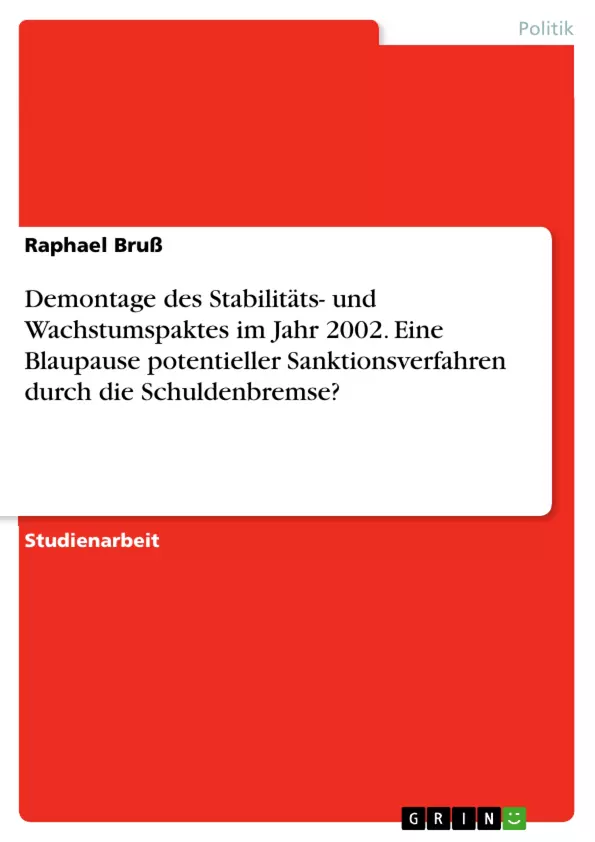Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist, ob Gerhard Schröders Verhalten des öffentlichen Rechthabens womöglich als Blaupause für eine neuere Fiskalregel auf föderaler Ebene dient. Gemeint ist die umgangssprachlich als Schuldenbremse bezeichnete Änderung des Grundgesetzes von 2009. Inhaltlich wird auf eine breite makroökonomische Analyse und Situationsbeschreibung verzichtet. Wichtig in der Darstellung sind nur wenige Kriterien, die die Eigenheiten des Machtmenschens Schröder abstrahieren und die politische Situation aus dem Jahr 2002 transferieren.
Die in Struktur und politischer Abhängigkeit ähnlichen gesetzlichen Rahmen, nämlich der Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie die Schuldenbremse, werden in ihrer Funktion und Ausgestaltung kurz erläutert. Ihre wichtigste Gemeinsamkeit, die Ratsentscheidung von Parteipolitikern über mögliche Sanktionen und Berichtspflichten, dient als Basis, zu zeigen, weshalb die Schuldenbremse nur unter bestimmten Voraussetzungen geeignet sein wird, Haushaltsdefizite nachhaltig zu verhindern.
Denn Ratsentscheidungen von und gegen Parteifreunde(n) (sowie -feinde(n)) nebst politischen Verbündeten und Gegnern, gleichen einem Perpetuum mobile von Zielkonflikten. Weiterhin werden kurz die Schlupflöcher der Schuldenbremse sowie die Bedeutung des Stabilitätsrat zur nachhaltigen und reglementierten Fiskalpolitik erläutert. Folglich wird die Frage zu beantworten sein: Kann eine derartige Fiskalregel ohne automatisches Sanktionsverfahren überhaupt bestehen?
Medienkanzler, Kriegskanzler, Friedenskanzler, Bastapolitik, Agenda 2010 und viele weitere Schlagworte umgeben Gerhard Schröders Kanzlerschaft zwischen 1998 und 2005. Betrachtet wird Schröder als moderner Politiker, als Verkäufer parteipolitischer Interessen, Wählerstimmenmaximierer und Komplexitätsreduzierer für die Öffentlichkeit. Der Selbstregulierung in Fiskalfragen ist er nicht mächtig, zumindest nicht, wenn seine politische Macht auf dem Spiel steht. Dies wird in dieser Arbeit am Beispiel der Demontage des Stabilitäts- und Wachstumspaktes im Jahre 2002 vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Fiskalregeln zur Wahrung der Haushaltsdisziplin
- Stabilitäts- und Wachstumspakt Art. 104 EGV
- Zwischenfazit
- Die ,,Schuldenbremse“ Art. 109, 115 GG
- Zwischenfazit
- Stabilitäts- und Wachstumspakt Art. 104 EGV
- Referenz für die Wirkungslosigkeit fiskalischer Regelbindung
- „Blauer Brief\" aus Brüssel - Präzedenzfall Deutschland
- Ausgewählte Vorbetrachtungen zum Kabinett Gerhard Schröder I und den Medien im betrachteten Zeitraum
- Die Situation zu Beginn des Wahljahres 2002
- Abschluss des Verfahrens - Machtdemonstration Schröders
- Zwischenfazit
- Selektive Betrachtung von theoretischen Basisbegriffen als Erklärungsansatz
- Begrenzte Rationalität und Komplexitätsreduktion
- „Blauer Brief\" aus Brüssel - Präzedenzfall Deutschland
- Kongruenzen und Ausblick
- Eine Kurzbetrachtung möglicher Schlupflöcher der Schuldenbremse
- Der Einfluss des Stabilitätsrates auf die Wirksamkeit der Schuldenbremse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Demontage des Stabilitäts- und Wachstumspaktes im Jahr 2002 durch die deutsche Regierung unter Gerhard Schröder als mögliches Vorbild für die Anwendung von Sanktionsmechanismen im Rahmen der sogenannten Schuldenbremse.
- Der Stabilitäts- und Wachstumspakt als Instrument zur Sicherung der Haushaltsdisziplin innerhalb der Europäischen Union.
- Die deutsche Schuldenbremse und ihre vergleichbare Struktur sowie Funktion zum Stabilitäts- und Wachstumspakt.
- Die politische Dimension der Sanktionsmechanismen und ihre potenzielle Wirkungslosigkeit.
- Die Rolle des Stabilitätsrates in der Anwendung und Kontrolle der Schuldenbremse.
- Mögliche Schlupflöcher und Herausforderungen bei der Umsetzung der Schuldenbremse.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Motivation des Autors, den Fall der Demontage des Stabilitäts- und Wachstumspaktes im Jahr 2002 als Blaupause für die zukünftige Anwendung der Schuldenbremse zu untersuchen.
Kapitel 2 bietet eine kurze Beschreibung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und der Schuldenbremse, indem es ihre wichtigsten Prinzipien, Regelungen und Ziele hervorhebt. Es wird insbesondere auf die Bedeutung der Sanktionsmechanismen eingegangen und die Gemeinsamkeiten der beiden Regelwerke aufgezeigt.
Kapitel 3 analysiert den Fall der Demontage des Stabilitäts- und Wachstumspaktes im Jahr 2002, wobei die Handlungsweise der deutschen Regierung unter Gerhard Schröder im Mittelpunkt steht. Der Fokus liegt auf der politischen Dimension des Prozesses und der Frage, ob dieses Verhalten als Blaupause für die Anwendung der Schuldenbremse dienen kann.
Kapitel 4 erörtert die potentiellen Schlupflöcher der Schuldenbremse und analysiert die Rolle des Stabilitätsrates bei der Überwachung und Kontrolle der Fiskalpolitik. Es wird die Frage gestellt, ob eine Fiskalregel ohne automatisches Sanktionsverfahren überhaupt wirksam sein kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Stabilitäts- und Wachstumspakt, Schuldenbremse, Sanktionsverfahren, Fiskalpolitik, Haushaltsdisziplin, politische Dimension, Gerhard Schröder, Europäische Union, Deutschland, Stabilitätsrat, Schlupflöcher, Blaupause.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für die „Demontage“ des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 2002?
Im Wahljahr 2002 verhinderte die Regierung unter Gerhard Schröder durch massiven politischen Druck einen drohenden „Blauen Brief“ (eine Verwarnung) aus Brüssel wegen zu hoher Haushaltsdefizite.
Warum wird dieser Fall als „Blaupause“ für die Schuldenbremse bezeichnet?
Die Arbeit untersucht, ob die politische Umgehung von Regeln im Jahr 2002 zeigt, dass auch neuere Fiskalregeln wie die Schuldenbremse ohne automatische Sanktionen wirkungslos bleiben könnten.
Welche Rolle spielt der Stabilitätsrat bei der Schuldenbremse?
Der Stabilitätsrat soll die Einhaltung der Haushaltsdisziplin überwachen. Kritiker bemängeln jedoch, dass dort Politiker über Parteifreunde entscheiden, was Zielkonflikte erzeugt.
Was sind die rechtlichen Grundlagen der deutschen Schuldenbremse?
Die Schuldenbremse wurde 2009 durch Änderungen der Artikel 109 und 115 im Grundgesetz verankert, um die Staatsverschuldung nachhaltig zu begrenzen.
Können Fiskalregeln ohne automatisches Sanktionsverfahren bestehen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass politische Abhängigkeiten und „Schlupflöcher“ die Wirksamkeit solcher Regeln untergraben, wenn Sanktionen nicht automatisch und unabhängig erfolgen.
- Citar trabajo
- Raphael Bruß (Autor), 2015, Demontage des Stabilitäts- und Wachstumspaktes im Jahr 2002. Eine Blaupause potentieller Sanktionsverfahren durch die Schuldenbremse?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/943456