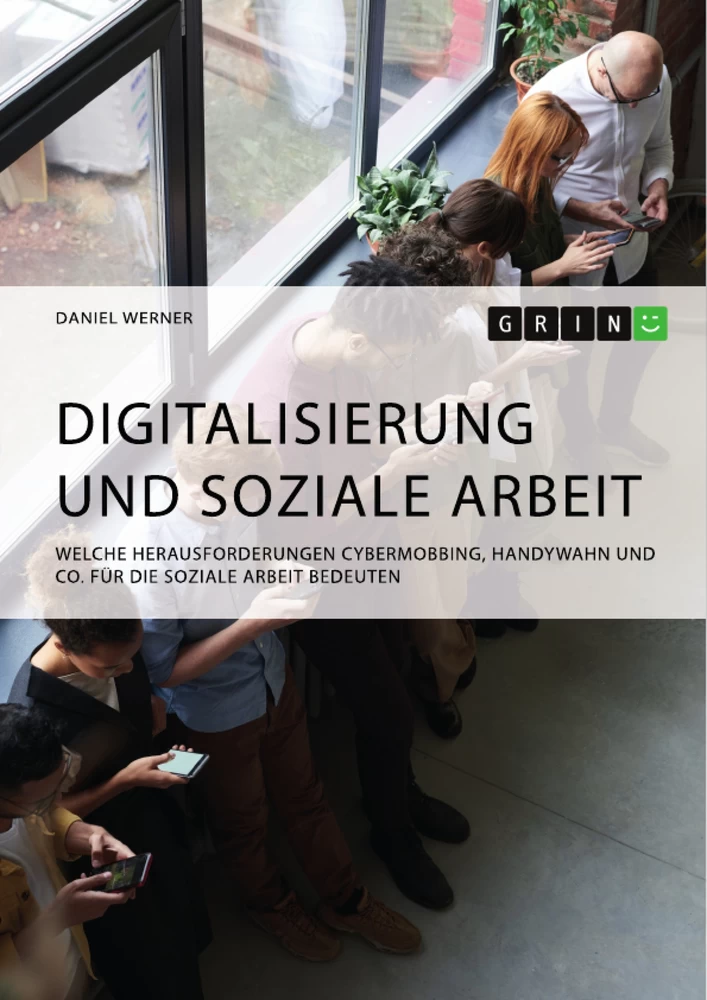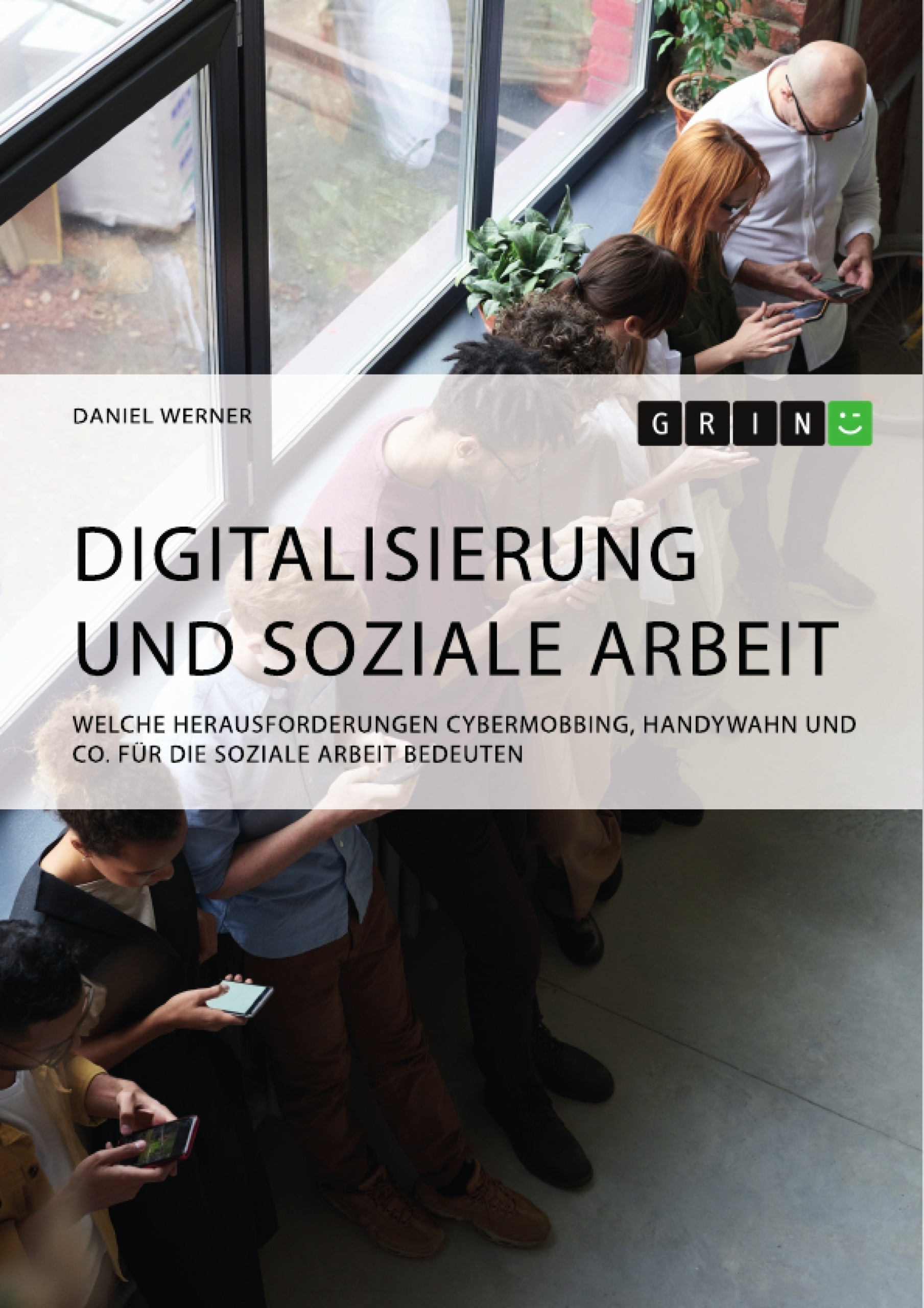Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll beantwortet werden, mit welchen Herausforderungen die Soziale Arbeit sich im Zuge der Digitalisierung konfrontiert sieht und wie die Fachkräfte der Sozialen Arbeit jene Herausforderungen bewältigen können. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Offene Kinder- und Jugendarbeit sowie die Schulsozialarbeit gelegt.
Daraus entwickelt sich folgende Fragestellung: Mit welchen Herausforderungen sieht sich die Sozialarbeit im Zuge der Digitalisierung konfrontiert? Ziel der Arbeit ist es, Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Herausforderungen einer sich rasant entwickelnden Digitalisierung aufzuzeigen. Anhand verschiedener Theorien können anschließend Adressaten (Jugendliche) der Sozialen Arbeit auf die Gefahren und Risiken der Digitalisierung aufmerksam gemacht und geschützt werden.
Die Gesellschaft befindet sich mit der Digitalisierung in einem starken Wandel. Speziell Jugendliche sind von dieser Entwicklung stark betroffen. Ob Facebook, Instagram oder Twitter; Soziale Netzwerke sind ein fester Bestandteil des Alltags von Jugendlichen geworden. Knapp 95 Prozent der Jugendlichen in der Altersgruppe der 12- bis 18-jährigen sind im Besitz eines Smartphones mit einer täglichen Dauer der Internetnutzung von knapp 205 Minuten. Oft sind Jugendliche sich nicht bewusst, welche Gefahren und Risiken sich bei einer dauerhaften Nutzung des Smartphones einstellen können.
Auch in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit, hat die Digitalisierung in den letzten Jahren Einzug gehalten. Fachkräfte sehen sich hier mit neuen Herausforderungen konfrontiert; Cyber-Mobbing sowie das Sucht- und Sozialverhalten von Jugendlichen durch die Smartphone Nutzung sind zwei Bereiche, die im Verlauf dieser Publikation näher untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Digitalisierung
- Entwicklung der Digitalisierung der letzten 50 Jahren
- Entstehung des Internets
- Soziale Netzwerke
- Gesellschaftliche Relevanz
- Positive/negative Faktoren der Digitalisierung
- Entwicklung der Digitalisierung der letzten 50 Jahren
- (Cyber)Mobbing
- Interpersonale Kommunikation
- Bedeutung von Klatsch in der sozialen Gesellschaft
- Auswirkungen von Cyber-Mobbing
- Internalisierende Auffälligkeiten
- Externalisierende Auffälligkeiten
- Rechtliche Grundlagen
- Lebensphase Jugend
- Übergang vom Kind zum Erwachsenen
- Sozialisation in der Lebensphase Jugend
- Handynutzungsverhalten bei Jugendlichen
- Generation Z
- Medienkompetenz
- Suchtverhalten von Jugendlichen beim Handykonsum
- Folgen von übermäßigem Handykonsum
- Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung in der Sozialen Arbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- Sozialisationsprozess im Zuge der Digitalisierung in der Sozialen Arbeit
- Weiterbildungsmaßnahmen für Sozialarbeiter*innen
- Handreichung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Herausforderungen der Digitalisierung für die Soziale Arbeit, insbesondere im Kontext der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Schulsozialarbeit. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Digitalisierung auf Jugendliche, insbesondere im Bereich des Cyber-Mobbings und des Handykonsums. Ziel ist es, Fachkräfte der Sozialen Arbeit auf die Gefahren und Risiken der Digitalisierung aufmerksam zu machen und ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um Jugendliche zu schützen und zu unterstützen.
- Entwicklung und Auswirkungen der Digitalisierung auf Jugendliche
- Cyber-Mobbing: Entstehung, Auswirkungen und rechtliche Grundlagen
- Handynutzungsverhalten bei Jugendlichen: Suchtverhalten und Folgen von übermäßigem Konsum
- Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Zuge der Digitalisierung
- Handlungsoptionen und Ressourcen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Digitalisierung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Digitalisierung in den letzten 50 Jahren, mit besonderem Fokus auf die Entstehung des Internets und der sozialen Netzwerke. Es werden die gesellschaftlichen Relevanzen dieser Entwicklungen sowie die positiven und negativen Faktoren der Digitalisierung diskutiert.
Kapitel 3: (Cyber)Mobbing
Kapitel 3 befasst sich mit dem Phänomen des Cyber-Mobbings. Es beschreibt die Entstehung von Cyber-Mobbing, analysiert die Auswirkungen auf Jugendliche, insbesondere auf die psychische Gesundheit und die soziale Interaktion, und beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des Themas.
Kapitel 4: Lebensphase Jugend
Dieses Kapitel betrachtet die Lebensphase Jugend im Kontext der Digitalisierung. Es analysiert den Übergang vom Kind zum Erwachsenenalter, die Sozialisationsprozesse in der heutigen digitalen Welt und das spezifische Handynutzungsverhalten von Jugendlichen, insbesondere der Generation Z. Die Bedeutung von Medienkompetenz für Jugendliche wird ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 5: Suchtverhalten von Jugendlichen beim Handykonsum
Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Suchtverhalten von Jugendlichen im Kontext des Handykonsums. Es werden Statistiken zum Handynutzungsverhalten von Jugendlichen aufgezeigt und die Folgen von übermäßigem Handykonsum für die körperliche und psychische Gesundheit analysiert.
Kapitel 6: Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung in der Sozialen Arbeit
Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen, denen sich die Soziale Arbeit im Zuge der Digitalisierung gegenübersteht. Es werden konkrete Handlungsfelder wie die Offene Kinder- und Jugendarbeit sowie die Schulsozialarbeit beleuchtet. Das Kapitel beleuchtet zudem den Sozialisationsprozess im Kontext der Digitalisierung und bietet Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit an. Darüber hinaus wird eine Handreichung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit vorgestellt, die als Orientierungshilfe im Umgang mit den Herausforderungen der Digitalisierung dienen soll.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der vorliegenden Bachelorarbeit umfassen Themenbereiche wie Digitalisierung, (Cyber)Mobbing, Handykonsum, Suchtverhalten, Medienkompetenz, Generation Z, Sozialisation, Jugend, Soziale Arbeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit sowie Schulsozialarbeit. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Herausforderungen der Digitalisierung für die Sozialarbeit im Kontext der Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen.
Welche digitalen Gefahren bedrohen Jugendliche heute?
Im Fokus stehen Cybermobbing, Handysucht sowie verändertes Sozialverhalten durch die permanente Nutzung sozialer Netzwerke wie Instagram oder Facebook.
Was sind die Folgen von Cybermobbing?
Cybermobbing führt oft zu internalisierenden Auffälligkeiten (z.B. Depressionen) oder externalisierenden Verhaltensweisen bei den betroffenen Jugendlichen.
Wie hoch ist die tägliche Internetnutzung bei 12- bis 18-Jährigen?
Laut der Arbeit verbringen Jugendliche in dieser Altersgruppe durchschnittlich etwa 205 Minuten pro Tag im Internet.
Welche Rolle spielt die Medienkompetenz?
Medienkompetenz ist entscheidend, damit Jugendliche Risiken im Netz erkennen und ihr Smartphone verantwortungsbewusst nutzen können.
Wie können Sozialarbeiter auf diese Herausforderungen reagieren?
Die Arbeit schlägt Weiterbildungsmaßnahmen und eine konkrete Handreichung vor, um Fachkräfte in der Offenen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit zu unterstützen.