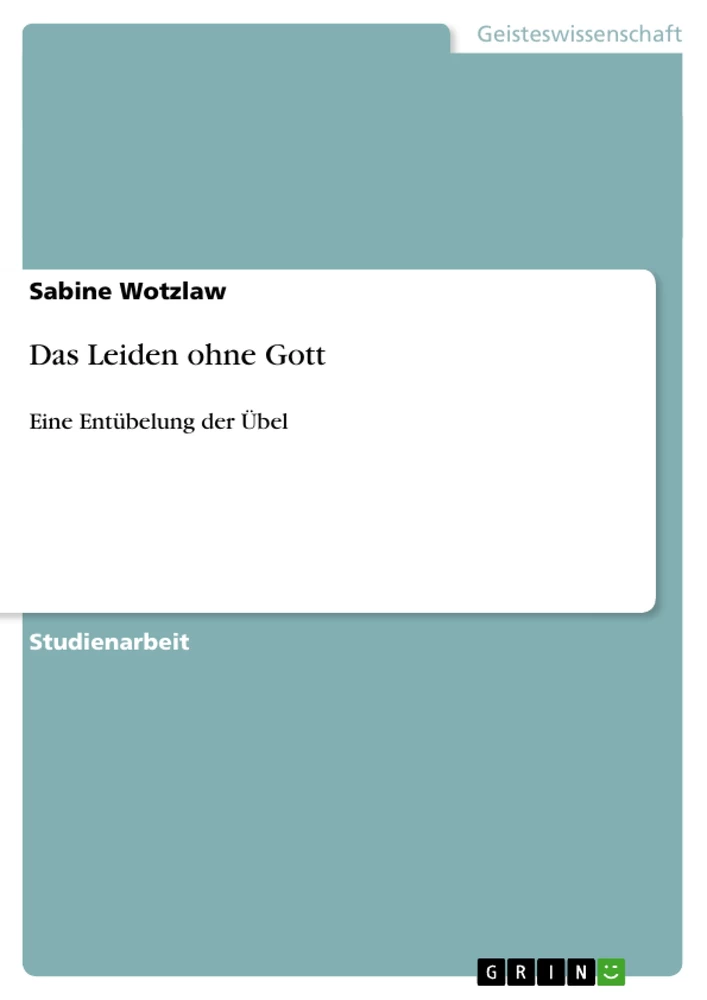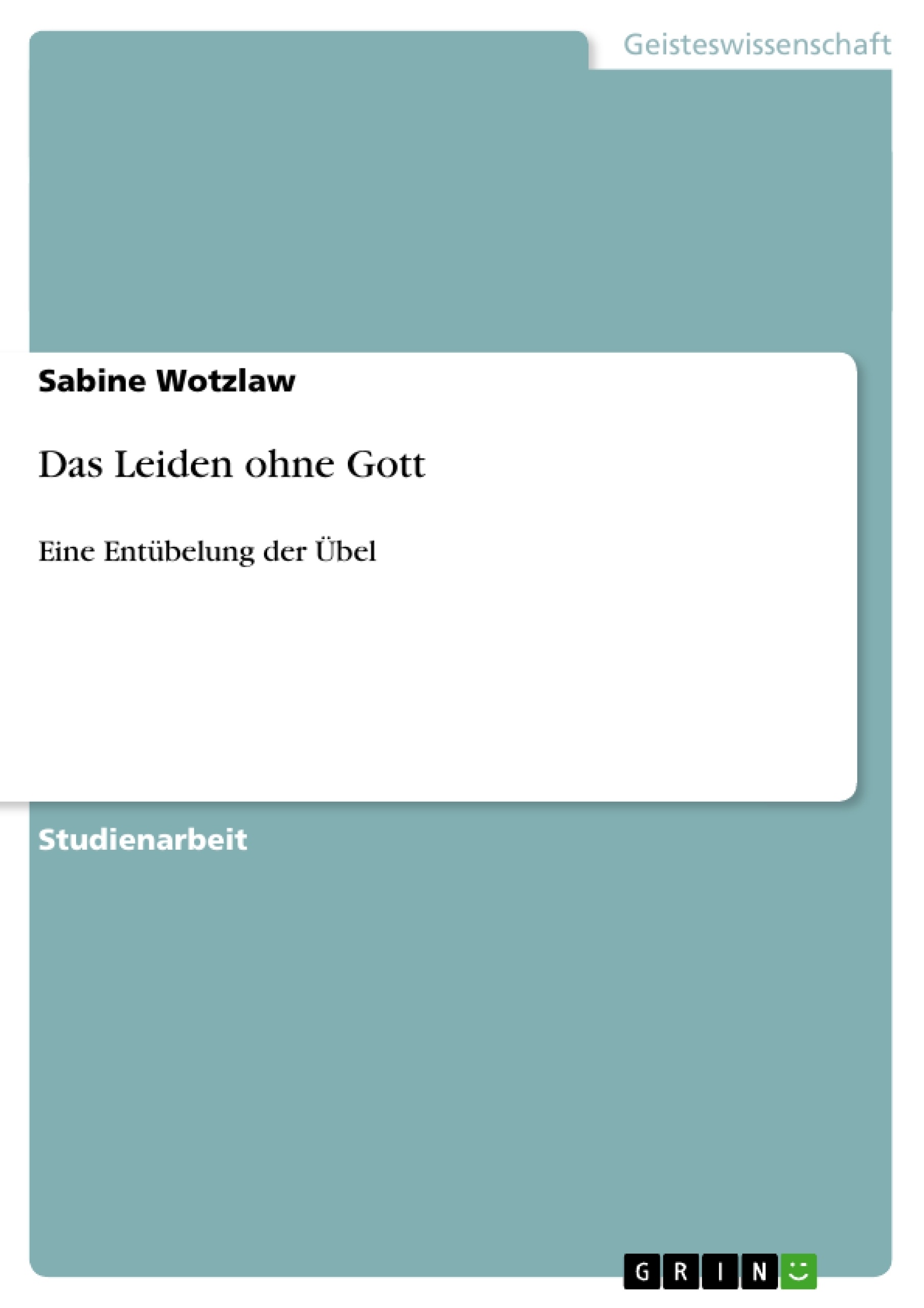Was hat es mit dem Menschen und seiner Welt auf sich? Gibt es gute Gründe dafür, das eigene Dasein in der Welt zu akzeptieren? Was ist der Mensch eigentlich? Dies sind die zentralen Fragen, mit denen sich die theologische Anthropologie auseinandersetzt. Die theologische Anthropologie beschäftigt sich mit den Aussagen der christlichen Glaubenslehre über den Menschen, erfragt deren inneren Zusammenhang und macht ihn dem heutigen Menschen zugänglich. Dabei beschäftigt sie sich insbesondere mit dem Wesen des Menschen und der Bestimmung des Menschen vor Gott. Denn der Mensch kann sich nur dann ganz verstehen, wenn er mehr als sich selbst versteht. Deshalb setzt die theologische Anthropologie beim Selbstverhältnis des Menschen an und zeigt auf, dass zu diesem Selbstverhältnis auch gehört, es zu transzendieren.
Schon immer stellt der Mensch den Anspruch, etwas Besonderes und Bedeutendes zu sein. Die neuzeitliche Wissenschaft allerdings zeigt, dass eine Sonderstellung des Menschen längst überholt ist.
Die theologische Anthropologie fragt aber nicht nur, was es mit dem Menschen auf sich hat, sondern auch, was es mit dem Übel und dem Leid auf sich hat. Fraglich ist auch, ob das Übel in der Welt mit oder ohne Gott gedacht werden muss, denn der biblische Ursprungsmythos ist in dieser Frage nicht eindeutig. In der folgenden Arbeit möchte ich zeigen, was ein ohne Gott gedachtes Übel für die Zustimmungsfähigkeit der Welt bedeutet. Im Mittelpunkt der Untersuchung soll die Frage stehen, ob ein non-theistischer Ansatz dazu in der Lage ist, das Leidvolle am Leiden auf den Begriff zu bringen. Ich werde zeigen, dass das Leiden ohne Gott gedacht, zu einer Entübelung der Übel führt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Leids und das Theodizeeproblem
- Biblisches Zeugnis zu Übel und Leid
- Übel und Leid in der Theologiegeschichte
- Systematische Deutung des Leidens mit und ohne Gott
- Abschließende Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Leids ohne Gott und dessen Auswirkungen auf die Akzeptanz der Welt. Sie befasst sich mit der Frage, ob ein non-theistischer Ansatz die Leidensdimensionen adäquat erfassen kann.
- Das Leid ohne Gott
- Das Theodizeeproblem
- Die Zustimmungsfähigkeit der Welt
- Die Entübelung des Leids
- Systematische Deutung des Leids
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die zentrale Frage nach dem Wesen und der Bestimmung des Menschen. Sie befasst sich mit der Frage, ob der Mensch in der modernen Welt angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Evolution und die Naturalisierung menschlicher Subjektivität noch eine besondere Stellung einnimmt.
Der Begriff des Leids und das Theodizeeproblem
Dieses Kapitel definiert den Begriff des Leids und differenziert zwischen verschiedenen Leidensdimensionen. Es beleuchtet die Rolle des Leids in der Menschheitsgeschichte und in der Theologie. Dabei wird das Theodizeeproblem als das zentrale Argument gegen die Existenz Gottes beleuchtet.
Biblisches Zeugnis zu Übel und Leid
Dieser Abschnitt analysiert die biblischen Überlieferungen zum Leid und untersucht verschiedene Deutungen und Bewältigungsversuche. Dabei werden die spezifischen Erfahrungen des Leidens im Alten Testament beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die theologische Anthropologie?
Sie befasst sich mit dem Wesen und der Bestimmung des Menschen aus christlicher Sicht und fragt nach dem Selbstverhältnis des Menschen vor Gott.
Was ist das Theodizeeproblem?
Es ist die klassische Frage, wie das Übel und das Leid in der Welt mit der Existenz eines gütigen und allmächtigen Gottes vereinbar sind.
Was bedeutet „Entübelung der Übel“ in einem non-theistischen Ansatz?
Die Arbeit argumentiert, dass Leid ohne Gott gedacht seine tiefere moralische Dimension verlieren könnte und lediglich als natürliches Phänomen ohne transzendenten Sinn erscheint.
Wie geht die moderne Wissenschaft mit der Sonderstellung des Menschen um?
Die neuzeitliche Wissenschaft sieht die Sonderstellung des Menschen oft als überholt an und ordnet ihn rein biologisch-evolutionär in die Natur ein.
Welche Rolle spielt das Alte Testament für das Verständnis von Leid?
Das biblische Zeugnis bietet verschiedene Deutungen und Bewältigungsversuche für menschliches Leid, die in der Arbeit systematisch analysiert werden.
- Quote paper
- Sabine Wotzlaw (Author), 2005, Das Leiden ohne Gott, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94348