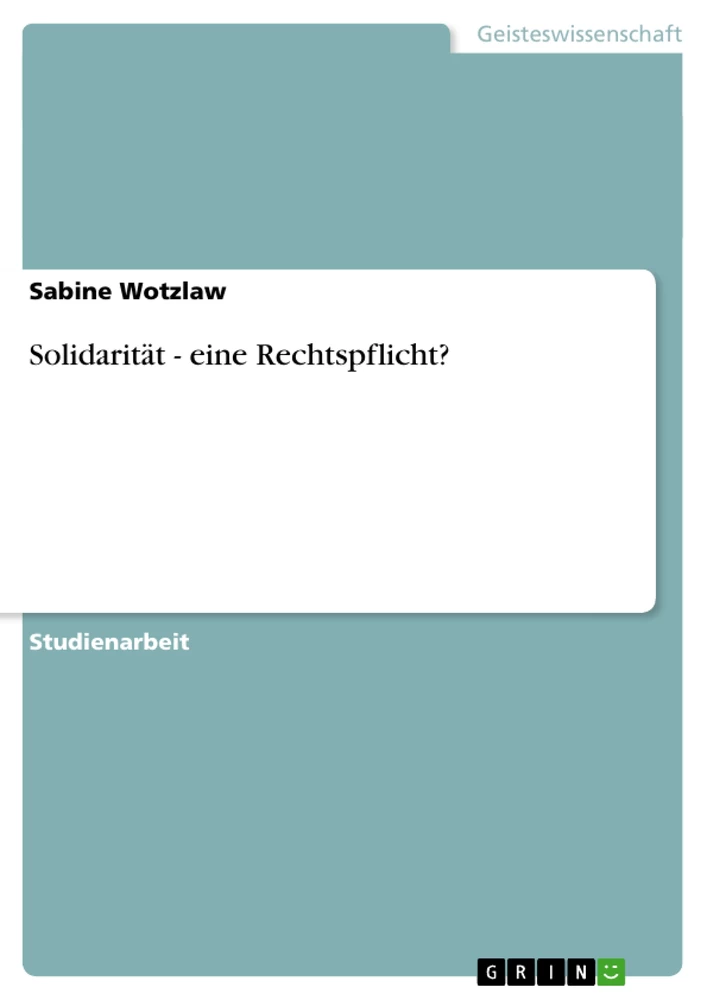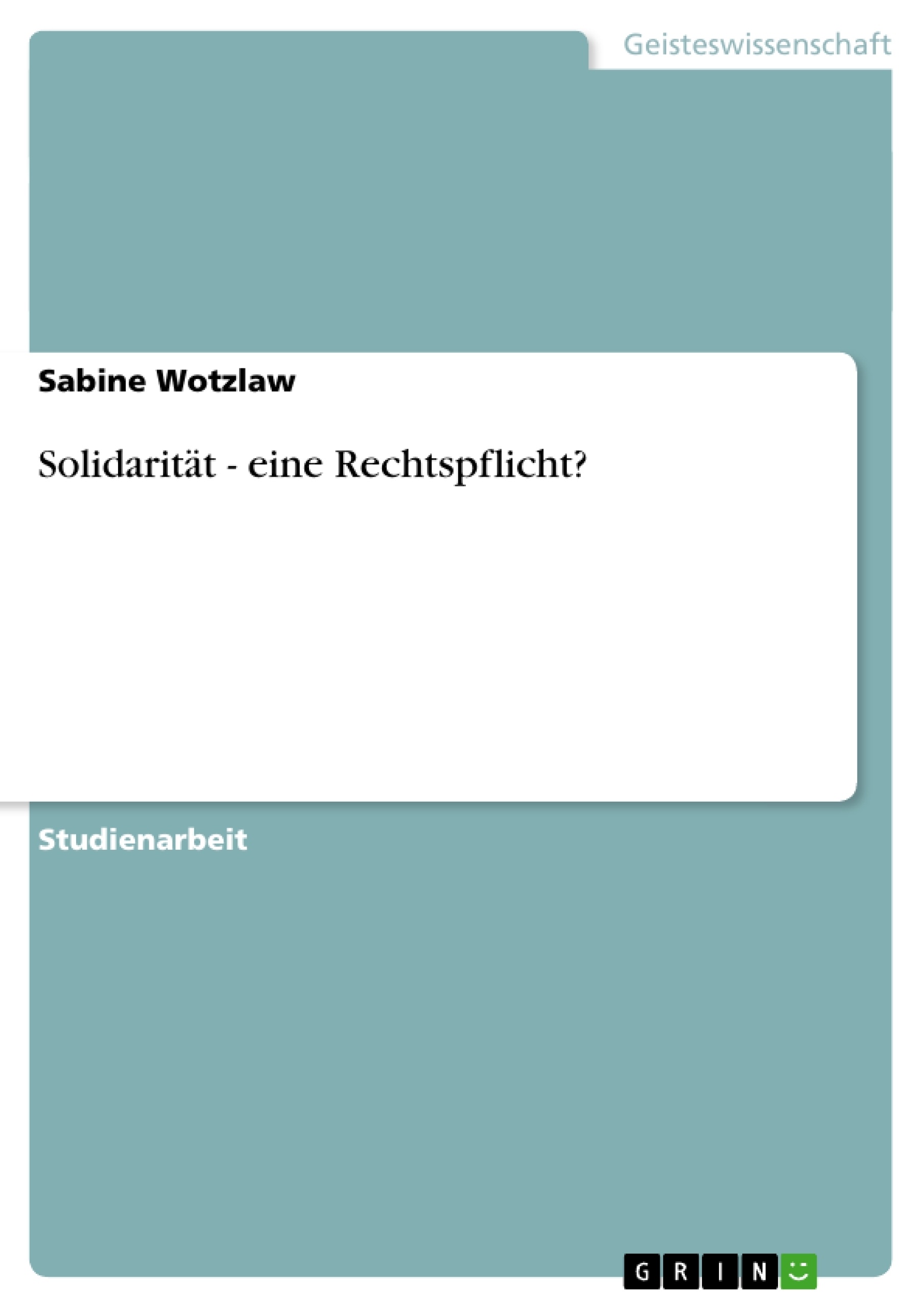Was ist gemeint, wenn von Solidarität die Rede ist? In der Alltagssprache bedeutet Solidarität die wechselseitige Verpflichtung oder Bereitschaft, füreinander einzustehen. Solidarität bedeutet heute das Gefühl der Verpflichtung, anderen zu helfen. Besonders Arme, Alte, Behinderte, Menschen in Entwicklungsländern und Opfer von Menschenrechtsverletzungen sind Gegenstand der gesellschaftlichen Solidarität. Geholfen wird hier nicht aufgrund gemeinsamer Interessen, sondern weil man die Anliegen dieser Menschen für gerechtfertigt hält. Die Grundlage für das Solidaritätsprinzip bildet das Personalitätsprinzip. Während das Personalitätsprinzip den prinzipiellen Rechtsanspruch jedes Menschen als Person entfaltet, geht es im Solidaritätsprinzip um die diesen Rechtsanspruch entsprechenden Pflichten, die sich innerhalb der Rechtsgemeinschaft für jeden einzelnen sowie für die ganze Rechtsgemeinschaft ergeben. Doch worin liegen die Legitimationsgründe für diese Verpflichtungen, die mit der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft verbunden sind oder verbunden sein sollen? Zunächst müssen geeignete Prinzipien gesucht werden, die zusammen mit dieser Zugehörigkeit eine partikulare Pflicht rechtfertigen können, denn in der Tatsache der Zugehörigkeit liegt noch keine moralische Begründung für solche Verpflichtungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wortbedeutung von Solidarität
- Die Solidaritätsforderung in der Geschichte
- Theoriegeschichtlicher Überblick
- Das Solidaritätsprinzip in der katholischen Soziallehre
- Systematische Begründung von Solidarität
- Abschließende Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Solidarität als Rechtspflicht in der Gesellschaft, insbesondere im Sozialstaat, zu verankern ist. Die Arbeit untersucht die Legitimationsgründe für eine solche Verpflichtung und analysiert, ob und inwiefern Solidarität als Rechtspflicht die Würde des Menschen gerecht werden kann.
- Die Bedeutung des Solidaritätsprinzips in der Geschichte und in der katholischen Soziallehre
- Die ethische Dimension von Solidarität als Rechtspflicht
- Die Rolle des Sozialstaates und seine Fähigkeit, Solidarität zu gewährleisten
- Die Verbindung von Solidarität und Menschenwürde
- Die potenziellen Defizite von alleiniger Rechtspflicht im Vergleich zu einer von Gesinnung geleiteten Solidarität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Begriff der Solidarität in der Alltagssprache und untersucht die Verbindung zwischen Solidarität und dem Personalitätsprinzip. Die Arbeit stellt die Frage nach der moralischen Begründung von Solidaritätsverpflichtungen innerhalb einer Gemeinschaft und beleuchtet die Verbindung von Hilfe und Gerechtigkeit. Sie stellt außerdem die Frage, inwieweit Solidarität als Recht forderbar ist und wie ein Sozialstaat gleichzeitig gerecht und gerechtfertigt ist.
Wortbedeutung von Solidarität: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der sprachlichen Herkunft des Begriffs "Solidarität" und erläutert, wie er sich in den verschiedenen Kontexten der Geschichte entwickelt hat. Er beleuchtet die Verbindung von Solidarität zu gemeinsamen Zielen und der Bereitschaft, sich für die Interessen anderer einzusetzen.
Die Solidaritätsforderung in der Geschichte: Dieser Abschnitt betrachtet die historische Entwicklung der Solidaritätsforderung, insbesondere in Bezug auf die französische Revolution und die Entstehung der Idee einer staatlichen Subsistenzgarantie.
Schlüsselwörter
Solidarität, Rechtspflicht, Sozialstaat, Menschenwürde, Personalitätsprinzip, Geschichte, katholische Soziallehre, Gerechtigkeit, Wohltätigkeit, Subsistenzgarantie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Solidarität in der Alltagssprache?
In der Alltagssprache steht Solidarität für die wechselseitige Verpflichtung oder Bereitschaft, füreinander einzustehen und anderen (z. B. Armen oder Benachteiligten) zu helfen.
Was ist die Grundlage des Solidaritätsprinzips?
Die Grundlage bildet das Personalitätsprinzip, welches den Rechtsanspruch jedes Menschen als Person entfaltet.
Kann Solidarität eine Rechtspflicht sein?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Solidarität im Sozialstaat als Rechtspflicht verankert werden kann und welche moralischen Legitimationsgründe dafür existieren.
Welche Rolle spielt die katholische Soziallehre beim Thema Solidarität?
Das Solidaritätsprinzip ist ein Kernbestandteil der katholischen Soziallehre und wird dort als ethische Verpflichtung innerhalb der Rechtsgemeinschaft begründet.
Was ist der Unterschied zwischen Solidarität und Wohltätigkeit?
Solidarität basiert oft auf Gerechtigkeitsansprüchen und gegenseitiger Verpflichtung innerhalb einer Gemeinschaft, während Wohltätigkeit eher auf freiwilliger Hilfe beruht.
- Arbeit zitieren
- Sabine Wotzlaw (Autor:in), 2006, Solidarität - eine Rechtspflicht?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94350