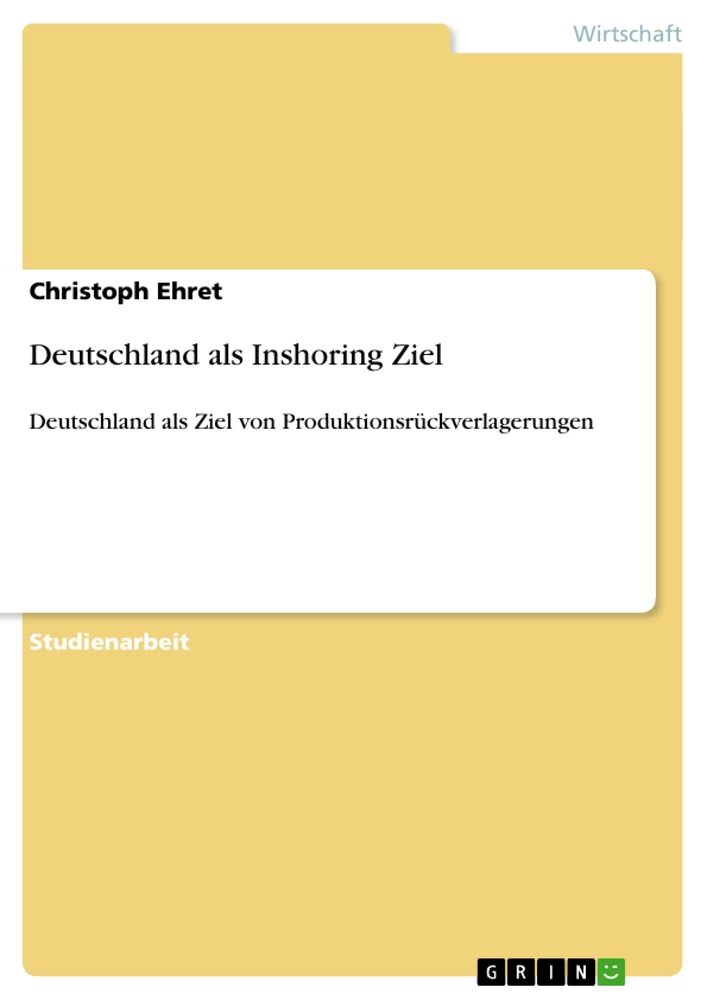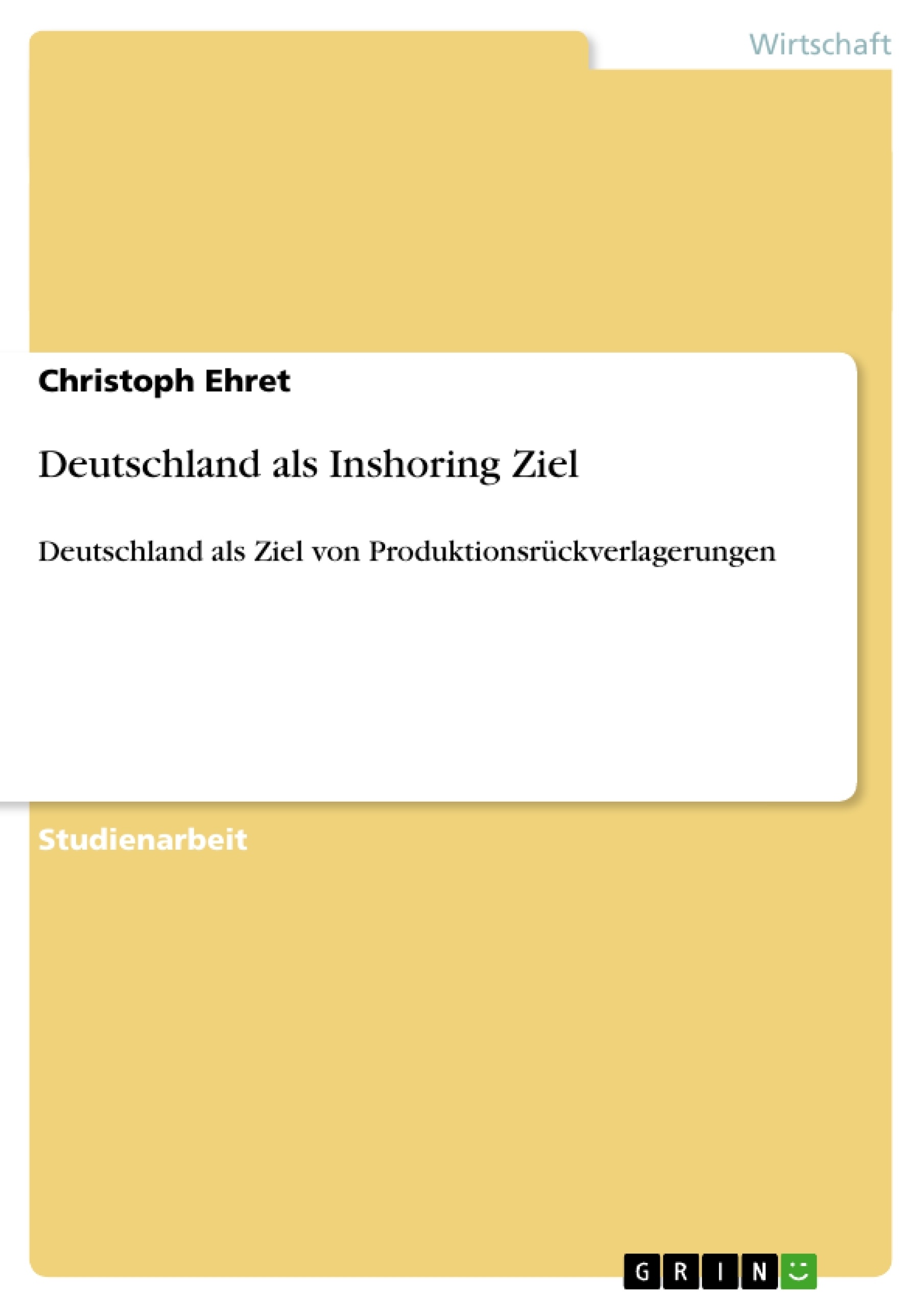Das Thema Produktionsverlagerung wird in Deutschland viel diskutiert, da mit einer Verlagerungsentscheidung meist der Wegfall von Arbeitsplätzen verbunden ist. Diese Verlagerungen werden in der medialen Darstellung und der Bewertung in der Öffentlichkeit in einem negativen Bild gesehen. Als viel beachtetes und kontrovers diskutiertes Beispiel lässt sich die Verlagerungsentscheidung des finnischen Mobilfunkgeräteherstellers Nokia anführen, die zur Schließung des Werksstandortes in Bochum und damit zum Wegfall von 2.300 Arbeitsplätzen führen wird. Doch im direkten Gegenzug kündigen andere Hightech-Unternehmen wie Rolls-Royce oder GlaxoSmithKline an, große Investitionsvolumina am Standort Deutschland zu tätigen. Die folgende Arbeit beleuchtet das Phänomen der Rückverlagerung in der sozialen Marktwirtschaft, d.h. inwieweit der Staat als treibende Kraft in der sozialen Marktwirtschaft den bestehenden Rahmen für Rückverlagerungen beeinflussen und verbessern kann. Zunächst wird das Phänomen der Rückverlagerung definiert und in seiner Form und Phasen beschrieben. Dann werden basierend auf theoretischen Erklärungsansätzen Ausmaß und Argumente für Ver- und Rückverlagerungen offen gelegt. Diese Argumente werden anhand des Beispiels eines deutschen Rückverlagerers in der Praxis beschrieben. Abschließend werden einige Probleme des Standortes Deutschland im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft aufgezeigt und Handlungsempfehlungen herausgearbeitet, die den Standort Deutschland und die Bedingungen für Rückverlagerungen verbessern könnten. Zu bemerken ist, dass auf die Thematik der Rückverlagerungsthese im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen wird, da sie kontrovers diskutiert wird und bisher nicht empirisch belegt werden konnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Phänomen der Rückverlagerung
- 2.1 Definition von Rückverlagerung und Abgrenzung des Begriffs
- 2.2 Formen der Rückverlagerung
- 2.3 Phasen der Rückverlagerung
- 3 Theoretische Erklärungsansätze für Rückverlagerung
- 3.1 Theorie der internationalen Arbeitsteilung
- 3.2 Standortfaktorensystematik
- 4 Deutschland als Inshoring-Ziel
- 4.1 Verlagerung nach und Rückverlagerung aus Deutschland
- 4.1.1 Fakten zur Verlagerung von Wertschöpfung aus Deutschland
- 4.1.2 Fakten zur Rückverlagerung von Wertschöpfung nach Deutschland
- 4.2 Argumente für Ver- und Rückverlagerungsentscheidungen
- 4.2.1 Argumente für die Verlagerung von Produktion
- 4.2.2 Argumente für die Rückverlagerung
- 4.2.2.1 Rückverlagerung als Korrektur einer falschen Standortwahl
- 4.2.2.2 Rückverlagerung als bewusste Entscheidung für den Standort Deutschland
- 4.3 Praxisbeispiel Lemken GmbH & Co. KG
- 4.1 Verlagerung nach und Rückverlagerung aus Deutschland
- 5 Rückverlagerung und die Soziale Marktwirtschaft
- 5.1 Definition Soziale Marktwirtschaft
- 5.2 Probleme am Standort Deutschland
- 5.3 Stärkung des Standortes Deutschland und Förderung der Rückverlagerung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Rückverlagerung von Produktionsprozessen nach Deutschland im Kontext der sozialen Marktwirtschaft. Ziel ist es, die Faktoren zu analysieren, die Verlagerungen ins Ausland und anschließende Rückverlagerungen beeinflussen, und Handlungsempfehlungen für die Stärkung des deutschen Produktionsstandorts zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Rückverlagerung"
- Theoretische Erklärungsansätze für Verlagerungs- und Rückverlagerungsentscheidungen
- Faktoren, die für Verlagerungen aus und Rückverlagerungen nach Deutschland sprechen
- Die Rolle der sozialen Marktwirtschaft bei der Förderung von Rückverlagerungen
- Herausforderungen und Chancen des Standorts Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Produktionsverlagerungen und Rückverlagerungen ein und hebt die Bedeutung des Themas im Kontext von Arbeitsplatzabbau und wirtschaftlicher Entwicklung hervor. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Rückverlagerung in der sozialen Marktwirtschaft und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von der Definition des Phänomens über theoretische Erklärungsansätze bis hin zu Handlungsempfehlungen reicht. Der kontroversen Debatte um die Rückverlagerungsthese wird explizit Beachtung geschenkt und deren empirische Unbelegtheit wird erwähnt.
2 Das Phänomen der Rückverlagerung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Rückverlagerung, grenzt ihn von ähnlichen Begriffen wie Insourcing, Backsourcing und Disinvestment ab, und beschreibt verschiedene Formen und Phasen des Rückverlagerungsprozesses. Es konzentriert sich auf Rückverlagerungen im Produktionsbereich und erläutert die verschiedenen Formen der Rückverlagerung bezüglich betroffener Funktionsbereiche, sowie direkte und indirekte Rückverlagerungsentscheidungen. Die Prozessphasen werden im Detail beschrieben: die Verlagerungsphase, die Auslandsproduktionsphase und die Rückverlagerungsphase, inklusive der verschiedenen Arten von Verlagerungsentscheidungen (additiv, komplementär, substitutiv).
3 Theoretische Erklärungsansätze für Rückverlagerung: Dieses Kapitel erläutert theoretische Modelle zur Erklärung von Verlagerungs- und Rückverlagerungsentscheidungen. Es bezieht sich auf die Theorie der internationalen Arbeitsteilung und die Standortfaktorentheorie. Es wird auf das Neofaktor-Proportionen-Theorem von Balassa eingegangen, welches die Heterogenität des Produktionsfaktors Arbeit und die komparativen Kostenvorteile humankapitalreicher Länder im Export humankapitalintensiver Güter beschreibt. Das Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der ökonomischen Kräfte, die hinter den Standortentscheidungen stehen.
4 Deutschland als Inshoring-Ziel: Kapitel 4 analysiert Deutschland als Ziel für Rückverlagerungen. Es untersucht sowohl die Verlagerung von Wertschöpfung aus Deutschland als auch die Rückverlagerung nach Deutschland, beleuchtet die Argumente für Verlagerungs- und Rückverlagerungsentscheidungen, und stellt ein Praxisbeispiel vor (Lemken GmbH & Co. KG). Es wird detailliert auf die Gründe für Verlagerungen (z.B. niedrigere Lohnkosten) und Rückverlagerungen (z.B. Qualität, Nähe zu Kunden) eingegangen und diese anhand von Beispielen und Daten verdeutlicht. Die Korrektur falscher Standortwahl und die bewusste Entscheidung für den Standort Deutschland werden als wichtige Motive für Rückverlagerungen herausgestellt.
5 Rückverlagerung und die Soziale Marktwirtschaft: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der sozialen Marktwirtschaft auf Rückverlagerungsentscheidungen. Es definiert die soziale Marktwirtschaft, analysiert Probleme des Standorts Deutschland und erarbeitet Handlungsempfehlungen zur Stärkung des Standortes und zur Förderung von Rückverlagerungen. Das Kapitel betrachtet die Herausforderungen und Chancen für Deutschland im globalen Wettbewerb und schlägt Maßnahmen vor, um das Land attraktiver für Unternehmen zu machen, die ihre Produktion zurück nach Deutschland verlagern möchten.
Schlüsselwörter
Rückverlagerung, Inshoring, Produktionsverlagerung, Standortentscheidung, Soziale Marktwirtschaft, internationale Arbeitsteilung, Standortfaktoren, Deutschland, Wertschöpfung, Komparative Kostenvorteile, Humankapital.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Rückverlagerung von Produktionsprozessen nach Deutschland im Kontext der sozialen Marktwirtschaft
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen der Rückverlagerung von Produktionsprozessen nach Deutschland im Kontext der sozialen Marktwirtschaft. Sie analysiert die Faktoren, die Verlagerungen ins Ausland und anschließende Rückverlagerungen beeinflussen, und entwickelt Handlungsempfehlungen zur Stärkung des deutschen Produktionsstandorts.
Was wird unter „Rückverlagerung“ verstanden und wie wird der Begriff abgegrenzt?
Der Begriff „Rückverlagerung“ wird präzise definiert und von ähnlichen Begriffen wie Insourcing, Backsourcing und Disinvestment abgegrenzt. Die Arbeit beschreibt verschiedene Formen und Phasen des Rückverlagerungsprozesses, fokussiert auf den Produktionsbereich und unterscheidet zwischen direkten und indirekten Rückverlagerungsentscheidungen sowie verschiedenen Funktionsbereichen.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Erklärung von Rückverlagerungen herangezogen?
Die Arbeit erläutert theoretische Modelle, insbesondere die Theorie der internationalen Arbeitsteilung und die Standortfaktorentheorie. Das Neofaktor-Proportionen-Theorem von Balassa wird ebenfalls behandelt, um die komparativen Kostenvorteile humankapitalreicher Länder zu erklären.
Welche Rolle spielt Deutschland als Ziel für Rückverlagerungen?
Kapitel 4 analysiert Deutschland als Ziel für Rückverlagerungen, indem es Verlagerungen aus und Rückverlagerungen nach Deutschland untersucht. Es werden Argumente für beide Arten von Entscheidungen beleuchtet, unterstützt durch Beispiele und Daten. Die Korrektur falscher Standortwahl und die bewusste Entscheidung für den Standort Deutschland werden als wichtige Motive für Rückverlagerungen hervorgehoben. Ein Praxisbeispiel (Lemken GmbH & Co. KG) veranschaulicht die Thematik.
Wie beeinflusst die Soziale Marktwirtschaft Rückverlagerungsentscheidungen?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der sozialen Marktwirtschaft auf Rückverlagerungsentscheidungen. Sie definiert die soziale Marktwirtschaft, analysiert Probleme des Standorts Deutschland und entwickelt Handlungsempfehlungen zur Stärkung des Standorts und zur Förderung von Rückverlagerungen. Herausforderungen und Chancen für Deutschland im globalen Wettbewerb werden betrachtet und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität für Unternehmen vorgeschlagen.
Welche Phasen werden im Rückverlagerungsprozess unterschieden?
Der Rückverlagerungsprozess wird in verschiedene Phasen unterteilt: die Verlagerungsphase, die Auslandsproduktionsphase und die Rückverlagerungsphase. Die Arbeit beschreibt die verschiedenen Arten von Verlagerungsentscheidungen (additiv, komplementär, substitutiv).
Welche Argumente sprechen für Verlagerungen aus und Rückverlagerungen nach Deutschland?
Die Arbeit beleuchtet detailliert die Gründe für Verlagerungen (z.B. niedrigere Lohnkosten) und Rückverlagerungen (z.B. Qualität, Nähe zu Kunden). Diese Argumente werden anhand von Beispielen und Daten verdeutlicht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rückverlagerung, Inshoring, Produktionsverlagerung, Standortentscheidung, Soziale Marktwirtschaft, internationale Arbeitsteilung, Standortfaktoren, Deutschland, Wertschöpfung, Komparative Kostenvorteile, Humankapital.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit entwickelt Handlungsempfehlungen zur Stärkung des deutschen Produktionsstandorts und zur Förderung von Rückverlagerungen. Diese Empfehlungen zielen darauf ab, Deutschland im globalen Wettbewerb attraktiver für Unternehmen zu machen, die ihre Produktion zurück nach Deutschland verlagern möchten.
Gibt es ein Praxisbeispiel?
Ja, die Arbeit präsentiert ein Praxisbeispiel der Lemken GmbH & Co. KG, um die Thematik der Rückverlagerung zu veranschaulichen.
- Arbeit zitieren
- Christoph Ehret (Autor:in), 2008, Deutschland als Inshoring Ziel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94386