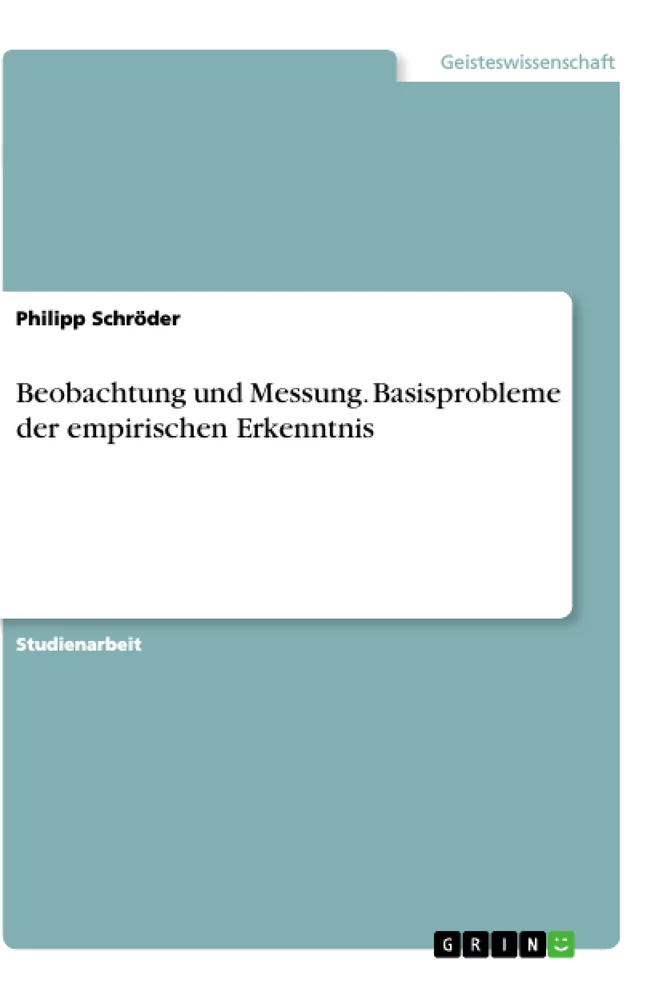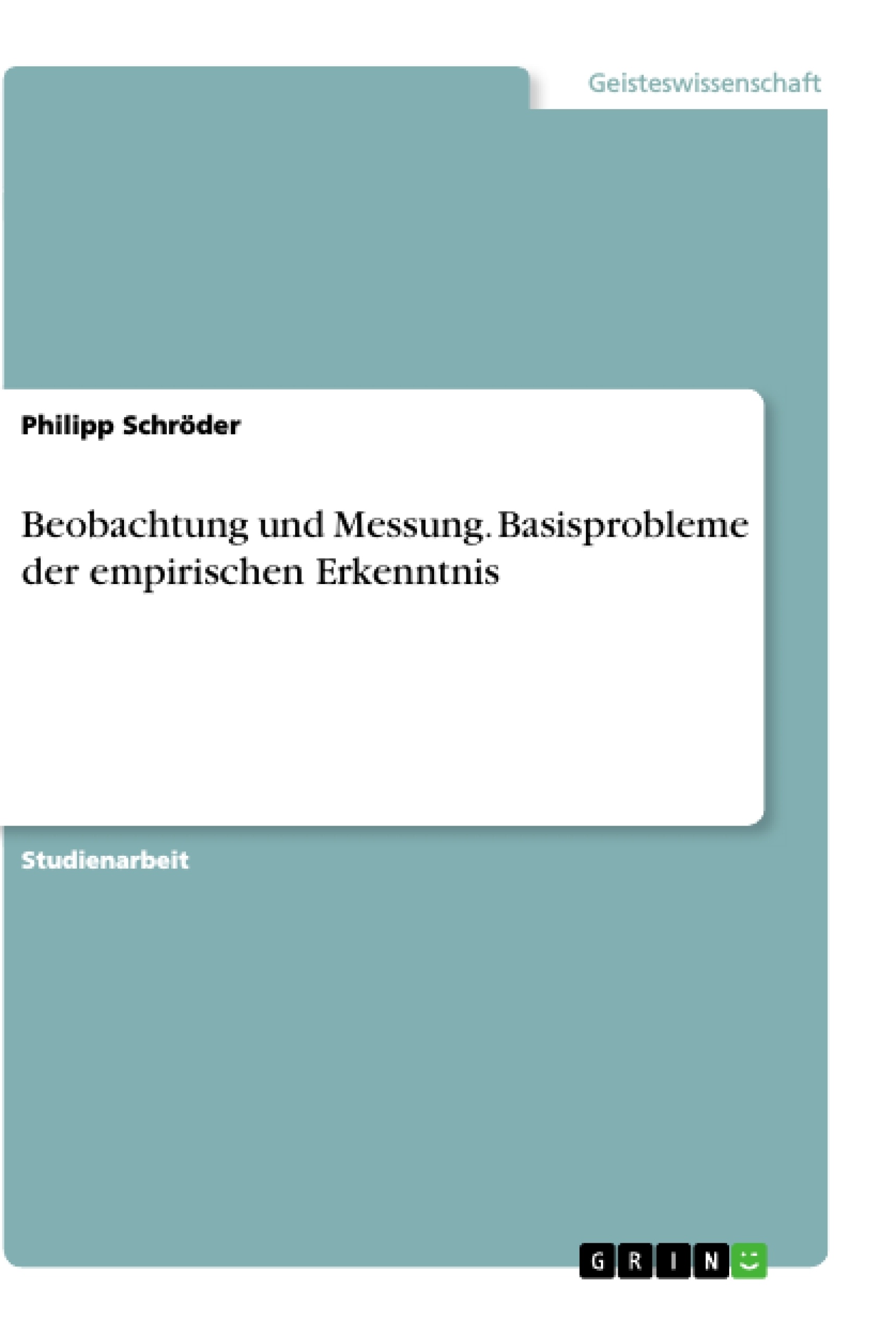Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der Wissenschaftstheorie, wobei Bezüge zur verwandten Literatur und eigene Beispiele zur Vorstellung des Themas genutzt werden. Übergreifendes Theme sind Probleme der empirischen Erkenntnisse.
Zunächst erfolgt eine Einordnung und Charakterisierung der Wissenschaftstheorie, wobei insbesondere der Induktivismus und Falsifikationismus näher beschrieben wird. An-schließend werden in jeweils einem Kapitel der Stellenwert und die Problematik von Beobachtungen und Messungen zur Schaffung wissenschaftlicher Erkenntnis betrachtet. Abschließend wird die "Zwei-Stufen-Konzeption" der Wissenschaftssprache vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Wissenschaftstheorie
- 2.2 Historische Entwicklung der Wissenschaftstheorie
- 2.3 Induktivismus und Falsifikationismus
- 3 Beobachtungen
- 3.1 Normalform einer Beobachtungsaussage
- 3.2 Die Rolle von Beobachtungsaussagen in der Alltagslogik
- 3.3 Beobachtung und Interpretation
- 3.4 Methodologische Konsequenz
- 4 Messungen
- 4.1 Messmodelle und Skalentypen
- 4.2 Zwei Arten von Messfehlern
- 4.3 Methodologische Konsequenz
- 5 Zerlegung der Wissenschaftssprache
- 5.1 Die „Zwei-Stufen-Konzeption“
- 5.2 Probleme und Kritik an der Zerlegung
- 6 Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Basisprobleme der empirischen Erkenntnis im Kontext von Beobachtung und Messung. Sie beleuchtet die wissenschaftstheoretischen Grundlagen, insbesondere den Induktivismus und Falsifikationismus, und analysiert deren Rolle bei der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Arbeit basiert auf dem Kapitel "Beobachtung und Messung" aus dem Buch "Wissenschaftliche Erkenntnis: eine ideengeschichtliche Einführung in die Wissenschaftstheorie" von Lauth und Sareiter.
- Wissenschaftstheoretische Grundlagen und deren historische Entwicklung
- Der Stellenwert und die Problematik von Beobachtungen in der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung
- Die Rolle von Messungen und deren Fehlerquellen in der empirischen Forschung
- Analyse der "Zwei-Stufen-Konzeption" der Wissenschaftssprache
- Vergleich und Kritik verschiedener wissenschaftstheoretischer Positionen (Induktivismus, Falsifikationismus)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Seminararbeit, die im Rahmen des Moduls "Wissenschaftstheorie und Wirtschaftsethik" entstanden ist. Sie legt den Fokus auf den wissenschaftstheoretischen Aspekt und benennt die Quelle der Arbeit, das Buch von Lauth und Sareiter. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Wissenschaftstheorie einordnet, Beobachtung und Messung analysiert und die "Zwei-Stufen-Konzeption" der Wissenschaftssprache vorstellt.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Wissenschaftstheorie als Teilbereich der Philosophie. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Wissenschaftstheorie, unterteilt in vier Phasen nach Hoyningen-Huene, die jeweils unterschiedliche Verständnisse von Wissenschaft repräsentieren. Besonders werden die deduktiven und induktiven Methoden sowie die Entwicklung vom Verständnis von Wissen als absolut sicher hin zu der Erkenntnis, dass Wissen revidierbar ist, hervorgehoben. Der Abschnitt legt die Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit Beobachtung und Messung.
2.3 Induktivismus und Falsifikationismus: Dieser Unterabschnitt vergleicht die beiden zentralen wissenschaftstheoretischen Ansätze, den Induktivismus und den Falsifikationismus. Der Induktivismus wird als ein Ansatz beschrieben, der wissenschaftliche Erkenntnis aus Beobachtungen ableitet, während der Falsifikationismus, vor allem durch Popper geprägt, die Überprüfung von Theorien durch empirische Daten betont. Der Unterschied zwischen Verifikation und Falsifikation wird deutlich gemacht. Ein Beispiel veranschaulicht die Anwendung des Falsifikationismus, wobei die Fehleranfälligkeit empirischer Daten und die Abhängigkeit von theoretischen Annahmen hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Wissenschaftstheorie, Empirische Erkenntnis, Beobachtung, Messung, Induktivismus, Falsifikationismus, Wissenschaftssprache, Zwei-Stufen-Konzeption, Methodologie, Erkenntnisgewinnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Beobachtung und Messung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Basisprobleme der empirischen Erkenntnisgewinnung im Kontext von Beobachtung und Messung. Sie analysiert die wissenschaftstheoretischen Grundlagen, insbesondere Induktivismus und Falsifikationismus, und deren Rolle bei der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Arbeit stützt sich auf das Kapitel "Beobachtung und Messung" aus dem Buch "Wissenschaftliche Erkenntnis: eine ideengeschichtliche Einführung in die Wissenschaftstheorie" von Lauth und Sareiter.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Wissenschaftstheoretische Grundlagen und deren historische Entwicklung; Der Stellenwert und die Problematik von Beobachtungen in der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung; Die Rolle von Messungen und deren Fehlerquellen in der empirischen Forschung; Analyse der "Zwei-Stufen-Konzeption" der Wissenschaftssprache; Vergleich und Kritik verschiedener wissenschaftstheoretischer Positionen (Induktivismus, Falsifikationismus).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen der Wissenschaftstheorie (inklusive Induktivismus und Falsifikationismus), ein Kapitel zu Beobachtungen (Normalform, Rolle in der Alltagslogik, Interpretation und methodologische Konsequenzen), ein Kapitel zu Messungen (Messmodelle, Skalentypen, Fehlerquellen und methodologische Konsequenzen), ein Kapitel zur Zerlegung der Wissenschaftssprache ("Zwei-Stufen-Konzeption" und Kritik) und abschließend eine Zusammenfassung und ein Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im Originaldokument.
Was sind die zentralen wissenschaftstheoretischen Ansätze, die in der Arbeit verglichen werden?
Die Arbeit vergleicht den Induktivismus und den Falsifikationismus. Der Induktivismus leitet wissenschaftliche Erkenntnis aus Beobachtungen ab, während der Falsifikationismus die Überprüfung von Theorien durch empirische Daten betont. Der Unterschied zwischen Verifikation und Falsifikation wird herausgestellt.
Welche Rolle spielen Beobachtung und Messung in der Arbeit?
Beobachtung und Messung stehen im Zentrum der Arbeit. Analysiert werden die Problematik von Beobachtungen (Interpretation, Fehleranfälligkeit), die Rolle von Messungen und deren Fehlerquellen sowie die methodologischen Konsequenzen beider Aspekte für die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung.
Was ist die "Zwei-Stufen-Konzeption" der Wissenschaftssprache?
Die Arbeit analysiert die "Zwei-Stufen-Konzeption" der Wissenschaftssprache, wobei die Probleme und die Kritik an diesem Konzept dargelegt werden. Details hierzu sind im entsprechenden Kapitel der Seminararbeit nachzulesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wissenschaftstheorie, Empirische Erkenntnis, Beobachtung, Messung, Induktivismus, Falsifikationismus, Wissenschaftssprache, Zwei-Stufen-Konzeption, Methodologie, Erkenntnisgewinnung.
Welche Quelle wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Kapitel "Beobachtung und Messung" aus dem Buch "Wissenschaftliche Erkenntnis: eine ideengeschichtliche Einführung in die Wissenschaftstheorie" von Lauth und Sareiter.
- Quote paper
- Philipp Schröder (Author), 2020, Beobachtung und Messung. Basisprobleme der empirischen Erkenntnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944223