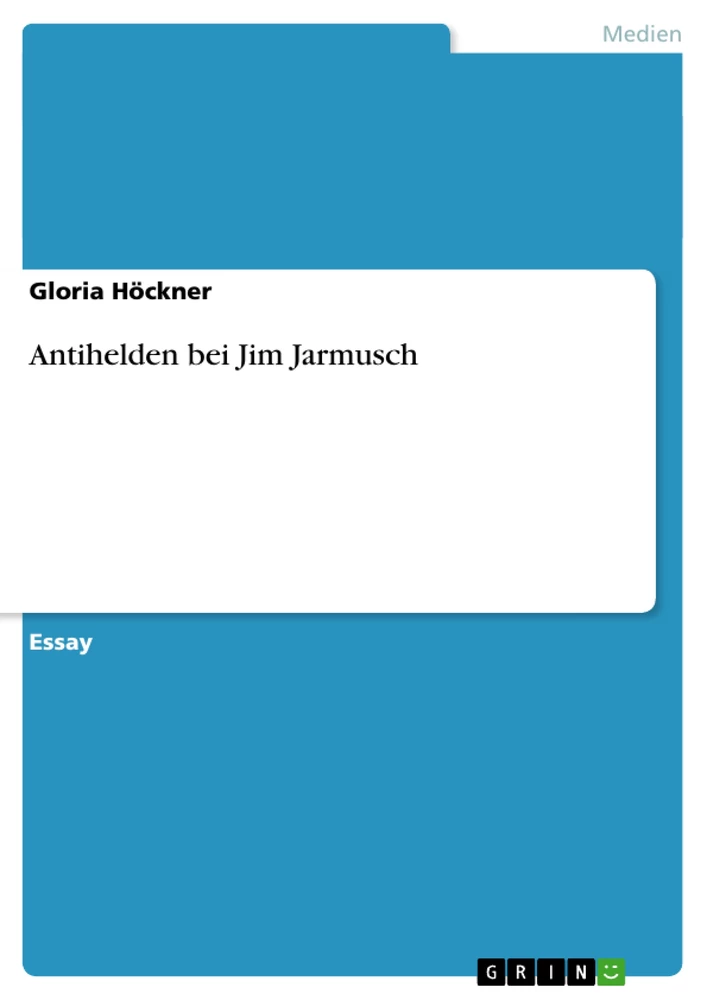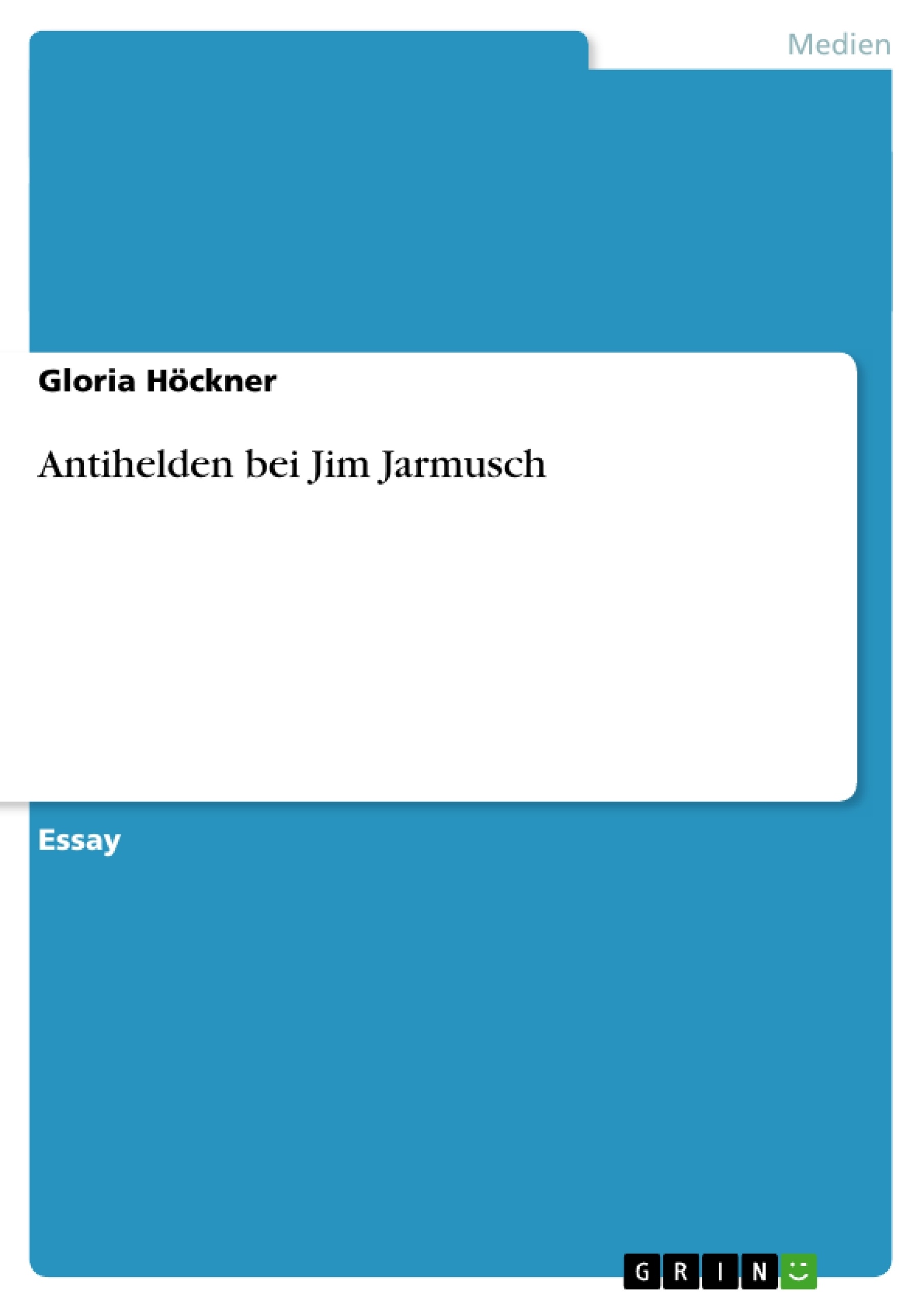„Ich finde es ziemlich komisch, dass man versucht, Delphine zu erforschen und ihre Sprache zu verstehen. Man sieht da einen Typen mit Millionen von Dollars an Computer - Equipment, und sie versuchen zu entschlüsseln, was die Delphine sagen. In der Zwischenzeit taucht ein Delphin auf und sagt auf Englisch:’ Ich will Fische.’ Sie lernen mühelos unsere Sprache, deshalb finde ich das seltsam. Wir suchen an den falschen Stellen nach Antworten.“
In diesem Zitat von Jim Jarmusch spiegelt sich die etwas skurrile, humorvolle und irgendwie weltfremde Art seiner Filme wider. Er kam mit 17 nach New York um Literatur zu studieren, entdeckte seine Liebe zum Film in Paris und lebte diese nach seiner Rückkehr in den „Big Apple“ aus. Die Nähe zur literarischen Form und zur Musik sowie, dass er, als amerikanischer Regisseur, einen Gegenentwurf des typischen Hollywoodkinos darstellt und ein wichtiger Akteur des Independent – Kinos ist, sind Vorzüge, die ihn Auszeichnen.
Mit „Stranger than paradise“ (1984) und „Down by Law“ (1986) wurde die Bezeichnung „American Independent Cinema“ zu einem gebräuchlichen Terminus und Jim Jarmusch zu einem (bis heute unabhängigen) „Star-Regisseur“ stilisiert, dessen Filme Kultcharakter erlangten. Sein Ehrgeiz besteht darin, eine neue kinematographische Sprache zu schaffen, die von dem Weltkino zwischen Japan und Europa sowie dem klassischen Hollywood geprägt ist:
„Ich will eine Brücke zwischen diesen Polen finden, ohne eine Seite gegen die andere auszuspielen.“
Inhaltsverzeichnis
- Down by law (1986)
- Eine Einführung
- Zusammenfassung des Films
- Beleuchtung der Figur Roberto (Roberto Benigni)
- Dead Man (1995)
- Handlung
- William Blake (Johnny Depp)
- Gegenüberstellung der Figuren Roberto und William Blake
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert die Figur des Antihelden in zwei Filmen des amerikanischen Regisseurs Jim Jarmusch, „Down by law“ (1986) und „Dead Man“ (1995). Er untersucht die besonderen Charaktereigenschaften und Handlungsweisen dieser Figuren im Kontext der jeweiligen Filmhandlung und beleuchtet dabei die spezifischen künstlerischen Mittel, die Jarmusch einsetzt, um diese Figuren zu gestalten.
- Der Antiheld als Gegenentwurf zum klassischen Helden
- Die Rolle des Humors und der Ironie in Jarmusch' Filmen
- Die Darstellung von Außenseitern und ihren Erfahrungen in einer fremden Welt
- Die Bedeutung der Sprache und der Kommunikation im Kontext der Filmhandlung
- Die ästhetischen und filmischen Elemente, die Jarmusch' Filmstil auszeichnen
Zusammenfassung der Kapitel
Down by law (1986)
Das erste Kapitel führt in die Welt von Jim Jarmusch und seine filmische Ästhetik ein, die sich durch Minimalismus und eine besondere Betonung der Figurenkonstellation auszeichnet. Es beschreibt die Handlung von „Down by law“, in der drei Männer – Jack, Zack und Roberto – unter ungeklärten Umständen in eine Gefängniszelle geraten. Während Jack und Zack als „coole“ und wortkarge Figuren dargestellt werden, bringt Roberto mit seiner expressiven Art und seiner fehlerhaften, aber gleichzeitig charmanten Englischkenntnissen eine komödiantische und märchenhafte Atmosphäre in die Zelle.
Roberto, der im Film als ein Outsider dargestellt wird, fungiert als Übermittler von Emotionen und Lebensfreude, die Jack und Zack verloren haben. Seine Fähigkeit, auch aus schwierigen Situationen das Beste zu machen und mit Humor auf Schicksalsschläge zu reagieren, führt zum Ausbruch aus der Zelle und schließlich zur Flucht in die gefährlichen Sümpfe Louisianas.
Dead Man (1995)
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Film „Dead Man“, der ebenfalls eine zentrale Antiheldenfigur, William Blake, zeigt. Dieser Film zeichnet sich durch eine düstere und bedrohliche Atmosphäre aus, die durch die Handlung in einem abgelegenen und von Gewalt geprägten Teil des Wilden Westens geschaffen wird. William Blake, der als verfeindeter Steuerinspektor in die Wildnis flüchtet, wird durch seine geistige Distanz und seine introvertierte Art zum Außenseiter.
Die Kapitel analysieren die Charakteristika von William Blake und zeigen auf, wie er in der brutalen Welt des Wilden Westens als „fremder“ und idealistischer Künstler gefangen ist. Seine Reise führt ihn in die Konfrontation mit der rohen Realität der Gewalt und des Todes, die in diesem Teil der amerikanischen Geschichte vorherrscht.
Schlüsselwörter
Antiheld, Jim Jarmusch, Independent Cinema, Minimalismus, Humor, Ironie, Outsider, Sprache, Kommunikation, Fremdsein, Gefängnis, Flucht, Wildnis, Gewalt, Tod, Künstler, Ästhetik, Stil, Filmsprache, Figurenkonstellation.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die Filme von Jim Jarmusch aus?
Jarmuschs Filme sind geprägt von Minimalismus, skurrilem Humor, einer Nähe zur Literatur und Musik sowie der Darstellung von Außenseitern.
Was ist ein Antiheld im Kontext von Jarmusch?
Ein Antiheld bei Jarmusch ist oft ein weltfremder Außenseiter, der sich durch eine passive oder unkonventionelle Lebensart vom klassischen Hollywood-Helden unterscheidet.
Welche Rolle spielt die Figur Roberto in „Down by Law“?
Roberto (gespielt von Roberto Benigni) fungiert als emotionaler Katalysator. Trotz seiner Sprachbarrieren bringt er Lebensfreude in die Gefängniszelle und initiiert den Ausbruch.
Wer ist William Blake in dem Film „Dead Man“?
William Blake (gespielt von Johnny Depp) ist ein introvertierter Buchhalter, der im Wilden Westen zum Außenseiter und unfreiwilligen Outlaw wird.
Warum wird Jarmusch dem „American Independent Cinema“ zugeordnet?
Er gilt als Mitbegründer dieser Bewegung, da er abseits der großen Hollywood-Studios eine eigene kinematographische Sprache entwickelte, die weltweit Kultstatus erreichte.
- Quote paper
- Gloria Höckner (Author), 2007, Antihelden bei Jim Jarmusch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94433