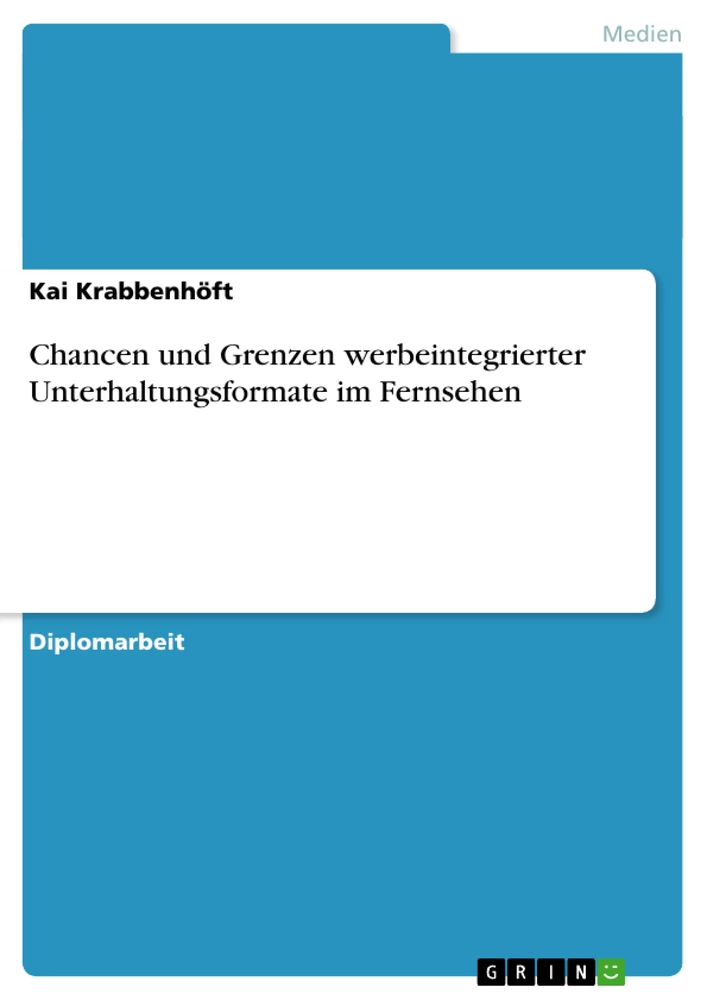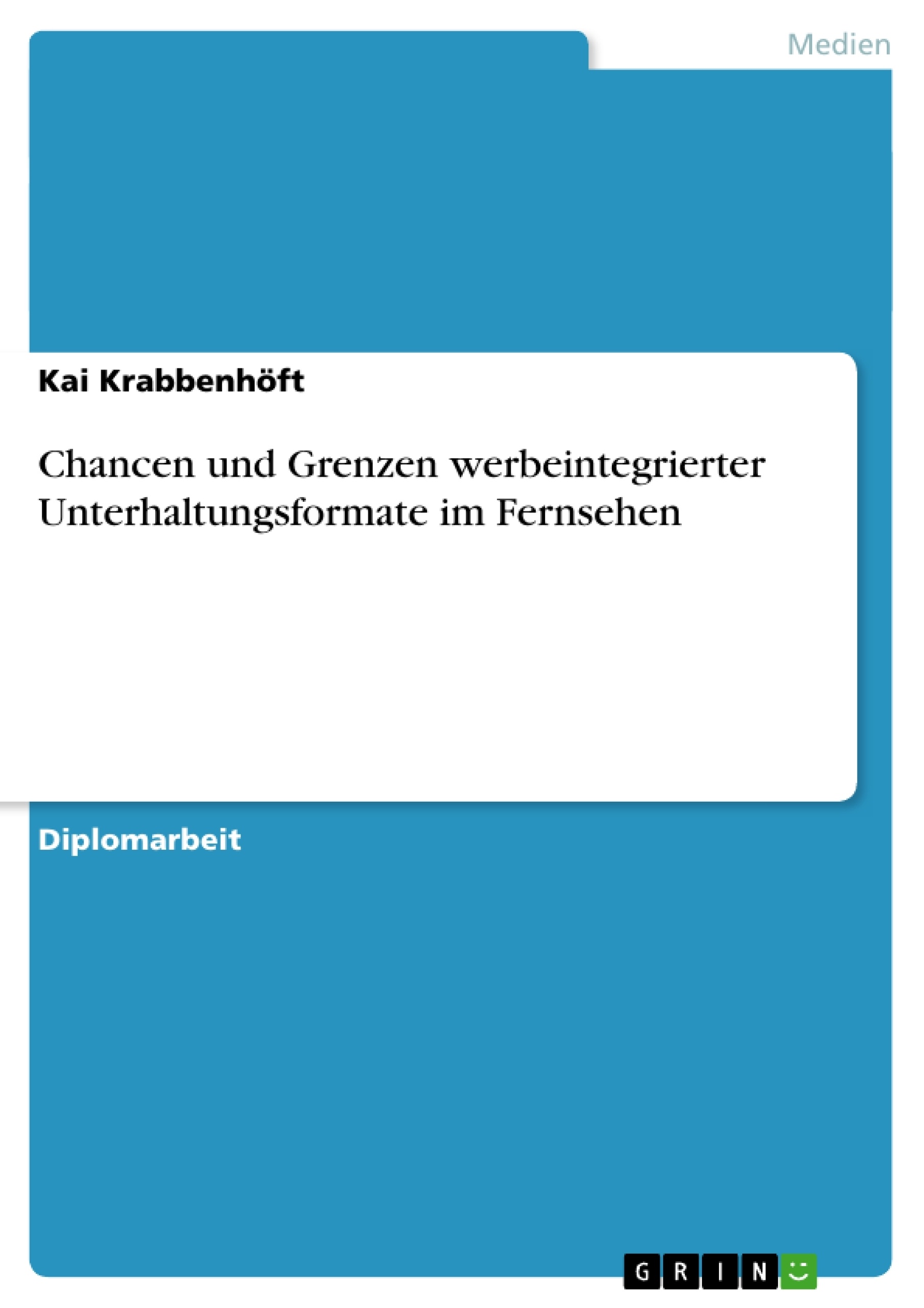Sonderwerbeformen wie Sponsoring, Product-Placement oder Splitscreen stehen stellvertretend für eine Vielzahl von Entwicklungen der letzten Jahre, die Sender und Werbekunden einsetzen, um die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums zu erlangen. Der Kampf um die Aufmerksamkeit ist davon geprägt, Wege zu finden, um Produkte und Dienstleistungen möglichst deutlich aus einer immer größer werdenden Informationsflut hervorzuheben.
Dieses Bestreben wird nun zusätzlich durch die Kombination von neuen Technologien und sich verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen erschwert. Während er in den USA bereits zur Grundausstattung der Fernsehhaushalte gehört, ist der digitale Videorekorder (DVR) mit seinen Nutzungsmöglichkeiten in Deutschland lange Zeit unbeachtet gewesen. Doch spätestens seit dem BGH-Urteil vom Juni 2004, welches die Rechtmäßigkeit von Werbeblockern bestätigt, wird die neue Technik hierzulande heftig diskutiert. Entscheidende Funktionalitäten der DVR-Technologie, das Time-Shifting1 und das Ad-Skipping2, gefährden die Unterbrecherwerbung als klassische Finanzierungsart der privaten Sender.
Die Sender werden ihre Spotpreise nur noch schwer vermitteln können. Das Fundament der Gegenleistung, die Einschaltquote, wird an Aussagekraft verlieren. Sie ist dann jedenfalls kein verlässliches Indiz mehr dafür, wie viele Personen eine Sendung und damit auch die mit ihr verbundene Werbung wirklich gesehen haben.
Mit Blick auf den TV-Markt der USA lässt sich auch für Deutschland der Trend vorhersagen, Marken bereits im Entwicklungs- und Produktionsprozess zu berücksichtigen und sie direkt in Unterhaltungsformate zu integrieren. Im Sinne der Arbeitshypothese beantwortet die Arbeit die Frage, inwieweit die strategische Planung eines TV-Produzenten bereits heute die Möglichkeiten einer veränderten Wertschöpfung berücksichtigen sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Problem
- Fragestellung
- Formulierung der Arbeitshypothese
- Ansatz der Arbeit
- Zielsetzung
- Aufbau
- Einflussfaktoren
- Wachsende Programmvielfalt
- Beginn der Digitalisierung
- Stand der Digitalisierung
- Programmarten
- Öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm
- Sendervielfalt und Spartenkanäle
- Privates Fernsehprogramm
- Ökonomische Bedeutung
- Mobilität und Interaktivität
- Zwischenfazit
- Wahl- und Kontrollmöglichkeiten durch digitale Videorekorder
- Begrifflichkeiten und Technologie
- Marktpotenzial
- Nutzungsmöglichkeiten
- Verbraucherverhalten
- Situationsanalyse USA
- Ökonomische Bedeutung
- Zwischenfazit
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Begriffe der Werbung und Werbeformen
- Gesetzliche Grenzen
- Deklaration als Dauerwerbesendung
- Entwicklung der EU-Fernsehrichtlinie
- Grundlegende Neuerungen
- Modernisierte Werbebestimmungen
- Ökonomische Bedeutung
- Zwischenfazit
- Werbung in Deutschland
- Entwicklung des Werbemarktes
- Werbeverhalten nach Branchen
- Vergleich monothematischer Medien
- Begrifflichkeiten
- Qualitative und quantitative Erkenntnisse
- Werbende Branchen
- Vergleichbarkeit der Mediadaten
- Zwischenfazit
- Redaktionelle und konzeptionelle Überlegungen
- Begriffsdefinition Unterhaltungsformat
- Auftragsproduktion oder Eigenproduktion?
- Aspekte der Werbewirkung
- Branded-Entertainment vs. Unterbrecherwerbung
- Exkurs: Reaktanztheorie nach Brehm
- Recency-Planning-Theorie
- Branded-Entertainment als Experience-Branding
- Exkurs: Hierarchie der Bedürfnisse nach Maslow
- Formatbeispiele für Spartenkanäle
- Zwischenfazit
- Chancen und Grenzen werbeintegrierter Unterhaltungsformate
- Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse
- Diskussion eines Geschäftsmodells
- Theoretisches AFP-Geschäftsmodell
- Stärken-Schwächen-Analyse
- Primäre Aktivitäten
- Unterstützende Aktivitäten
- Chancen-Risiken-Analyse
- Gesetzliche und staatliche Rahmenbedingungen
- Markt und Wettbewerb
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- Technische Entwicklung
- Zwischenfazit
- Schlussbetrachtung
- Kernergebnisse
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Internet-Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung der Fernsehökonomie in Deutschland und untersucht die Chancen und Grenzen werbeintegrierter Unterhaltungsformate. Dabei werden insbesondere die Auswirkungen einer wachsenden Programmvielfalt, die neuen Möglichkeiten durch digitale Videorekorder und die Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie analysiert.
- Entwicklung der Fernsehökonomie in Deutschland
- Chancen und Grenzen werbeintegrierter Unterhaltungsformate
- Einflussfaktoren wie Programmvielfalt, digitale Videorekorder und EU-Fernsehrichtlinie
- Analyse der Werbewirkung und des Werbemarktes
- Diskussion eines theoretischen Geschäftsmodells für werbeintegrierte Unterhaltungsformate
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der Arbeit dar und formuliert die Fragestellung sowie die Arbeitshypothese. Anschließend werden die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Fernsehökonomie in Deutschland betrachtet, darunter die wachsende Programmvielfalt, die Wahl- und Kontrollmöglichkeiten durch digitale Videorekorder und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Im dritten Kapitel wird der deutsche Werbemarkt und das Werbeverhalten in verschiedenen Branchen analysiert. Das vierte Kapitel befasst sich mit redaktionellen und konzeptionellen Überlegungen zur Gestaltung werbeintegrierter Unterhaltungsformate. Im fünften Kapitel werden die Chancen und Grenzen dieser Formate anhand eines theoretischen Geschäftsmodells diskutiert. Schließlich werden die Kernergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.
Schlüsselwörter
EU-Fernsehrichtlinie, digitale Videorekorder, Programmvielfalt, werbeintegrierte Unterhaltungsformate, SWOT-Analyse, Werbemarkt, Branded-Entertainment, Geschäftsmodell, Fernsehökonomie, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Was sind werbeintegrierte Unterhaltungsformate?
Dazu zählen Sonderwerbeformen wie Sponsoring, Product-Placement oder Branded-Entertainment, bei denen Marken direkt in den Inhalt einer Sendung integriert werden.
Warum verlieren klassische Werbeblöcke an Bedeutung?
Technologien wie digitale Videorekorder (DVR) ermöglichen Time-Shifting und Ad-Skipping (Werbeblocker), wodurch die klassische Unterbrecherwerbung umgangen werden kann.
Welchen Einfluss hat die EU-Fernsehrichtlinie?
Die Novellierung der Richtlinie schafft neue rechtliche Rahmenbedingungen und modernisierte Werbebestimmungen, die den Einsatz integrierter Werbeformen beeinflussen.
Was bedeutet Branded-Entertainment?
Hierbei werden Marken als Teil des Unterhaltungserlebnisses inszeniert (Experience-Branding), um die Aufmerksamkeit der Zuschauer trotz Informationsflut zu gewinnen.
Warum sinkt die Aussagekraft der Einschaltquote?
Weil die Quote nicht mehr zuverlässig anzeigt, ob Zuschauer die Werbung tatsächlich gesehen oder mittels DVR-Technik übersprungen haben.
- Arbeit zitieren
- Kai Krabbenhöft (Autor:in), 2007, Chancen und Grenzen werbeintegrierter Unterhaltungsformate im Fernsehen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94436