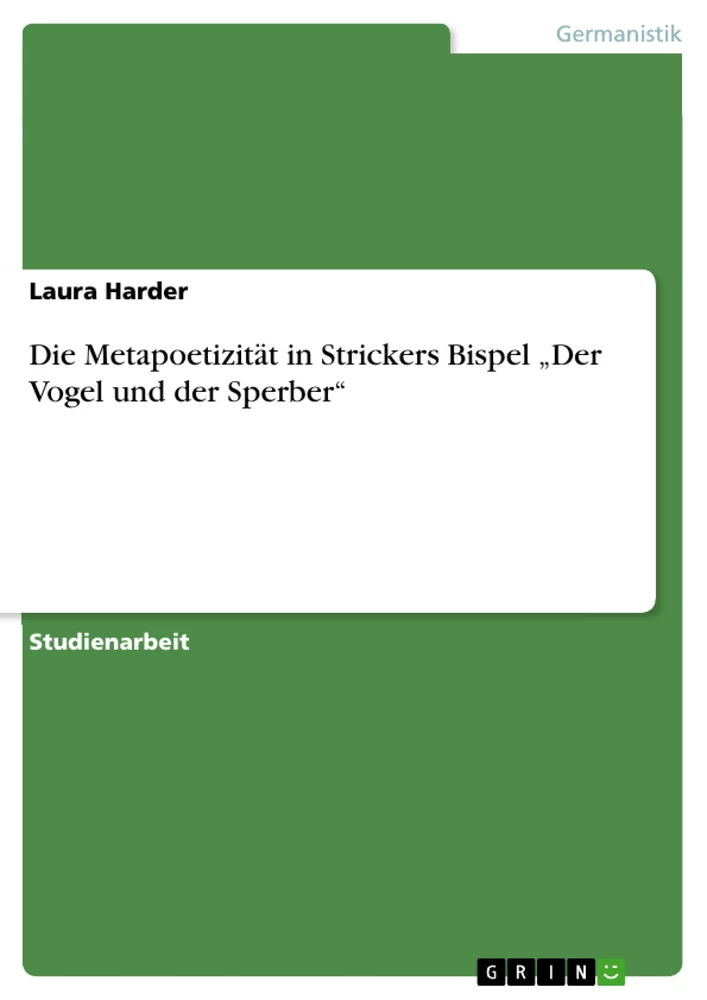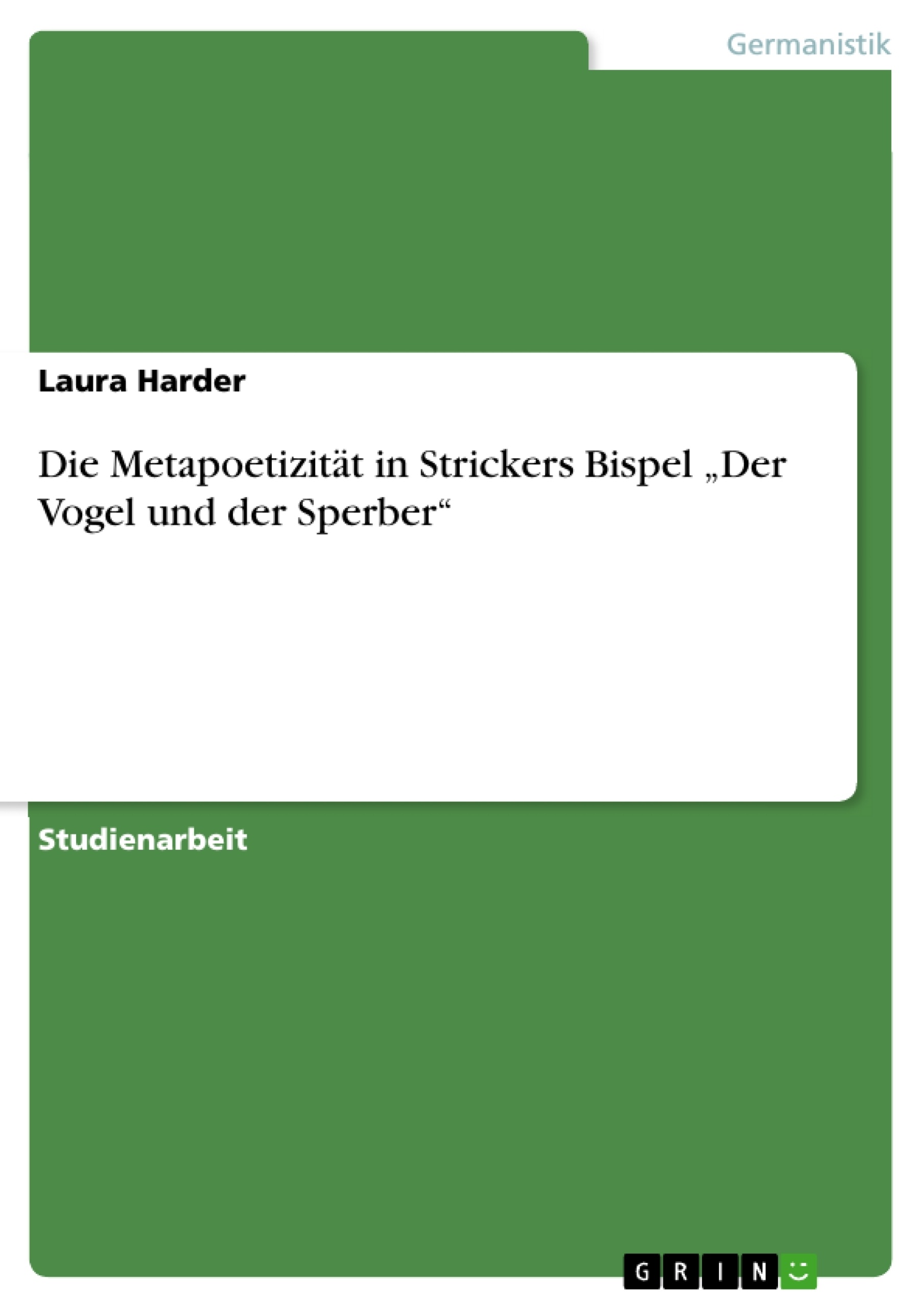Diese Arbeit fragt, auf der Grundlage des Bispels „Der Vogel und der Sperber“, nach der Metapoetizität, also den Ansichten und Meinungen des Strickers über die Literatur seiner Zeit. Betrachtet wird auch, welche Mittel der Stricker nutzt um sich über seine Ansichten mitzuteilen. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob des Strickers Meinungen zunächst für sich allein stehen, oder ob er gleichzeitig auch Argumente für seine Ansichten darlegt.
Es ist nicht unüblich, dass mittelalterliche Autoren sich zu ihrer Situation als Autor oder zum Gegenstand des Erzählens bzw. der Dichtung in ihren Texten äußern. Auch für den Stricker, der in den „Jahrzehnte[n] zwischen 1220 und 1250“ als fahrender Berufsdichter tätig war, lassen sich solche Beispiele finden. Oftmals will der Stricker nicht ausschließlich über den eigentlichen Gegenstand des Textes erzählen, sondern auch vom Erzählen berichten und seine Meinung über Literatur kundtun. Dabei können Ansichten und Meinungen vom Erzählen oder über Literatur auf verschiedene Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden: Einerseits können konkrete Aussagen über Literatur getroffen werden, andererseits, wie es auch im strickerschen Bispel „Der Vogel und der Sperber“4 der Fall ist, werden Meinungen über Literatur indirekt auf einer Metaebene zum Ausdruck gebracht. Letzteres kann auch als Metapoetizät5 bezeichnet werden und ist hier auch so zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Texttyp und Inhalt
- Metapoetizität
- Das Bild des singenden Vogels
- Die Gefahr von Schönheit und Weltlichkeit
- Strickers Ansichten und Argumente
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Metapoetizität in Strickers Bispel „Der Vogel und der Sperber“. Sie analysiert das Bild des singenden Vogels als Metapher für die Beschäftigung mit Literatur und untersucht, welche Ansichten der Stricker über die Dichtung seiner Zeit vertritt.
- Die Metapoetizität in Strickers Bispel „Der Vogel und der Sperber“
- Die Interpretation des Bildes des singenden Vogels als Metapher für die Literatur
- Strickers Ansichten über die Dichtung seiner Zeit
- Die Verbindung von Literatur und christlichem Glauben im Mittelalter
- Die Bedeutung des Bispels als literarisches Genre
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Metapoetizität in Strickers Werk ein. Sie stellt den Kontext des Bispels „Der Vogel und der Sperber“ dar und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit.
- Texttyp und Inhalt: Dieses Kapitel beleuchtet den Texttyp des Bispels und beschreibt den Inhalt des ausgewählten Textes „Der Vogel und der Sperber“. Es wird auf die Zweiteilung in Bild- und Auslegungsteil sowie die moralische Botschaft des Bispels eingegangen.
- Metapoetizität: Der dritte Abschnitt analysiert das Bild des singenden Vogels als Metapher für die Beschäftigung mit Literatur. Dabei wird diskutiert, welche Ansichten der Stricker über die Dichtung seiner Zeit vertritt und wie diese Ansichten durch das Bild des singenden Vogels zum Ausdruck gebracht werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die folgenden Schlüsselwörter: Metapoetizität, Bispel, „Der Vogel und der Sperber“, Stricker, mittelalterliche Literatur, christlicher Glaube, Dichtung, Literaturkritik, Bildsprache.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Metapoetizität im Werk des Strickers?
Metapoetizität bezeichnet die Art und Weise, wie ein Autor in seinem Werk über das Dichten selbst, die Rolle der Literatur und seine eigenen Ansichten zum Erzählen reflektiert.
Wofür steht das Bild des singenden Vogels in „Der Vogel und der Sperber“?
Der singende Vogel dient als Metapher für die Beschäftigung mit Literatur und die Gefahr der Weltlichkeit, die von rein ästhetischer Schönheit ohne christlichen Gehalt ausgehen kann.
Welche Meinung vertritt der Stricker über die Literatur seiner Zeit?
Der Stricker kritisiert oft Literatur, die nur der Unterhaltung dient, und plädiert für eine Dichtung, die eine moralische oder christliche Botschaft vermittelt.
Was ist ein „Bispel“?
Ein Bispel ist ein kurzes, lehrhaftes Erzählgedicht des Mittelalters, das meist aus einem Bildteil (Erzählung) und einem Auslegungsteil (moralische Lehre) besteht.
In welchem Zeitraum war der Stricker tätig?
Der Stricker war ein fahrender Berufsdichter, der etwa zwischen 1220 und 1250 tätig war.
- Citar trabajo
- Laura Harder (Autor), 2011, Die Metapoetizität in Strickers Bispel „Der Vogel und der Sperber“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/945028