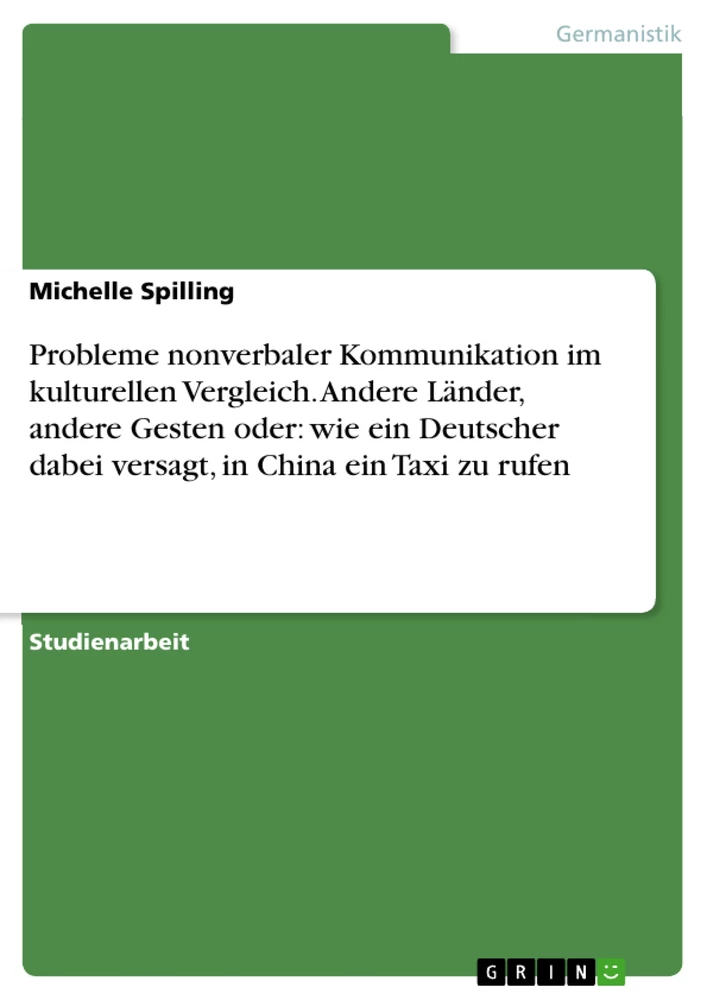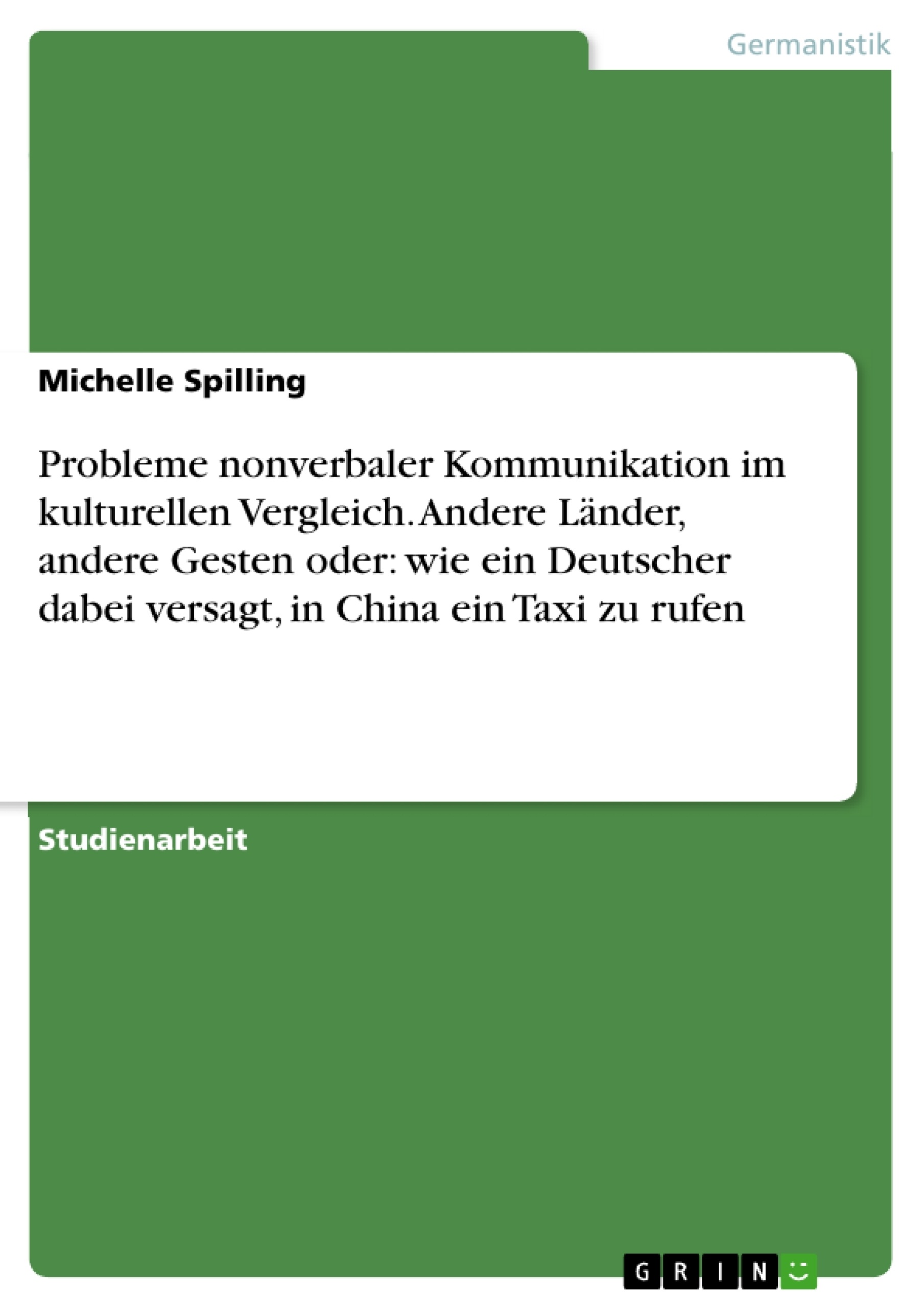Missverständnisse sind in einer anderen Kultur fast unvermeidbar. Ein Handzeichen oder ein vermeintlich falscher Blick können in Ländern wie China, in welchem andere Sitten und Gebräuche gelten als in Deutschland, schnell zum alltäglichen Problem werden. Im ersten Teil dieser Arbeit beschäftigt sich die Autorin deshalb mit der grundlegenden Fragen, was überhaupt Kommunikation ist.
Dafür bezieht Sie sich unter anderem auf die fünf Axiome nach Watzlawick. Des Weiteren befasst Sie sich mit dem Thema der nonverbalen Kommunikation, eher im letzten Teil der Arbeit einige ausgewählte, nichtsprachliche Mittel der Kommunikation zwischen Deutschland und China verglichen werden. Als Grundlage dazu dienen unter anderem Hans Jürgen Heringers "Interkulturelle Kommunikation" und Vera Birkenbihls "Signale des Körpers".
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aktueller Forschungsstand
- 3. Menschliche Kommunikation
- 3.1 Was ist menschliche Kommunikation?
- 3.2 Axiome der Kommunikation nach Paul Watzlawick
- 4. Was ist nonverbale Kommunikation?
- 4.1 Mimik
- 4.2 Gestik
- 4.3 Körperhaltung
- 4.4 Abstand
- 4.5 Tonfall
- 5. Interkulturelle nonverbale Kommunikation im Vergleich
- 5.1 Was ist Kultur?
- 5.2 Ein Deutscher in China – wie einige deutsche Gesten am anderen Ende der Welt missverstanden werden
- 5.2.1 Eins plus eins ist acht?
- 5.2.2 Winken ist nicht gleich Winken
- 5.2.3 Körperkontakt? Nein danke
- 5.2.4 Aufmerksames Zuhören wird überbewertet
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Herausforderungen nonverbaler Kommunikation im interkulturellen Kontext, insbesondere den Unterschied zwischen deutscher und chinesischer Gepflogenheiten. Ziel ist es, Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Interpretationen von Gesten und Körpersprache aufzuzeigen und zu analysieren.
- Die Definition und verschiedenen Aspekte menschlicher Kommunikation.
- Nonverbale Kommunikation und ihre kulturelle Variabilität.
- Der Vergleich nonverbaler Kommunikationsmuster zwischen Deutschland und China.
- Die Analyse spezifischer Beispiele für Missverständnisse aufgrund kultureller Unterschiede.
- Die Bedeutung interkultureller Kompetenz für gelungene Kommunikation.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Anekdotenbeispiel, das ein Missverständnis zwischen einem Deutschen, einer Französin und einem Kellner mit russischem Akzent aufgrund einer missverstandenen Geste verdeutlicht. Sie führt in die Thematik der kulturellen Unterschiede in nonverbaler Kommunikation ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit der Definition von Kommunikation, nonverbaler Kommunikation und einem Vergleich deutsch-chinesischer Kommunikationsmuster beschäftigt.
2. Aktueller Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zur interkulturellen nonverbalen Kommunikation. Es wird darauf hingewiesen, dass die Forschung zwar ein breites, aber uneinheitliches Feld darstellt, da sich Kommunikation kulturell nur schwer verallgemeinern lässt. Trotz der fehlenden festen Regeln werden weiterhin Theorien entwickelt, um grundlegenden Kommunikationsproblemen entgegenzuwirken. Der Bezug auf bestehende Literatur (Heringer, Yousefi) unterstreicht den wissenschaftlichen Kontext.
3. Menschliche Kommunikation: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Kommunikation" und erläutert ihre grundlegenden Aspekte. Es wird auf die Notwendigkeit von mindestens zwei Kommunikationspartnern, die Verwendung von Sprache und Zeichen sowie die Intentionalität von Kommunikation eingegangen. Die Axiome der Kommunikation nach Watzlawick werden als wichtiger Bestandteil der Theorie erwähnt, wenngleich nicht im Detail erläutert. Die Bedeutung der Interpretation des Grundes für die Kommunikation zur Vermeidung von Missverständnissen wird hervorgehoben.
4. Was ist nonverbale Kommunikation?: Dieses Kapitel widmet sich der nonverbalen Kommunikation und ihren verschiedenen Facetten. Es werden die Kategorien Mimik, Gestik, Körperhaltung, Abstand und Tonfall als wichtige nichtsprachliche Kommunikationsmittel benannt. Das Kapitel liefert eine Grundlage für das Verständnis der kulturellen Unterschiede, die im folgenden Kapitel vertieft werden.
5. Interkulturelle nonverbale Kommunikation im Vergleich: Dieses Kapitel fokussiert auf den interkulturellen Vergleich nonverbaler Kommunikation, insbesondere zwischen Deutschland und China. Es werden spezifische Beispiele deutscher Gesten analysiert, die in China missverstanden werden können (z.B. das "Okay"-Zeichen, das Winken, Körperkontakt und die Bedeutung von Aufmerksamkeit). Das Kapitel verdeutlicht, wie kulturelle Unterschiede zu Missverständnissen und Konflikten führen können.
Schlüsselwörter
Nonverbale Kommunikation, Interkulturelle Kommunikation, Gesten, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Missverständnisse, Kulturvergleich, Deutschland, China, Kommunikationstheorien, Watzlawick.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interkulturelle Nonverbale Kommunikation - Deutschland und China
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen nonverbaler Kommunikation im interkulturellen Kontext, speziell den Unterschied zwischen deutscher und chinesischer Gepflogenheiten. Sie beinhaltet eine Einleitung, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand, eine Definition menschlicher und nonverbaler Kommunikation, und einen detaillierten Vergleich nonverbaler Kommunikationsmuster zwischen Deutschland und China mit konkreten Beispielen für Missverständnisse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Aspekte menschlicher Kommunikation, nonverbale Kommunikation und ihre kulturelle Variabilität, Vergleich nonverbaler Kommunikationsmuster zwischen Deutschland und China, Analyse spezifischer Beispiele für Missverständnisse aufgrund kultureller Unterschiede und die Bedeutung interkultureller Kompetenz für gelungene Kommunikation.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Aktueller Forschungsstand, Menschliche Kommunikation, Nonverbale Kommunikation, Interkulturelle nonverbale Kommunikation im Vergleich und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche konkreten Beispiele für Missverständnisse werden genannt?
Die Arbeit analysiert verschiedene deutsche Gesten, die in China missverstanden werden können. Beispiele hierfür sind das "Okay"-Zeichen, das Winken, unterschiedliche Auffassungen von Körperkontakt und die Bedeutung von Aufmerksamkeit im Gespräch.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Axiome der Kommunikation nach Paul Watzlawick und erwähnt den aktuellen Forschungsstand, wobei die uneinheitliche Natur der Forschung im Bereich interkultureller Kommunikation hervorgehoben wird. Es wird auf bestehende Literatur (Heringer, Yousefi) verwiesen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Interpretationen von Gesten und Körpersprache aufzuzeigen und zu analysieren, um die Bedeutung interkultureller Kompetenz für erfolgreiche Kommunikation zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Nonverbale Kommunikation, Interkulturelle Kommunikation, Gesten, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Missverständnisse, Kulturvergleich, Deutschland, China, Kommunikationstheorien, Watzlawick.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die ein Beispiel für ein Missverständnis beschreibt und den Aufbau der Arbeit skizziert. Anschließend wird der aktuelle Forschungsstand beleuchtet, bevor die menschliche und nonverbale Kommunikation definiert werden. Der Hauptteil vergleicht dann deutsch-chinesische Kommunikationsmuster, bevor die Arbeit mit einer Zusammenfassung abschließt.
- Quote paper
- Michelle Spilling (Author), 2020, Probleme nonverbaler Kommunikation im kulturellen Vergleich. Andere Länder, andere Gesten oder: wie ein Deutscher dabei versagt, in China ein Taxi zu rufen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/945204