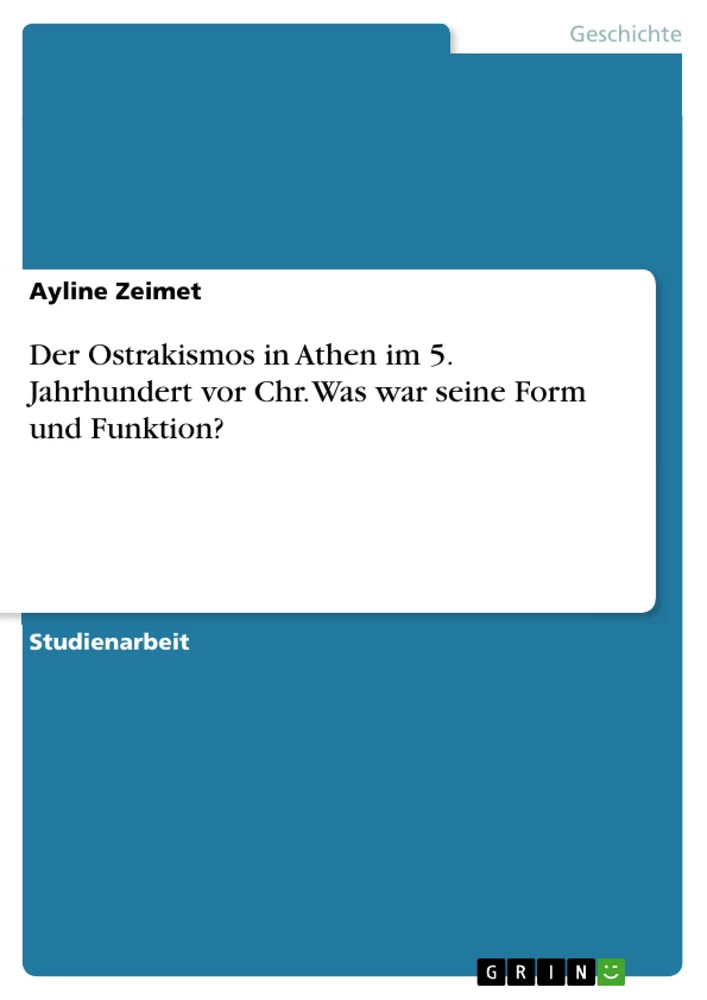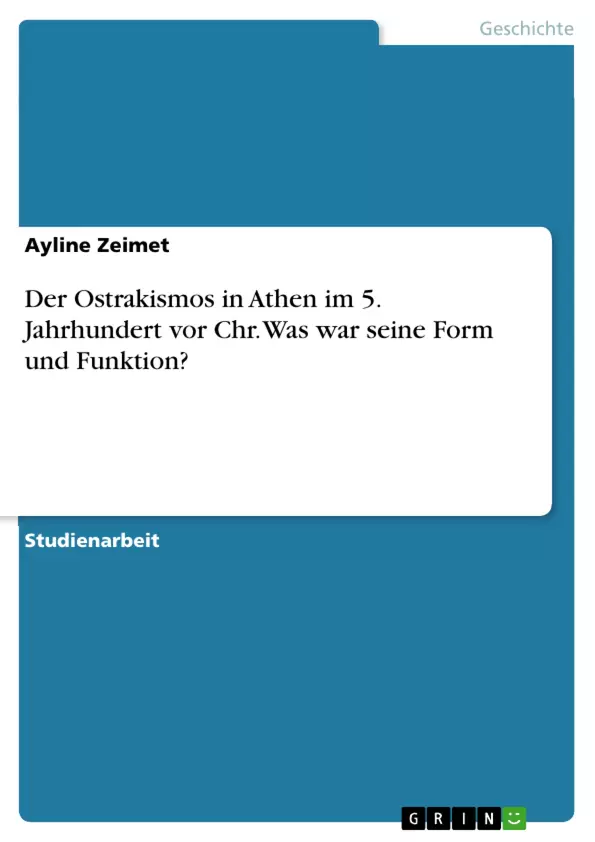Welche Funktion hatte der Ostrakismos innerhalb der athenischen Demokratie? Unter welchen Umständen
wurde ein Ostrakismos durchgeführt? Diesen Fragen geht die vorliegende Arbeit nach.
Um diese Fragestellungen beantworten zu können, ist es demnach von großer Bedeutung, im ersten Kapitel den Fokus auf den Ostrakismos zu legen. Im Einzelnen werden in diesem Kapitel sowohl die Durchführung und die Funktion des Ostrakismos als auch die Einführung und das Ende des Scherbengerichts näher betrachtet. Um zu klären, unter welchen Umständen ein Ostrakismos stattfand, werden im zweiten Kapitel Beispiele bekannter Ostrakismosopfer aufgeführt. Am Ende dieser Arbeit werden in einem Fazit die Fragestellungen, im Rückblick auf das Erarbeitete, beantwortet werden.
Der Begriff "Demokratie", griechisch „Herrschaft des Volkes“, hatte in der Antike eine andere Bedeutung als heute. Zu dieser Zeit wurde sie als eine direkte Demokratie praktiziert, was bedeutet, dass die Rechtsbürger sich versammelten und selbst über Angelegenheiten ihres Stadtstaates, der Polis, entschieden. Aus heutiger Sicht ist eine solche Demokratie nicht mehr praktizierbar, wodurch die repräsentative Demokratie in den Vordergrund gerückt ist, bei der die Bürger Repräsentanten auf Zeit wählen, die ihre Interessen vertreten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ostrakismos
- Die Einführung des Ostrakismos
- Die Durchführung des Ostrakismos
- Die Funktion des Ostrakismos
- Die Blütezeit des Ostrakismos
- Das Ende des Ostrakismos
- Beispiele von bekannten Ostrakismosopfern
- Der Ostrakismos des Aristeides
- Der Ostrakismos des Themistokles
- Der Ostrakismos des Hyperbolos
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ostrakismos im Athen des 5. Jahrhunderts v. Chr. und beleuchtet seine Funktionsweise, die Umstände seiner Anwendung sowie seine Rolle innerhalb der athenischen Demokratie.
- Die Einführung des Ostrakismos durch Kleisthenes
- Die Durchführung des Ostrakismos, insbesondere die Unterscheidung zwischen Rats- und Volks-Ostrakismos
- Die Funktion des Ostrakismos als Mittel zur Verhinderung von Tyrannis
- Beispiele für den Ostrakismos prominenter Persönlichkeiten wie Aristeides, Themistokles und Hyperbolos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert zunächst den Begriff der Demokratie im antiken Athen im Vergleich zu heutigen Demokratien und skizziert die historische Entwicklung der athenischen Demokratie. Des Weiteren werden die wichtigsten Quellen für die Forschung zum Ostrakismos vorgestellt, darunter literarische Werke wie die Athenaion Politeia des Aristoteles und die Biographien des Plutarchs.
Kapitel 2 widmet sich dem Ostrakismos. Zunächst wird die Einführung des Verfahrens durch Kleisthenes beleuchtet. Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Durchführung des Ostrakismos, wobei zwischen der Anwendung durch den Rat der Fünfhundert und dem Volks-Ostrakismos unterschieden wird. Die Funktion des Ostrakismos als Mittel zur Verhinderung von Tyrannis wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels analysiert.
Kapitel 3 präsentiert Beispiele für den Ostrakismos prominenter Persönlichkeiten wie Aristeides, Themistokles und Hyperbolos. Anhand dieser Beispiele wird die Anwendung des Verfahrens in der Praxis illustriert.
Schlüsselwörter
Ostrakismos, athenische Demokratie, Tyrannis, Scherbengericht, Kleisthenes, Aristeides, Themistokles, Hyperbolos, Quellenanalyse, historische Entwicklung, politische Verfahren.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Ostrakismos im antiken Athen?
Der Ostrakismos, auch Scherbengericht genannt, war ein politisches Verfahren, bei dem Bürger für 10 Jahre aus der Stadt verbannt werden konnten.
Was war der Hauptzweck des Scherbengerichts?
Er diente primär dazu, die Rückkehr einer Tyrannis zu verhindern und allmächtig werdende Politiker vorübergehend zu entfernen.
Wie lief eine Ostrakophorie ab?
Die Bürger ritzten den Namen des Politikers, den sie verbannen wollten, in Tonscherben (Ostraka). Bei Erreichen eines Quorums wurde der Meistgenannte verbannt.
Verlor man durch den Ostrakismos sein Vermögen?
Nein, im Gegensatz zur Flucht bei Verbrechen behielten die Verbannten ihr Eigentum und ihre bürgerlichen Ehrenrechte nach der Rückkehr.
Wer waren berühmte Opfer des Ostrakismos?
Bekannte Persönlichkeiten waren Aristeides, Themistokles und schließlich Hyperbolos, mit dessen Verbannung das Verfahren außer Gebrauch kam.
- Quote paper
- Ayline Zeimet (Author), 2019, Der Ostrakismos in Athen im 5. Jahrhundert vor Chr. Was war seine Form und Funktion?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/945370