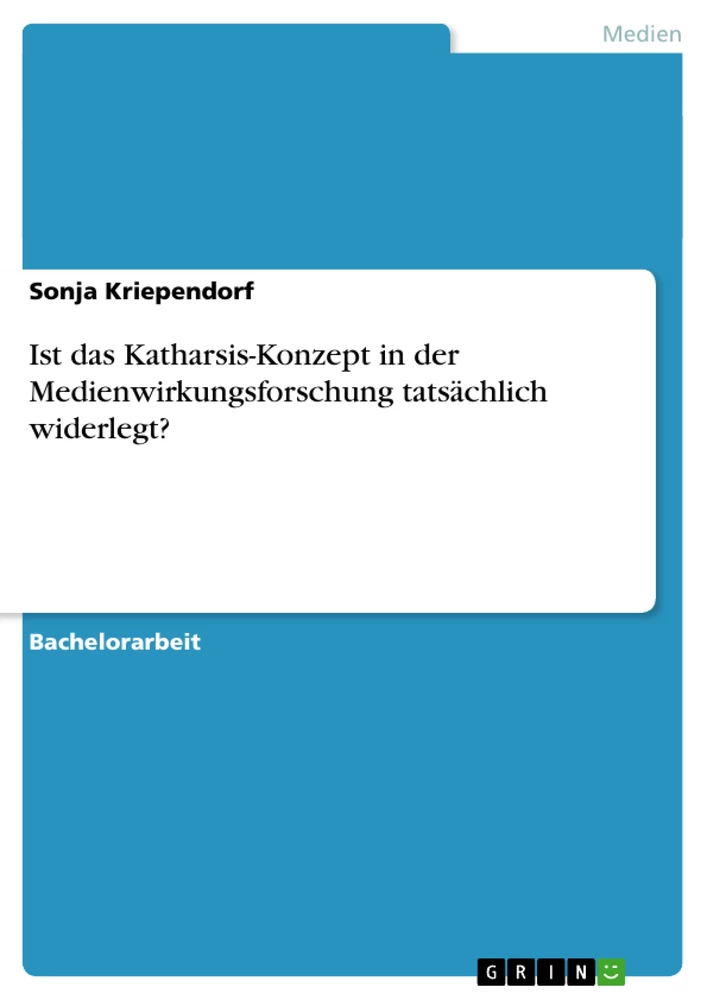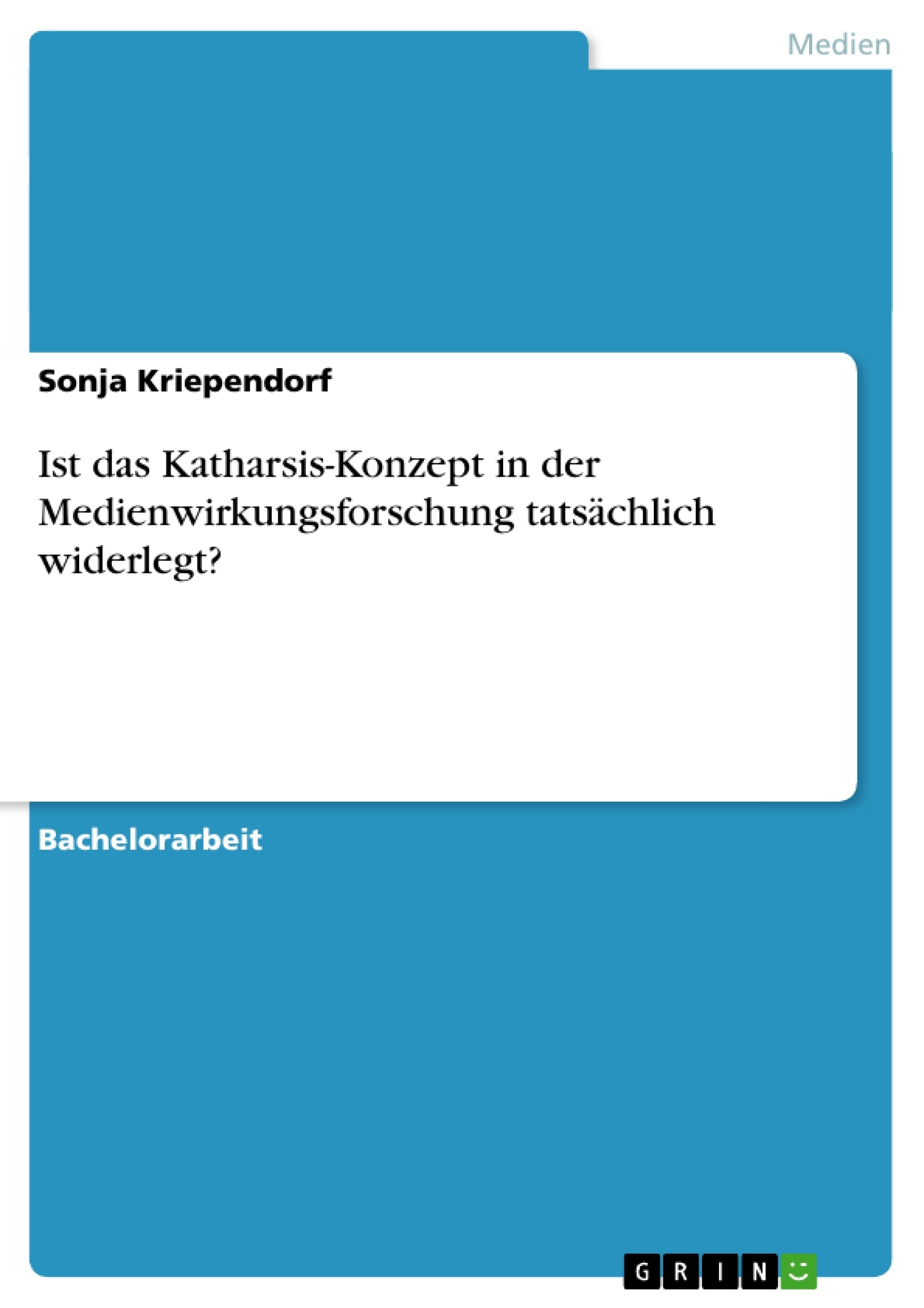In ihrem Bericht an die Gewaltkommission der Bundesregierung konstatieren Kepplinger & Dahlem (1990), dass die Katharsisthese bisher weder be- noch widerlegt sei, weil eine angemessene empirische Überprüfung mit entsprechendem Stimulusmaterial und Katharsis ermöglichende Rezeptionssituation bisher fehle. Dies verwundert zunächst, gilt doch in der gängigen Literatur, im amerikanischen wie im deutschsprachigen Raum (vgl. beispielhaft Kunczik & Zipfel, 2004), die Katharsisthese lange als widerlegt, nachdem selbst der stärkste Protagonist Seymour Feshbach sich von ihr distanziert hat. Der vorliegende Beitrag sichtet die vorliegende Literatur auf ihre Aussagekraft in Bezug auf die Katharsisthese und kommt zu dem Schluss, dass die These tatsächlich bisher nicht hinreichend widerlegt, aber auch nicht wirklich belegt ist. Wir argumentieren also keineswegs, dass mediale Gewalt harmlos ist oder gar positive Konsequenzen hat. Die Evidenz für eine negative Wirkung ist vor allem im amerikanischen Raum überwältigend. Eine unspezifische Inhibitionsthese ist daher sicherlich falsifiziert, die Spezifika der Katharsisthese warten noch auf adäquate Überprüfung.
Inhaltsverzeichnis
- Wirkung medialer Gewalt
- Ist die Katharsis-Hypothese tatsächlich widerlegt?
- Entstehung und Entwicklung
- Katharsis von Aristoteles bis Freud
- Die Frustrations-Aggressions-Theorie
- Belege für die Katharsis
- Modifikation der Katharsis-Hypothese
- Forschung zur Widerlegung der Katharsis-Hypothese
- Feldstudie von Eron, Huesmann, Lefkowitz und Walder
- Feldstudie von Milavsky, Kessler, Stipp und Rubens
- Experiment von Berkowitz und Rawlings
- Experiment von Berkowitz und Geen
- Experiment von Geen, Stonner und Shope
- Experiment von Hartmann
- Experiment von Bandura, Ross und Ross
- Experiment von Tannenbaum und Goranson
- Experimente von Bushman, Stack und Baumeister
- Bewertung der Studien gegen die Katharsis-Hypothese
- Generelle Probleme der Forschung
- Zusammenfassung der Kritikpunkte an der Forschung
- Fazit
- Die aktuelle Debatte um Gewalt und Jugend
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob das Katharsis-Konzept in der Medienwirkungsforschung tatsächlich widerlegt ist. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Katharsis-Konzepts von Aristoteles bis Freud und untersucht kritisch Studien, die angeblich die Katharsis-Hypothese falsifizieren.
- Entwicklung und Definition des Katharsis-Konzepts
- Kritische Auseinandersetzung mit Studien zur Widerlegung der Katharsis-Hypothese
- Analyse der methodischen Probleme in der Forschung zur Mediengewalt
- Die Rolle von Mediengewalt in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte
- Wirkung medialer Gewalt im Allgemeinen
Zusammenfassung der Kapitel
Wirkung medialer Gewalt: Das Kapitel beleuchtet den steigenden Medienkonsum in der deutschen Gesellschaft und die damit verbundene Frage nach den Auswirkungen auf Gedanken, Gefühle und Verhalten. Es wird auf die kontroverse Debatte um die Wirkung von Mediengewalt eingegangen, insbesondere im Kontext von Amokläufen und Nachahmung von Gewalttaten aus Filmen. Kritische Forschungsberichte werden erwähnt, die die starke Wirkung von Mediengewalt bisher nicht klar belegen konnten. Verschiedene theoretische Ansätze zur Wirkung von Gewaltdarstellungen werden vorgestellt, darunter die Stimulationsthese, die Nullhypothese, die Ambivalenzthese und die Katharsisthese. Die Katharsisthese wird als besonders kontrovers diskutiert und als angeblich widerlegt dargestellt, was die zentrale Fragestellung der Arbeit motiviert.
Ist die Katharsis-Hypothese tatsächlich widerlegt?: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Entstehung und Entwicklung des Katharsis-Konzepts. Es wird dessen Ursprung in der antiken griechischen Tragödie bei Aristoteles erläutert und die Weiterentwicklung durch Freud und Breuer im Kontext der Psychoanalyse dargestellt. Der Begriff der Katharsis wird definiert und verschiedene Interpretationen und Modifikationen werden vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Betrachtung der Studien, die die Katharsis-Hypothese widerlegen sollen. Diese Studien werden detailliert analysiert, um ihre methodischen Stärken und Schwächen zu beleuchten und so zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage beizutragen. Es werden sowohl Feldstudien als auch Experimente berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der Forschungslage zu zeichnen und die jeweilige Argumentationslinie der Studien zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Katharsis-Hypothese, Mediengewalt, Medienwirkungsforschung, Aggression, Frustration-Aggressions-Theorie, Empirische Forschung, Methodenkritik, Gewaltdarstellung, Medienkonsum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wirkung medialer Gewalt und die Katharsis-Hypothese
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die Katharsis-Hypothese in der Medienwirkungsforschung tatsächlich widerlegt ist. Sie analysiert die Entwicklung des Katharsis-Konzepts von Aristoteles bis Freud und bewertet Studien, die die Hypothese zu widerlegen versuchen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wirkung medialer Gewalt, die Entstehung und Entwicklung des Katharsis-Konzepts, eine kritische Auseinandersetzung mit Studien zur Widerlegung der Katharsis-Hypothese, die Analyse methodischer Probleme in der Forschung zur Mediengewalt, die Rolle von Mediengewalt in der gesellschaftlichen Debatte und den allgemeinen Einfluss von Mediengewalt.
Welche Studien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zahlreiche Studien, die die Katharsis-Hypothese zu widerlegen versuchen. Dies beinhaltet sowohl Feldstudien (z.B. Eron, Huesmann, Lefkowitz und Walder; Milavsky, Kessler, Stipp und Rubens) als auch Experimente (z.B. Berkowitz und Rawlings; Berkowitz und Geen; Geen, Stonner und Shope; Hartmann; Bandura, Ross und Ross; Tannenbaum und Goranson; Bushman, Stack und Baumeister). Die methodischen Stärken und Schwächen dieser Studien werden detailliert beleuchtet.
Welche methodischen Probleme werden angesprochen?
Die Arbeit identifiziert und diskutiert generelle methodische Probleme der Forschung zur Mediengewalt und fasst die Kritikpunkte an den untersuchten Studien zusammen. Dies trägt zur Bewertung der Gültigkeit der angeblichen Widerlegung der Katharsis-Hypothese bei.
Wie wird die Katharsis-Hypothese definiert und dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung des Katharsis-Konzepts von seinen Ursprüngen in der antiken griechischen Tragödie bei Aristoteles über die Weiterentwicklung durch Freud und Breuer bis hin zu verschiedenen Interpretationen und Modifikationen. Der Begriff der Katharsis wird präzise definiert.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht ein Fazit zur Frage, ob die Katharsis-Hypothese tatsächlich widerlegt ist, basierend auf der kritischen Analyse der präsentierten Studien und der Diskussion der methodischen Probleme. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Katharsis-Hypothese, Mediengewalt, Medienwirkungsforschung, Aggression, Frustration-Aggressions-Theorie, Empirische Forschung, Methodenkritik, Gewaltdarstellung, Medienkonsum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst mindestens zwei Hauptkapitel: "Wirkung medialer Gewalt" und "Ist die Katharsis-Hypothese tatsächlich widerlegt?". Das zweite Kapitel ist weiter unterteilt in Unterkapitel zur Entstehung und Entwicklung des Konzepts, der Analyse einzelner Studien und einer abschließenden Bewertung.
- Quote paper
- Sonja Kriependorf (Author), 2006, Ist das Katharsis-Konzept in der Medienwirkungsforschung tatsächlich widerlegt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94547