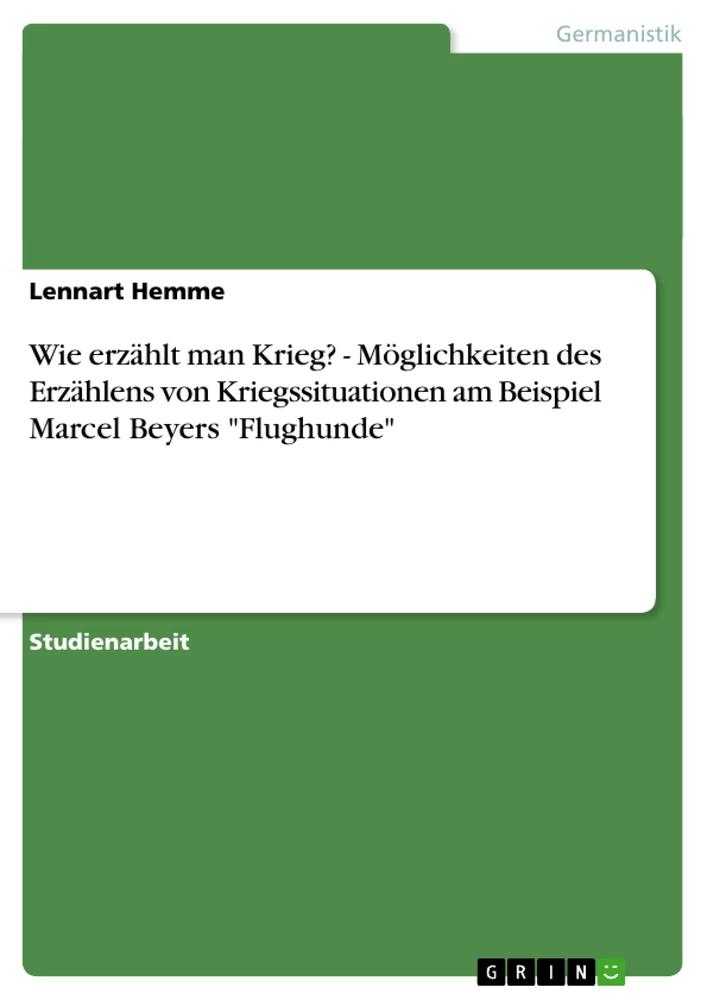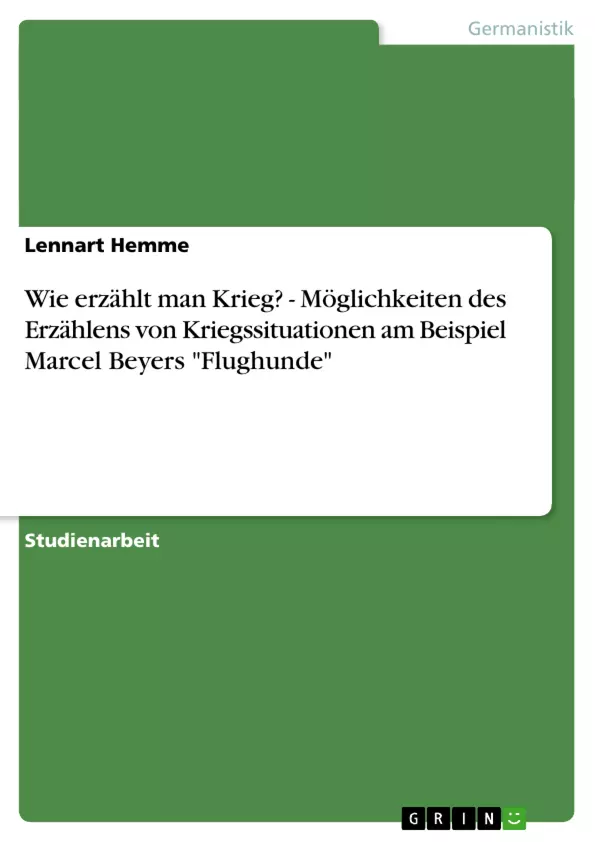Im Versuch, Krieg zu bewältigen, entwickelten sich verschiedenste Arten der Auseinandersetzung mit diesem heiklen Thema. In der Literatur ist der Stoff des Krieges in allen Formen ein Thema – eines der ältesten noch dazu. Doch wie verarbeitet der Einzelne seine ganz eigenen Traumata des Krieges in der modernen Kriegsliteratur? Welche Ansatzpunkte liefert Krieg als Stoff und der Mensch als Rezipient für die Vermittlung eines Tabus? Man spricht nicht von den Morden der Väter, doch wer es versucht, wandert auf einem schmalen Grat. Welchen Weg kann man einschlagen, um angemessen zu erreichen, was man sich zum Ziel gesetzt hat – sei es Mitgefühl, Wissen oder Bewusstsein zu vermitteln? Wie erzählt man Krieg?
Diese Arbeit entwickelt Kategorien, die die denkbare Erzählformen aufzeigen. Darauf aufbauend soll analysiert werden, ob und inwiefern Marcel Beyer sich der gegebenen Formen bedient, sie sich zu eigen macht und wie er sie forthin selbst entwickelt. Insbesondere wird hier das Motiv des Lärms und das der Stimme als Mittel zur Umsetzung untersucht. Entwirft Beyer eine eigene Poetik des Krieges? Welche bekannten Formen fließen darin ein und welchen Effekt erzielt er in seinem Roman damit?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Möglichkeiten des Erzählens von Krieg
- 2.1. Dokumentarstil
- 2.2. Subjektiv-emotionaler Stil
- 2.3. Elliptisch-parataktischer Stil
- 2.4. Die Groteske
- 3. Das Beispiel „Flughunde“
- 4. Reflexion
- 5. Literatur
- 5.1. Primärliteratur
- 5.2. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Möglichkeiten, Kriegserfahrungen literarisch darzustellen. Das Ziel ist die Entwicklung von Kategorien, die verschiedene Erzählformen aufzeigen und an Beispielen aus Marcel Beyers Roman „Flughunde“ analysieren. Der Fokus liegt auf der Analyse von Stilmitteln und ihrer Wirkung im Hinblick auf die Vermittlung von Kriegserfahrungen.
- Möglichkeiten des Erzählens von Krieg (Dokumentarischer Stil, subjektiv-emotionaler Stil, elliptisch-parataktischer Stil, Groteske)
- Analyse von Marcel Beyers Roman "Flughunde"
- Die Rolle von Lärm und Stimme in der Darstellung von Krieg
- Entwicklung einer Poetik des Krieges bei Marcel Beyer
- Vermittlung von Kriegserfahrungen und deren Wirkung auf den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Herausforderungen der literarischen Darstellung von Krieg und die Entwicklung verschiedener literarischer Strategien zur Bewältigung dieses Themas. Sie skizziert das Ziel der Arbeit, Kategorien für verschiedene Erzählformen zu entwickeln und diese am Beispiel von Marcel Beyers „Flughunde“ zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Mittel, die Beyer einsetzt, um die spezifische Ästhetik und die emotionale Wirkung seiner Darstellung zu erzeugen, und wie diese Mittel zur Vermittlung von Kriegserfahrungen beitragen.
2. Möglichkeiten des Erzählens von Krieg: Dieses Kapitel erörtert verschiedene Stile der Kriegsdarstellung, die zwischen Objektivität und Subjektivität angesiedelt sind. Es werden der Dokumentarstil, subjektiv-emotionale Erzählweisen, elliptisch-parataktische Stile und die Groteske als mögliche Kategorien vorgestellt und anhand von Beispielen aus der Literatur erläutert. Die Kapitel unterstreicht die Komplexität der Thematik und die Schwierigkeiten, eindeutige Kategorien zu bilden. Die Einordnung der verschiedenen Stile erfolgt auf einer imaginären Achse zwischen Objektivität und Subjektivität, wobei Mischformen und Unschärfen betont werden.
2.1. Dokumentarstil: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf den dokumentarischen Stil im Kontext der Kriegsliteratur. Er diskutiert die Ambivalenz des Anspruchs auf Objektivität in vermeintlich dokumentarischen Texten und verweist auf den "Zweifel am Medium Sprache" als Kontext für die Entwicklung unterschiedlicher Schreibweisen. Die Rolle des Autors als Materialkomponist wird hervorgehoben, wobei die Anordnung von Sprache, anstatt deren Kreation, im Vordergrund steht. Als Beispiele werden Walter Kempowskis "Echolot" und Alexander Kluges "Der Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945" analysiert, wobei die jeweiligen Strategien der Objektivierung herausgestellt werden. Das Kapitel verdeutlicht die Unterschiede zwischen faktischer Dokumentation und pseudo-dokumentarischen Werken.
Schlüsselwörter
Kriegsliteratur, Erzähltheorie, Marcel Beyer, Flughunde, Dokumentarstil, Subjektivität, Objektivität, Kriegserfahrung, Stilmittel, Poetik, Lärm, Stimme.
Häufig gestellte Fragen zu "Flughunde" - Marcel Beyer
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert verschiedene literarische Strategien zur Darstellung von Kriegserfahrungen. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Kategorien zur Beschreibung unterschiedlicher Erzählformen und deren Anwendung auf Marcel Beyers Roman "Flughunde".
Welche Erzählformen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Stile der Kriegsdarstellung, darunter den Dokumentarstil, subjektiv-emotionale Erzählweisen, elliptisch-parataktische Stile und die Groteske. Diese werden anhand von Beispielen aus der Literatur erläutert und in Bezug zu ihrer Objektivität bzw. Subjektivität gesetzt. Mischformen und Unschärfen der Kategorien werden explizit betont.
Wie wird der Dokumentarstil im Kontext der Arbeit behandelt?
Der Abschnitt zum Dokumentarstil diskutiert die Ambivalenz des Anspruchs auf Objektivität in vermeintlich dokumentarischen Texten. Er betont den "Zweifel am Medium Sprache" und die Rolle des Autors als Materialkomponist, der Sprache anordnet anstatt sie zu kreieren. Beispiele wie Walter Kempowskis "Echolot" und Alexander Kluges "Der Luftangriff auf Halberstadt" werden analysiert.
Welche Rolle spielt Marcel Beyers "Flughunde"?
Marcel Beyers Roman "Flughunde" dient als Fallbeispiel, um die entwickelten Kategorien zur Analyse verschiedener Erzählformen anzuwenden. Die Arbeit untersucht die Stilmittel in Beyers Roman und deren Wirkung auf die Vermittlung von Kriegserfahrungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten des Erzählens von Krieg, der Analyse von "Flughunde", der Rolle von Lärm und Stimme in der Kriegsdarstellung, der Entwicklung einer Poetik des Krieges bei Beyer und der Vermittlung von Kriegserfahrungen und deren Wirkung auf den Leser.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Möglichkeiten des Erzählens von Krieg (inkl. Unterkapitel zu verschiedenen Stilen), ein Kapitel zum Beispiel "Flughunde", eine Reflexion und ein Literaturverzeichnis (Primär- und Sekundärliteratur).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kriegsliteratur, Erzähltheorie, Marcel Beyer, Flughunde, Dokumentarstil, Subjektivität, Objektivität, Kriegserfahrung, Stilmittel, Poetik, Lärm, Stimme.
Welches ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung von Kategorien zur Beschreibung verschiedener Erzählformen in der Kriegsliteratur und deren Anwendung auf ein konkretes Beispiel, um die unterschiedlichen Möglichkeiten der literarischen Darstellung von Kriegserfahrungen zu analysieren.
- Arbeit zitieren
- Lennart Hemme (Autor:in), 2008, Wie erzählt man Krieg? - Möglichkeiten des Erzählens von Kriegssituationen am Beispiel Marcel Beyers "Flughunde", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94563