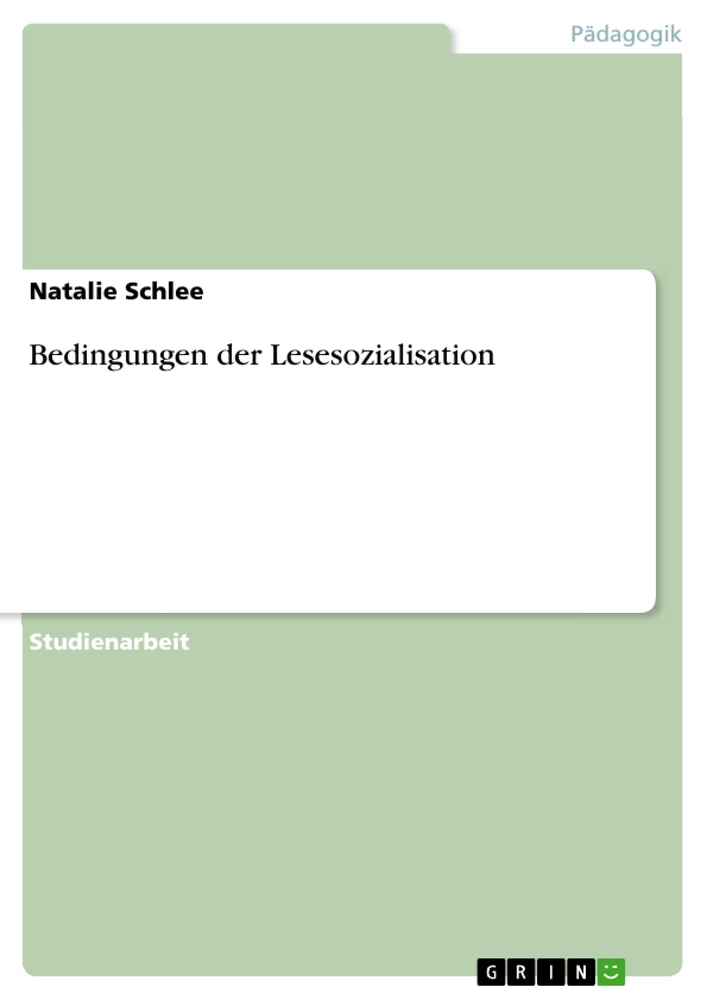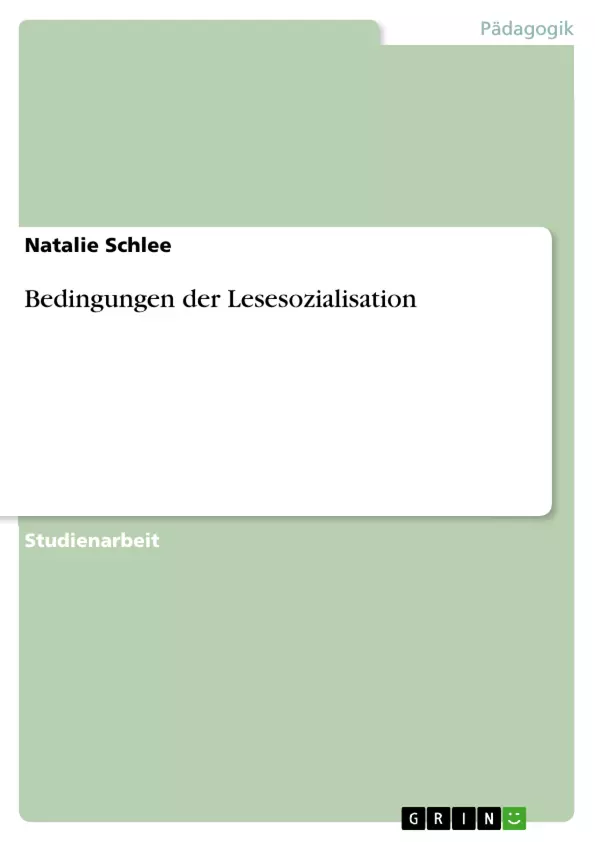Lesen spielt in unserem Berufs- und Privatleben eine wichtige Rolle. Um sich im Alltag zu orientieren und sich Wissen anzueignen ist eine ausreichende Lesekompetenz unabdingbar. Die Lesekompetenz ist vor allem das Ergebnis der Lesesozialisation, der Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens mit dem Lesen und Lesemedien macht. Die Lesesozialisations-forschung untersucht daher, welche sozialen Faktoren, welche Einflüsse und Bedingungen für die Entwicklung zukünftiger Leser förderlich sind, und welche Hindernisse dem individuellen Werdegang zum Leser im Wege stehen.
Eine Verschärfung der Diskussion um die Lesesozialisation ist nach dem Erscheinen der Ergebnisse der PISA-Studie 2000 eingetreten, in der die deutschen Jugendlichen im Bereich der Lesekompetenz unterdurchschnittlich abgeschnitten haben.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Frage nach den Bedingungen und Einflüssen der Lesesozialisation bei Jugendlichen auseinander. Als erstes wird dabei kurz der Begriff der Lesesozialisation definiert. Als nächstes werden die wesentlichen Bedingungsfaktoren der Lesesozialisation dargestellt. Neben sozialer Herkunft und Bildung bestimmt vor allem das Geschlecht, ob man eher viel oder eher wenig liest. Im nächsten Schritt werden die Einflüsse der Lesesozialisationsinstanzen betrachtet. In der einschlägigen Forschung werden haupt-sächlich drei Instanzen der Lesesozialisation thematisiert: die Familie, weil dort die frühesten und die umfassendsten Bezüge zum Lesen hergestellt werden; die Schule und die peer groups, die mit dem Älterwerden an Bedeutung gewinnen, deren konkreter Stellenwert im Prozess der Lesesozialisation aber noch wenig erforscht ist.
Abschließend wird ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Definition Lesesozialisation
- 2. Bedingungsfaktoren der Lesesozialisation
- 2.1 Soziale Schicht
- 2.2 Geschlecht
- 3. Instanzen der Lesesozialisation
- 3.1 Familie
- 3.2 Schule
- 3.3 Peers
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Bedingungen und Einflüssen der Lesesozialisation bei Jugendlichen. Die Arbeit untersucht die Definition des Begriffs der Lesesozialisation, analysiert die wichtigsten Bedingungsfaktoren wie soziale Herkunft und Geschlecht und betrachtet die Einflüsse von verschiedenen Lesesozialisationsinstanzen.
- Definition des Begriffs Lesesozialisation
- Soziale Schicht als Bedingungsfaktor
- Geschlecht als Bedingungsfaktor
- Die Familie als Instanz der Lesesozialisation
- Schule und Peer Groups als weitere Instanzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Lesesozialisation bei Jugendlichen ein und verdeutlicht die Bedeutung des Lesens im Alltag. Kapitel 1 definiert den Begriff der Lesesozialisation und beschreibt ihn als einen dialektischen Prozess der Herausbildung des Einzelnen im Umgang mit literarischen Medien. Kapitel 2 analysiert die Bedingungsfaktoren der Lesesozialisation. Neben der sozialen Schicht, die eine dominante Rolle im Prozess der Lesesozialisation spielt, wird das Geschlecht als ein weiterer bedeutsamer Faktor betrachtet. Kapitel 3 befasst sich mit den Instanzen der Lesesozialisation und untersucht die Einflüsse von Familie, Schule und Peer Groups.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Lesesozialisation, insbesondere mit den Bedingungsfaktoren wie sozialer Schicht, Geschlecht und den verschiedenen Instanzen der Lesesozialisation, wie Familie, Schule und Peer Groups. Die Analyse greift auf wissenschaftliche Studien und Forschungsarbeiten zur Lesesozialisation zurück und beleuchtet die Bedeutung von Lesekompetenz in der Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Natalie Schlee (Autor:in), 2008, Bedingungen der Lesesozialisation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94616