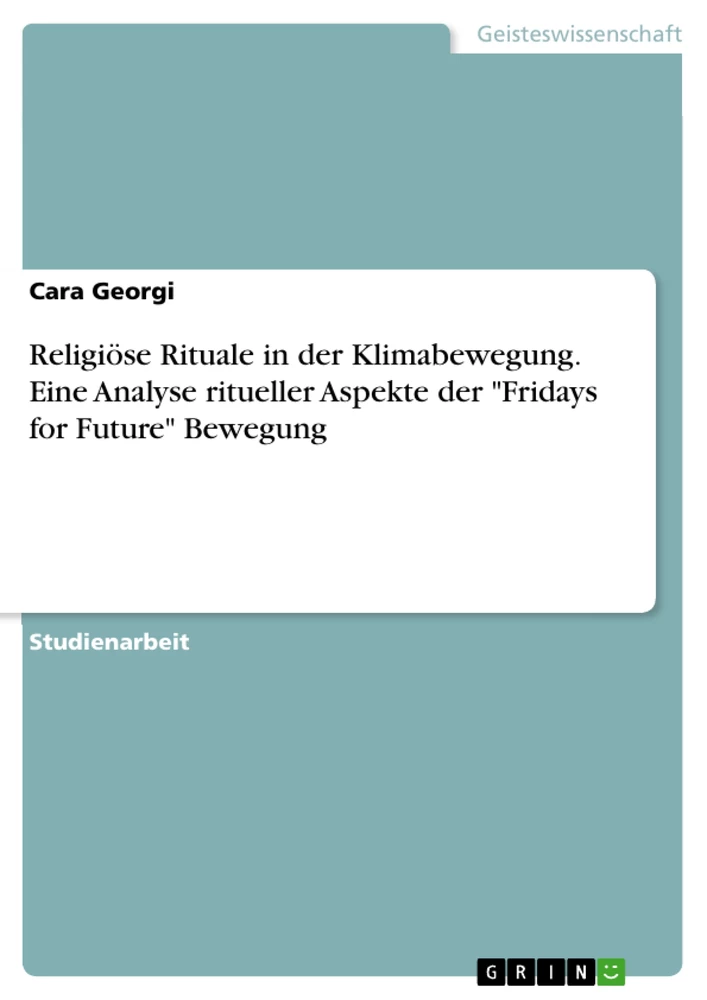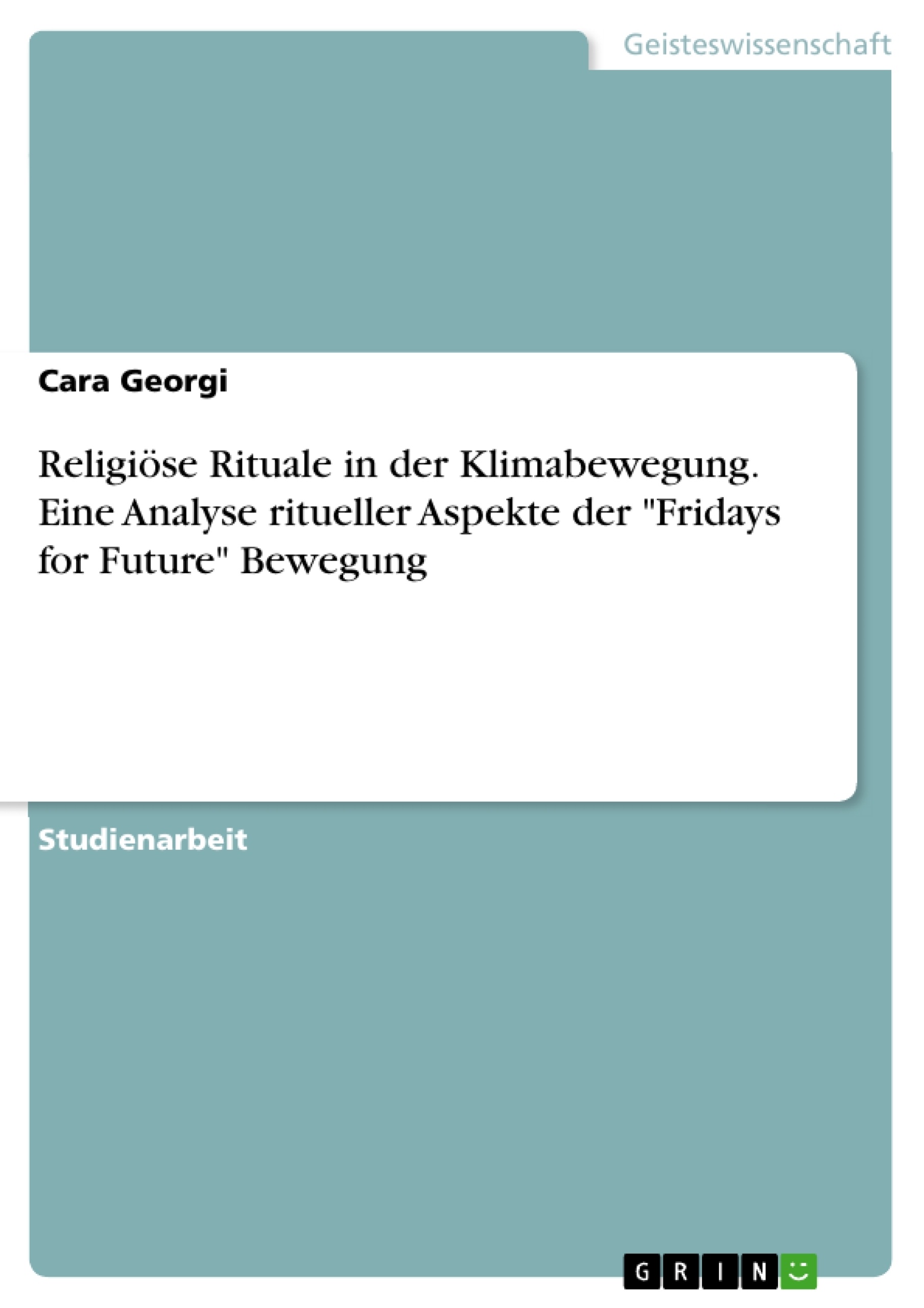In dieser Hausarbeit wird analysiert, ob der Argumentation der "Fridays for Future" Bewegung religiöse Rituale und Denkmuster in moderner Abwandlung zugrunde liegen.
Dies einer ethnologischen Betrachtung zu unterziehen ist interessant, da das Fortführen bestehender Denkmuster und deren Erneuerung viel über gesellschaftliche und kulturelle Prozesse aussagt. Für mich ist es zudem spannend, dass Menschen ihrer Meinung nach ebenso rationale Gründe haben religiöse Rituale durchzuführen, wie es die FFF AnhängerInnen proklamieren. Diese platonische Gemeinsamkeit lässt einen interessanten Vergleich zu.
Die angewandte Methode dieser Arbeit ist die Analyse eines modernen Phänomens anhand etablierter Denkmuster unserer Kultur. Zu Beginn wird der Begriff des „Rituals“ in ethnologischen Forschungen veranschaulicht. Ein Kurzporträt der FFF Bewegung soll anschließend ihr inhärenten rituellen Aspekte aufdecken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ritual
- Ethnologische Ritualforschung: Ein Versuch
- Religion nach Geertz
- Rationalismus
- Fridays for Future Klimabewegung
- Ein Kurzprofil
- Werte
- Rituelle Aspekte in der FFF Bewegung
- Handlungsorientierungen
- Dualismus
- Erste Reflexion
- Exkurs: Greta Thunberg als moderne Prophetin
- Prophetie
- Greta Thunberg
- Zusammenfassung und persönliche Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob der Argumentation der „Fridays for Future“ Bewegung religiöse Rituale und Denkmuster in moderner Abwandlung zugrunde liegen. Ziel ist es, die FFF Bewegung anhand etablierter Denkmuster unserer Kultur zu analysieren und rituelle Handlungen als Elemente gesellschaftlicher Entwicklungen zu begreifen.
- Rituale als Ausdruck kultureller Gepflogenheiten und Wertesysteme
- Religiöse Rituale im Kontext des modernen Rationalismus
- Die Rolle von Führungspersönlichkeiten in der FFF Bewegung
- Vergleich von religiösen und säkularen Handlungsorientierungen
- Die Bedeutung der Wissenschaft im Diskurs der Klimabewegung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Bedeutungszuwachs der Wissenschaft und die Schwierigkeit, sich einer klassischen Religiosität hinzugeben, insbesondere im europäischen Raum. Die FFF Bewegung wird als eine Bewegung vorgestellt, die moralische Orientierungspunkte im Kontext einer komplexen und informationsreichen Welt bietet. Greta Thunberg wird als moderne Prophetin dargestellt, die mit wissenschaftlichen Argumenten moralische Orientierungspunkte eröffnet.
- Ritual: Dieses Kapitel stellt verschiedene Perspektiven auf den Begriff des Rituals vor, beginnend mit der ethnologischen Ritualforschung und der Definition von Ritualen als wiederkehrende Handlungen, Bräuche oder Sitten. Die Arbeit diskutiert die Problematik von Definitionen, die stets vom eigenen kulturellen Hintergrund geprägt sind und den Blick auf das "Fremde" beeinflussen. Durkheims Verständnis von Ritualen als Mittelweg zwischen dem "Heiligen" und dem "Profanen" wird dargestellt, sowie die Bedeutung von Ritualen für die Gesellschaft und die Bewältigung der Unbestimmtheit der Realität.
- Religion nach Geertz: Hier wird Geertz' Definition von Religion als ein Symbolsystem vorgestellt, das starke und dauerhafte Stimmungen und Motivationen schafft, indem es Vorstellungen einer allgemeinen Seinsordnung formuliert. Religiöse Rituale werden als lebendige Repräsentation dieses "Symbolsystems" betrachtet, die dazu beitragen, diese (fiktiven) Ideen in der Realität zu leben.
- Rationalismus: Dieses Kapitel beleuchtet die Rationalisierung von Bedürfnissen im europäischen Kulturraum. Der immense Wissensschatz der heutigen Generation wird als ein Faktor für die kritische Hinterfragung klassischer Erklärungen der Seinsordnung dargestellt. Wissenschaftliche Erklärungen haben Vorrang vor erlebnisbasierten, jedoch schließen sich beide Seiten nicht automatisch aus. Die heutige Schüler*innen-Generation wird als irdisch und säkular ausgerichtet beschrieben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind rituelle Aspekte der Klimabewegung, insbesondere der Fridays for Future Bewegung, sowie deren Beziehung zu religiösen Denkmustern im Kontext des modernen Rationalismus. Die Arbeit beschäftigt sich mit Begriffen wie Ritual, Religion, Ethnologie, Rationalismus, Prophetie, Greta Thunberg und gesellschaftliche Entwicklungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche religiösen Aspekte finden sich bei Fridays for Future?
Die Bewegung nutzt rituelle Handlungen und moralische Orientierungsmuster, die klassischen religiösen Strukturen ähneln, um Sinn und Gemeinschaft zu stiften.
Wird Greta Thunberg als religiöse Figur betrachtet?
In der Analyse wird Greta Thunberg als eine Art moderne Prophetin beschrieben, die wissenschaftliche Fakten nutzt, um moralische Imperative zu verkünden.
Was definiert ein Ritual in der Klimabewegung?
Rituale sind wiederkehrende Handlungen, wie die wöchentlichen Streiks, die als Ausdruck gemeinsamer Werte und zur Bewältigung von Zukunftsängsten dienen.
Wie passt der Rationalismus zur rituellen Natur von FFF?
Trotz eines säkularen und wissenschaftsbasierten Weltbildes nutzen Anhänger rituelle Formen, um ihre Forderungen emotional und gesellschaftlich zu verankern.
Was ist das "Heilige" und "Profane" bei Fridays for Future?
Nach Durkheim könnten die unantastbaren wissenschaftlichen Fakten und die Natur als das "Heilige" fungieren, während das politische Tagesgeschäft das "Profane" darstellt.
Welche Rolle spielt die Wissenschaft im Diskurs?
Die Wissenschaft dient der Bewegung als unfehlbare Quelle der Wahrheit, ähnlich wie religiöse Schriften in Glaubensgemeinschaften.
- Quote paper
- Cara Georgi (Author), 2020, Religiöse Rituale in der Klimabewegung. Eine Analyse ritueller Aspekte der "Fridays for Future" Bewegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/946868