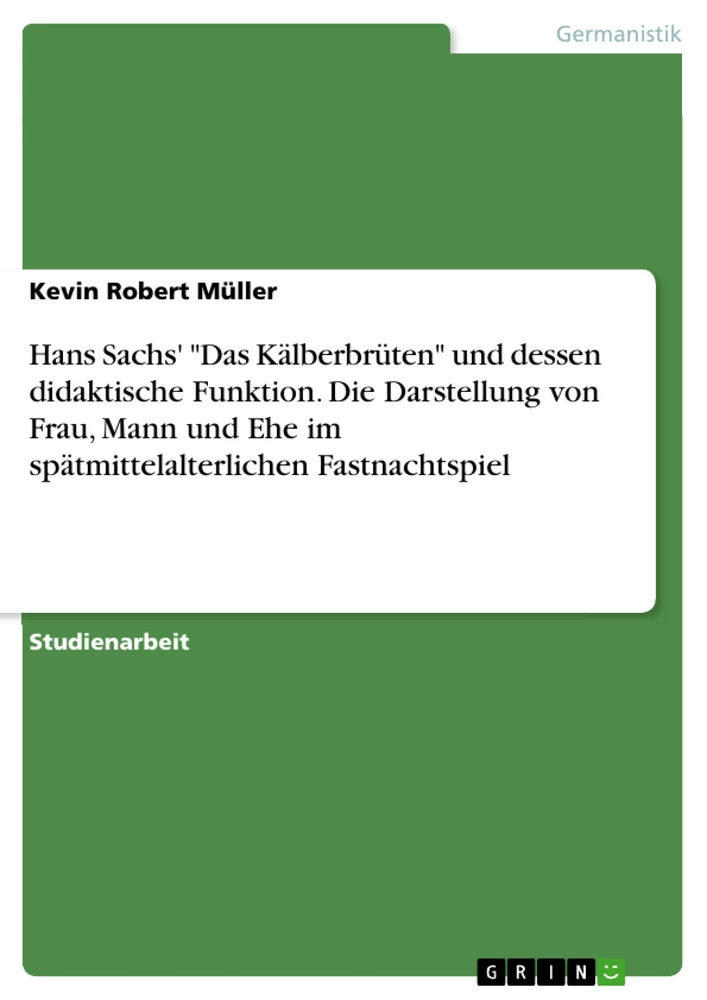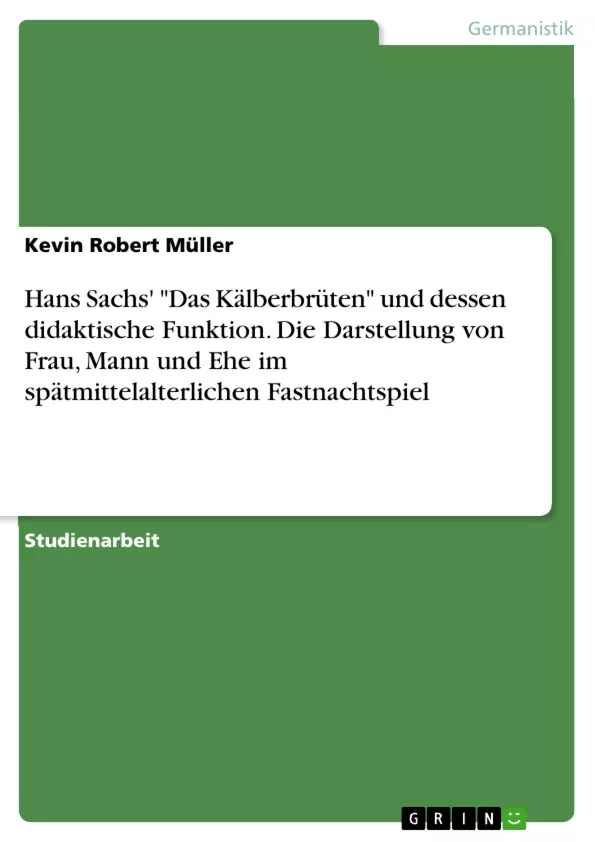Diese Arbeit widmet sich dem Fastnachtspiel "Das Kälberbrüten" von Hans Sachs, welches in der Mitte des 16. Jahrhunderts erschien. Anhand dieses Beispiels karnevalesker, theatralischer Aufführungskunst soll veranschaulicht werden, auf welche Weise Frauen und Männerrollen im ehelichen Kontext in Fastnachtspielen des ausgehenden Mittelalters dargeboten wurden und welche didaktischen Zwecke im Falle dieses Beispiels dabei im Hintergrund wirksam waren.
Hierfür wird zunächst die Gattung des spätmittelalterlichen beziehungsweise frühneuzeitlichen Fastnachtspiels im Allgemeinen betrachtet und diskutiert, worin sich dieses von anderen, möglicherweise kontextuell verwandten Genrebezeichnungen unterscheidet. Im gleichen Zug wird der bisherige Forschungsstand umrissen. Anschließend wird der Primärtext von Hans Sachs vorgestellt und zur genaueren Untersuchung herangezogen.
Darauf folgt eine Darstellung von Ehemann und -frau in "Das Kälberbrüten", bei welcher die charakteristischen Motive im Fokus stehen. Hierbei wird zum einen auf das Motiv der Verkehrung eingegangen und die didaktische Funktion des Kälberbrütens erläutert. Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, welche Schlüsse die Untersuchung über Didaktik und Intentionalität des vorgestellten Fastnachtspieles ziehen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zu der Gattung des Fastnachtspiels im Allgemeinen und dem Kälberbrüten von Hans Sachs im Speziellen
- 3. Das Motiv der Verkehrung
- 4. Die Darstellung von Ehe, -frau und -mann im Kälberbrüten
- 4.1 Motive der Verkehrung im Kälberbrüten
- 4.2 Über die didaktische Funktion des Kälberbrütens
- 5. Fazit
- 6. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Fastnachtspiel „Das Kälberbrüten“ von Hans Sachs, geschrieben Mitte des 16. Jahrhunderts. Im Fokus steht die Darstellung von Geschlechterrollen und Ehe im Kontext der karnevalesken Aufführungskunst des ausgehenden Mittelalters. Dabei wird insbesondere die Frage nach der didaktischen Funktion des Spiels untersucht.
- Die Gattungsdefinition des Fastnachtspiels und seine Abgrenzung von anderen Genrebezeichnungen
- Das Motiv der Verkehrung im Fastnachtspiel und seine mögliche Interpretation als Zeitkritik oder Ermahnung
- Die Darstellung von Ehe, Frau und Mann im Kälberbrüten und die charakteristischen Motive der Verkehrung
- Die Rolle von Didaktik und Intentionalität im Fastnachtspiel und die Schlussfolgerungen aus der Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erklärt den Kontext des Fastnachtspiels im späten Mittelalter. Sie erläutert die Bedeutung des Kälberbrütens von Hans Sachs und grenzt den Begriff des Fastnachtspiels von anderen Gattungen ab. Weiterhin wird der Forschungsstand zur Darstellung von Geschlechterrollen in mittelalterlichen Texten skizziert.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Gattung des Fastnachtspiels im Allgemeinen und das Kälberbrüten von Hans Sachs im Besonderen. Es werden die Definition und Entwicklung des Fastnachtspiels sowie die Bedeutung dieser Gattung in der Reformationszeit dargestellt.
Kapitel drei analysiert das Motiv der Verkehrung im Fastnachtspiel. Hier wird erklärt, wie die Verkehrung von gesellschaftlichen Normen im Fastnachtsspiel durch Parodie, Satire und Hyperbolik inszeniert wird. Es wird auch die Frage nach der Intention der Verkehrung – als Zeitkritik oder Ermahnung – beleuchtet.
Kapitel vier behandelt die Darstellung von Ehe, Frau und Mann im Kälberbrüten. Es untersucht die Motive der Verkehrung, die in diesem Spiel auftreten, und wie diese die Geschlechterrollen in Frage stellen. Außerdem wird die didaktische Funktion des Spiels im Kontext dieser Darstellung analysiert.
Schlüsselwörter
Fastnachtspiel, Hans Sachs, Kälberbrüten, Verkehrung, Gender, Ehe, Frau, Mann, Didaktik, Mittelalter, Reformationszeit, theatralische Aufführungskunst, karnevaleske Kultur, Zeitkritik, Ermahnung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Hans Sachs' „Das Kälberbrüten“?
Es ist ein Fastnachtspiel aus dem 16. Jahrhundert, das Geschlechterrollen und die Ehe durch das Motiv der „Verkehrung“ parodiert.
Was ist das Motiv der „Verkehrung“?
Es bezeichnet die inszenierte Umkehrung gesellschaftlicher Normen (z.B. Rollentausch zwischen Mann und Frau), oft zu didaktischen oder satirischen Zwecken.
Welche didaktische Funktion hat das Stück?
Durch die lächerliche Darstellung absurden Verhaltens (Kälberbrüten) soll das Publikum zur Besinnung auf die „richtige“ Ordnung in Ehe und Gesellschaft gemahnt werden.
Wie wird die Frau im Fastnachtspiel dargestellt?
Oftmals werden stereotype Rollenbilder verwendet, die im Kontext der karnevalesken Aufführungskunst entweder bestätigt oder provokant in Frage gestellt werden.
In welcher Zeit entstand das Werk?
Das Stück erschien Mitte des 16. Jahrhunderts, einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs während der Reformation.
- Quote paper
- Kevin Robert Müller (Author), 2016, Hans Sachs' "Das Kälberbrüten" und dessen didaktische Funktion. Die Darstellung von Frau, Mann und Ehe im spätmittelalterlichen Fastnachtspiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947178