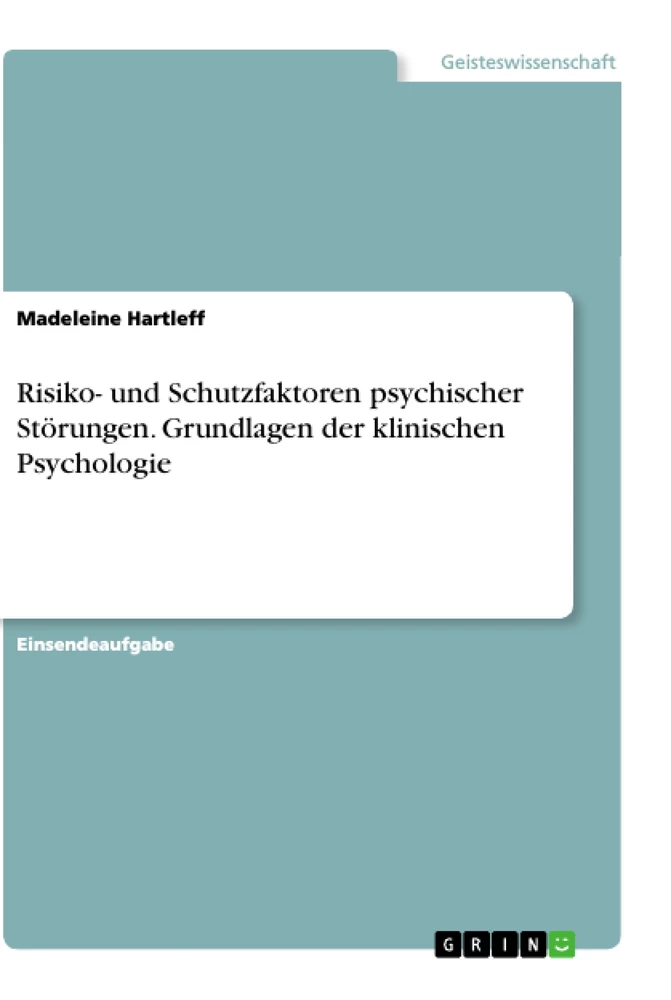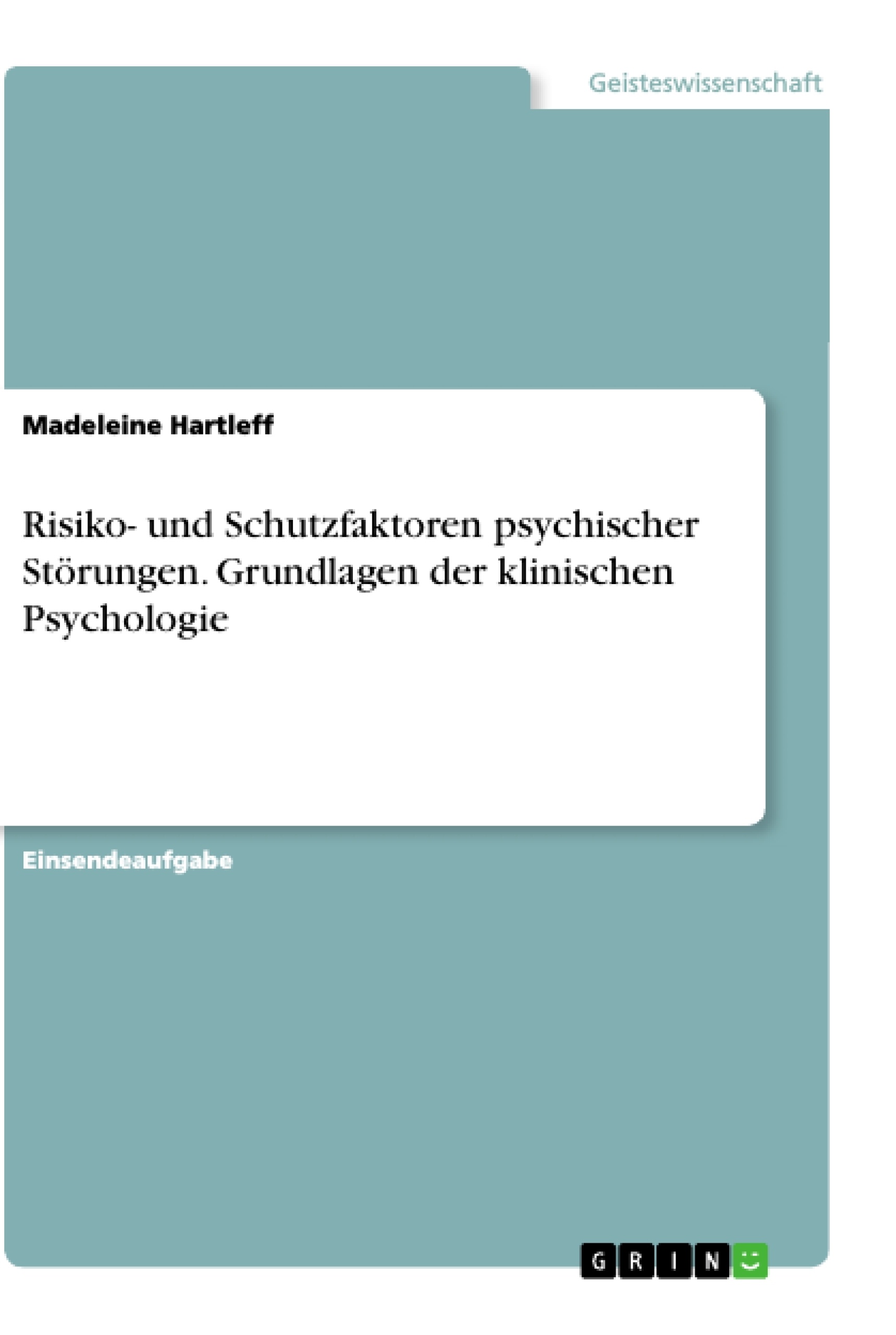Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der klinischen Psychologie. Zunächst wird unter Bezugnahme von empirischen Ergebnissen die Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren für die Entstehung von psychischen Störungen erläutert. Anschließend wird anhand theoretischer Modelle und empirischer Ergebnisse der Einfluss sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognition auf die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen behandelt. Anhand eines selbstgewählten Beispiels werden abschließend die einzelnen Schritte des diagnostischen Prozesses im Rahmen der psychotherapeutischen Intervention dargestellt.
Die Forschung rund um die klinische Psychologie konnte bis heute nicht eindeutig die Frage beantworten, warum manche Personen an einer psychischen Störung erkranken und andere mit gleichen Umständen nicht. Die Gründe hierfür sind vielfältig und liegen in den persönlichen Risiko- und Schutzfaktoren einer Person. Risikofaktoren werden aus den destabilisierenden Bestandteilen hervorgebracht und stabilisierende Umstände gestalten die Schutzfaktoren.
Die soziale Unterstützung ist eine besondere Form der Schutzfaktoren. Es gibt im Leben eines Menschen viele Stressoren, bei welchen eine Unterstützung von außen hilfreich sein kann. Der schlimmste Fall ist vermutlich der Tod eines Angehörigen. Es gibt jedoch auch andere belastende Situationen, die eine psychische Störung begünstigen können oder dazu führen, dass eine bestehende psychische Störung aufrechterhalten bleibt.
Inhaltsverzeichnis
- Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen
- Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Störungen
- Schutzfaktoren für die Entstehung psychischer Störungen
- Soziale Unterstützung und dysfunktionale Kognitionen und deren Verbindung zu psychischen Störungen
- Einfluss sozialer Unterstützung auf die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen
- Einfluss dysfunktionaler Kognitionen auf die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen
- Schritte des diagnostischen Prozesses im Rahmen einer psychotherapeutischen Intervention am Beispiel Substanzgebrauchsstörung
- Fallbeispiel: alkoholbezogene Substanzgebrauchsstörung
- Der diagnostische Prozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Grundlagen der klinischen Psychologie. Ziel ist es, Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen zu beleuchten, den Einfluss sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognitionen zu untersuchen und den diagnostischen Prozess anhand eines Fallbeispiels zu veranschaulichen.
- Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen
- Einfluss sozialer Unterstützung auf die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen
- Einfluss dysfunktionaler Kognitionen auf psychische Gesundheit
- Diagnostischer Prozess bei Substanzgebrauchsstörungen
- Anwendung klinisch-psychologischer Konzepte anhand eines Fallbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen: Dieses Kapitel analysiert die Faktoren, die zur Entstehung psychischer Störungen beitragen oder diese verhindern. Es differenziert zwischen Risikofaktoren, die das Auftreten psychischer Erkrankungen erhöhen, und Schutzfaktoren, die einem entgegenwirken. Die Diskussion beinhaltet wahrscheinlich eine Auseinandersetzung mit biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren, die die Vulnerabilität für psychische Störungen beeinflussen. Es wird ein breites Spektrum an potenziellen Einflussfaktoren beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis der komplexen Interaktionen zu ermöglichen, die zu psychischen Problemen führen oder deren Entstehung verhindern können.
Soziale Unterstützung und dysfunktionale Kognitionen und deren Verbindung zu psychischen Störungen: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung, dysfunktionalen Kognitionen und der Entstehung bzw. Aufrechterhaltung psychischer Störungen. Es wird der Einfluss von positiven sozialen Beziehungen auf die psychische Gesundheit erörtert und wie mangelnde soziale Unterstützung die Vulnerabilität für psychische Erkrankungen erhöht. Gleichzeitig wird der Einfluss negativer Denk- und Verhaltensmuster, der dysfunktionalen Kognitionen, auf die Entwicklung und den Verlauf psychischer Störungen analysiert. Der Zusammenhang zwischen beiden Faktoren wird beleuchtet, um ein ganzheitliches Bild der Interaktion zwischen sozialen, kognitiven und psychischen Prozessen zu vermitteln.
Schritte des diagnostischen Prozesses im Rahmen einer psychotherapeutischen Intervention am Beispiel Substanzgebrauchsstörung: Dieses Kapitel beschreibt den diagnostischen Prozess im Kontext einer psychotherapeutischen Intervention, wobei eine Substanzgebrauchsstörung als Fallbeispiel dient. Es werden die einzelnen Schritte des diagnostischen Prozesses detailliert erläutert, angefangen von der Anamneseerstellung bis zur Diagnosefindung. Anhand des Fallbeispiels einer alkoholbezogenen Substanzgebrauchsstörung wird der praktische Ablauf des Prozesses veranschaulicht, und es wird gezeigt, wie verschiedene diagnostische Werkzeuge und Methoden angewendet werden, um eine umfassende Beurteilung des Patienten zu ermöglichen. Die Bedeutung der sorgfältigen Diagnostik für die Planung und Durchführung einer erfolgreichen Therapie wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Psychische Störungen, Risiko- und Schutzfaktoren, Soziale Unterstützung, Dysfunktionale Kognitionen, Diagnostischer Prozess, Substanzgebrauchsstörung, Klinische Psychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen, Soziale Unterstützung, Dysfunktionale Kognitionen und Diagnostischer Prozess
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der klinischen Psychologie. Es behandelt Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen, den Einfluss sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognitionen sowie den diagnostischen Prozess bei psychischen Erkrankungen, insbesondere am Beispiel einer Substanzgebrauchsstörung.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument deckt folgende Themen ab: Risikofaktoren und Schutzfaktoren für psychische Störungen, den Einfluss sozialer Unterstützung auf die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen, den Einfluss dysfunktionaler Kognitionen auf die psychische Gesundheit, den diagnostischen Prozess bei Substanzgebrauchsstörungen (am Beispiel einer alkoholbezogenen Störung) und die Anwendung klinisch-psychologischer Konzepte anhand eines Fallbeispiels.
Welche Kapitel sind enthalten und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Dokument gliedert sich in drei Hauptkapitel: Das erste Kapitel analysiert Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen, wobei biologische, psychologische und soziale Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Das zweite Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung, dysfunktionalen Kognitionen und psychischen Störungen. Das dritte Kapitel beschreibt detailliert den diagnostischen Prozess bei einer Substanzgebrauchsstörung anhand eines Fallbeispiels, inklusive Anamneseerstellung und Diagnosefindung.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen zu vermitteln. Es soll die Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren, sozialer Unterstützung und kognitiver Prozesse verdeutlicht und der diagnostische Prozess in der klinischen Praxis veranschaulicht werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Psychische Störungen, Risiko- und Schutzfaktoren, Soziale Unterstützung, Dysfunktionale Kognitionen, Diagnostischer Prozess, Substanzgebrauchsstörung, Klinische Psychologie.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument eignet sich für Studierende der Psychologie und verwandter Disziplinen, die sich mit den Grundlagen der klinischen Psychologie befassen. Es kann auch für Psychotherapeuten und andere Fachkräfte im Gesundheitswesen von Interesse sein.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten und listet alle wichtigen Kapitel und Unterkapitel auf. Es umfasst die Themen Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen, soziale Unterstützung und dysfunktionale Kognitionen im Zusammenhang mit psychischen Störungen sowie den diagnostischen Prozess am Beispiel einer Substanzgebrauchsstörung.
Gibt es Fallbeispiele?
Ja, das Dokument enthält ein Fallbeispiel einer alkoholbezogenen Substanzgebrauchsstörung, um den diagnostischen Prozess zu veranschaulichen.
Wie ist der diagnostische Prozess dargestellt?
Der diagnostische Prozess wird Schritt für Schritt erklärt, von der Anamneseerstellung bis zur Diagnosefindung. Das Fallbeispiel veranschaulicht die Anwendung verschiedener diagnostischer Werkzeuge und Methoden.
- Arbeit zitieren
- Madeleine Hartleff (Autor:in), 2020, Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen. Grundlagen der klinischen Psychologie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947195