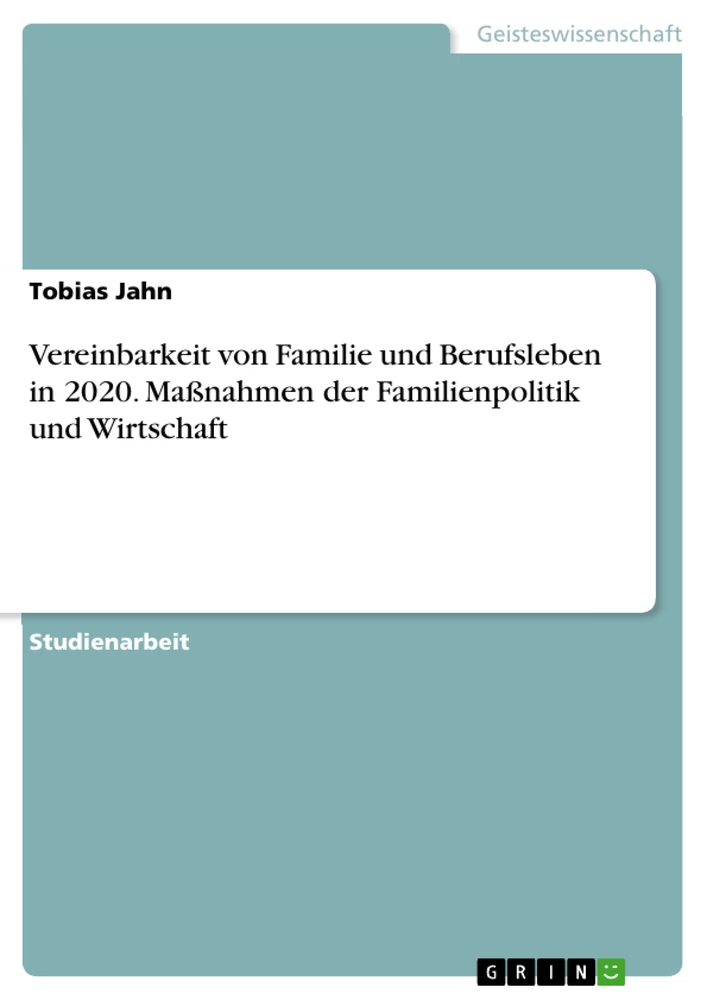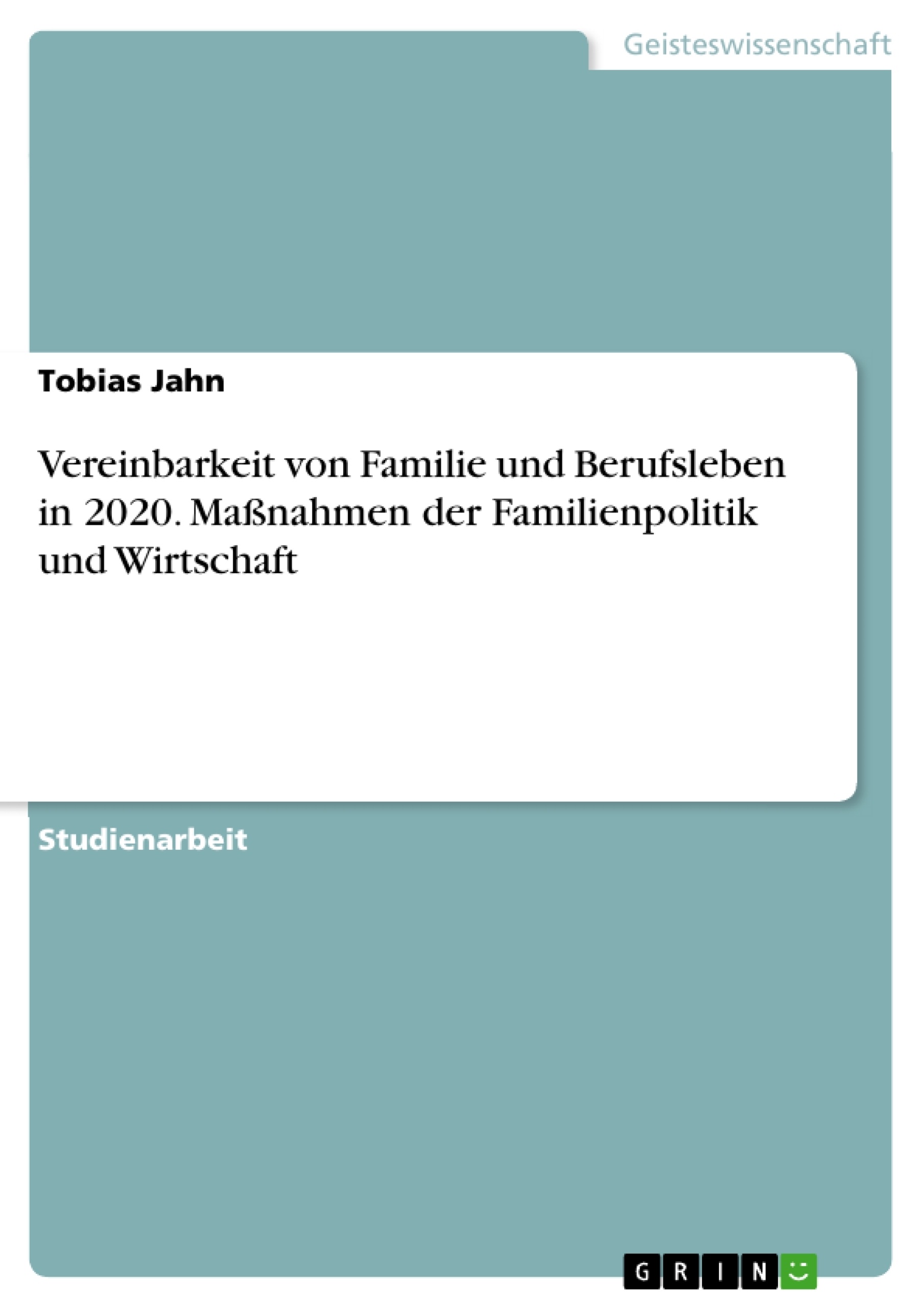Diese Arbeit beschäftigt sich mit Konzepten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland. Kern der Arbeit ist damit die Analyse von bestehenden Konzepten. Das Verständnis der Begriffe Familie, Beruf und Vereinbarkeit bildet die Grundlage für die Darlegung der heute in Deutschland anzutreffenden Lage von Familien, aus welcher sich wichtige Schlussfolgerungen für die Akteure in Politik und Wirtschaft ergeben. Im nächsten Schritt wird die Beschreibung umgesetzter Maßnahmen auf Ebene der Familienpolitik, aber auch seitens der Wirtschaft exemplarisch erfolgen. Anschließend werden diese kritisch der Lebenswirklichkeit in Deutschland gegenübergestellt und so bewertet.
Die Mutter am Herd, der Vater arbeitet bis spät abends. Einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge scheint es ganz einfach, dieses tradierte Bild aufzusprengen: Mehr Ganztagsangebote für Grundschulkinder sind der Auslöser für mehr erwerbstätige Mütter. Doch ist diese Lösung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland wirklich so formelhaft und einfach möglich?
Was bedeutet überhaupt Vereinbarkeit? Ist das beschriebene Bild der verheirateten Kernfamilie samt des sogenannten Ernährermodells überhaupt noch typisch für Deutschland? Was geschieht im Land in Bezug auf Familienfreundlichkeit? Welche Maßnahmen ergreift die Familienpolitik und inwiefern beteiligen sich wirtschaftliche Akteure im Prozess? Diese Fragen sollen im Rahmen der Hausarbeit beantwortet werden.
Aufgrund der Vielfalt familiärer Aufgaben fokussiert und beschränkt sich die Arbeit bewusst auf Vereinbarkeit im Sinne der Familiengründung und der Zeit der Kindererziehung. Verzichtet wird bewusst auf Ausführungen, die die Pflege von Angehörigen im Alter thematisieren, um dem gegebenen Rahmen dieser Ausarbeitung entsprechen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmungen
- 3 Familien und die Vereinbarkeit in Deutschland heute
- 4 Maßnahmen der Familienpolitik
- 5 Maßnahmen der Wirtschaft
- 6 Bewertung der Vereinbarkeit in Deutschland
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Konzepte in Deutschland zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestehen. Der Fokus liegt auf der Analyse der bestehenden Konzepte und ihrer Effektivität in der Praxis. Die Arbeit beleuchtet dabei die verschiedenen Definitionen von Familie und Beruf, betrachtet die aktuelle Lage von Familien in Deutschland und analysiert die Maßnahmen der Familienpolitik sowie der Wirtschaft zur Förderung der Vereinbarkeit.
- Definitionen von Familie und Beruf
- Aktuelle Lage von Familien in Deutschland
- Maßnahmen der Familienpolitik
- Maßnahmen der Wirtschaft
- Bewertung der Vereinbarkeit in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Diese Einleitung führt in die Thematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein und stellt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit. Zudem werden die wichtigsten Themenbereiche und die Struktur der Arbeit erläutert.
2 Begriffsbestimmungen
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Begriffe der Arbeit definiert, insbesondere Familie und Beruf. Die Ausführungen basieren auf soziologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Perspektiven und berücksichtigen die Vielfältigkeit der Familienformen in der heutigen Gesellschaft.
3 Familien und die Vereinbarkeit in Deutschland heute
Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle Lage von Familien in Deutschland und zeigt auf, welche Herausforderungen und Chancen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der heutigen Gesellschaft mit sich bringt. Es werden unter anderem die demografische Entwicklung, die Arbeitsbedingungen und die finanziellen Aspekte betrachtet.
4 Maßnahmen der Familienpolitik
In diesem Kapitel werden Maßnahmen der Familienpolitik vorgestellt, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen sollen. Dazu gehören beispielsweise die Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen, die Einführung von Elternzeit und die Unterstützung von Familien durch finanzielle Leistungen.
5 Maßnahmen der Wirtschaft
Dieses Kapitel befasst sich mit Maßnahmen der Wirtschaft, die zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen sollen. Dazu zählen unter anderem die Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle, die Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz und die Förderung von Teilzeitbeschäftigung.
6 Bewertung der Vereinbarkeit in Deutschland
In diesem Kapitel werden die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Konzepte und Maßnahmen kritisch bewertet. Es wird analysiert, inwieweit sie den Bedürfnissen von Familien gerecht werden und welche Herausforderungen für die Zukunft bestehen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe der Arbeit sind: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienpolitik, Wirtschaftspolitik, Familienformen, Arbeitsbedingungen, Demografie, Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeitbeschäftigung.
Häufig gestellte Fragen
Wie lässt sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Jahr 2020 bewerten?
Die Vereinbarkeit bleibt eine große Herausforderung, die sowohl politische Maßnahmen (wie Ganztagsangebote) als auch wirtschaftliche Flexibilität erfordert.
Welche Rolle spielen Ganztagsangebote für erwerbstätige Mütter?
Studien des DIW zeigen, dass mehr Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder direkt mit einer höheren Erwerbsbeteiligung von Müttern korreliert.
Ist das traditionelle „Ernährermodell“ in Deutschland noch aktuell?
Das Modell weicht zunehmend vielfältigen Familienformen und dem Wunsch nach partnerschaftlicher Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit.
Welche Maßnahmen ergreift die Wirtschaft zur Familienfreundlichkeit?
Unternehmen setzen verstärkt auf flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeitoptionen und teilweise eigene Kinderbetreuungsangebote am Arbeitsplatz.
Was sind die zentralen Instrumente der Familienpolitik?
Dazu gehören finanzielle Leistungen wie das Elterngeld sowie der Ausbau der Infrastruktur für die Kinderbetreuung während der Erziehungszeit.
- Arbeit zitieren
- Tobias Jahn (Autor:in), 2020, Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben in 2020. Maßnahmen der Familienpolitik und Wirtschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947210