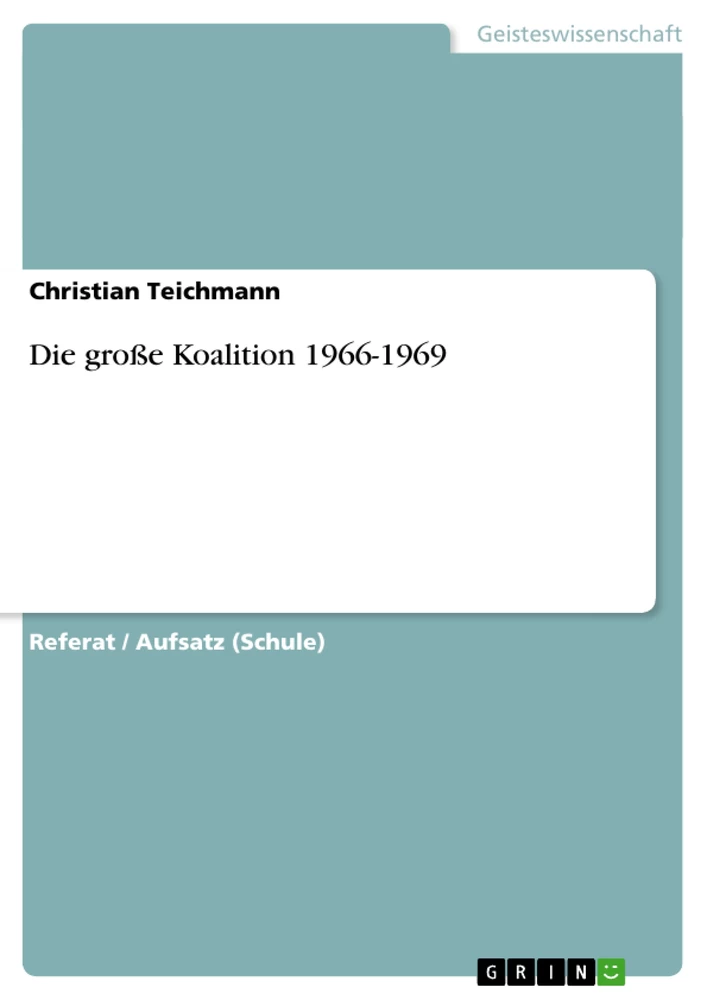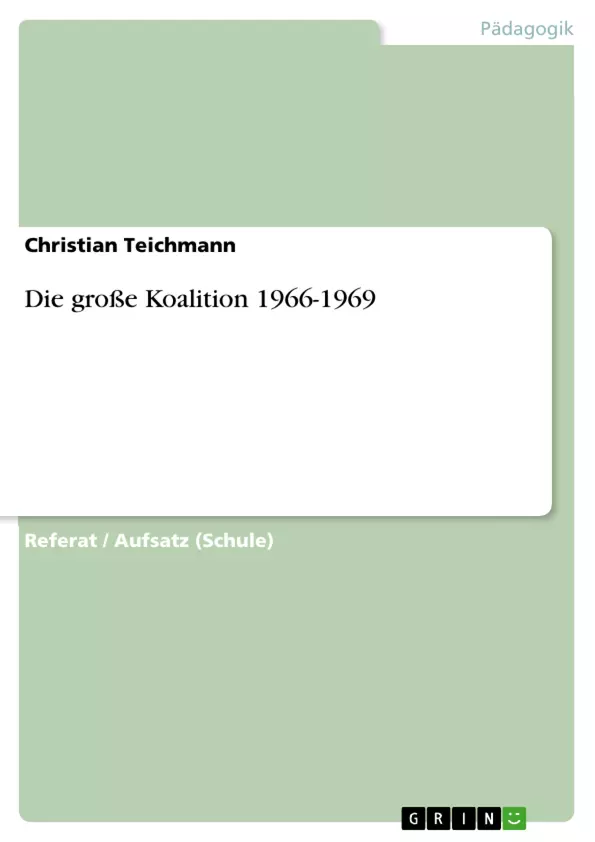Was geschah wirklich hinter den Kulissen der ersten Großen Koalition der Bundesrepublik? Tauchen Sie ein in eine Ära des Umbruchs, in der sich die beiden politischen Schwergewichte CDU/CSU und SPD zu einem ungewöhnlichen Bündnis zusammenfanden, um die drängenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Nachkriegszeit zu meistern. Diese fesselnde Analyse beleuchtet die Entstehung, die Regierungszeit und das letztendliche Ende dieser außergewöhnlichen politischen Konstellation unter Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Erfahren Sie, wie Willy Brandt als Vizekanzler und Karl Schiller als Wirtschaftsminister versuchten, das Land aus der Rezession zu führen, während Franz Josef Strauß als Finanzminister für Kontroversen sorgte. Verfolgen Sie die schwierigen Verhandlungen um die Notstandsgesetze, die hitzigen Debatten über die Ostpolitik und die gescheiterten Versuche einer Wahlrechtsreform. Entdecken Sie die Hintergründe der Studentenproteste und die Rolle der APO, die das politische Klima zusätzlich polarisierten. Dieses Buch analysiert die innen- und außenpolitischen Erfolge und Misserfolge der Großen Koalition, von der Stabilisierung der Wirtschaft und der Einführung wichtiger Sozialreformen bis hin zu den verfahrenen Bemühungen um eine Annäherung an die DDR. Es bietet neue Perspektiven auf die handelnden Personen, die politischen Strategien und die langfristigen Auswirkungen dieser prägenden Periode der deutschen Geschichte. Es geht um die deutsche Innenpolitik, die deutsche Außenpolitik, die Ostpolitik, die Sozialdemokratie, die Christlich Demokratische Union, die Christlich Soziale Union, Willy Brandt, Kurt Georg Kiesinger, Franz Josef Strauß, Karl Schiller, die Rezession, die Studentenbewegung, die APO, die Notstandsgesetze, die Wahlrechtsreform, die DDR, die Entspannungspolitik, die Sozialreformen, das Wirtschaftswunder, die Bonner Republik, die deutsche Geschichte, die Nachkriegszeit, die Bundesrepublik Deutschland, die 1960er Jahre, die politische Geschichte, die Zeitgeschichte, die parlamentarische Geschichte, die Regierungsgeschichte, die politische Analyse, die historische Analyse, die Sozialgeschichte, die Wirtschaftsgeschichte, die deutsche Teilung, die deutsche Einheit, die Systemkrise, die Protestbewegung, die Außerparlamentarische Opposition, die Neue Linke, die Studentenrevolte, die Staatskrise, die Krise der Demokratie, die Legitimitätskrise, die Repräsentationskrise, die Parteienkrise, die Systemüberwindung, die Systemtransformation, die Systemerneuerung, die Systemkonsolidierung, die Systemstabilisierung, die Systemdestabilisierung, die Systemdelegitimierung, die Systemkrise, die Systemerosion. Ein Muss für jeden, der die Wurzeln der modernen deutschen Politik verstehen will.
Inhaltsverzeichnis
DIE GROßE KOALITION 1966-1969
1.Die Entstehung
2.Die Regierungszeit
3.Das Ende der Koalition
4. Erkenntnisse aus der Regierungszeit der Großen Koalition
Quellenregister
Die Große Koalition 1966-1969
Die Große Koalition 1966-1969
1. Die Entstehung
Schon 1962 bahnte sich erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Große Koalition zwischen der CDU/CSU und der SPD an, nämlich als am 4. Dezember unter Vorsitz Konrad Adenauers (CDU) erste offizielle Koalitionsgespräche zwischen den genannten Parteien stattfanden. Dieses Thema wurde aufgrund der "Spiegel-Krise", die u. a. den Verlust seines Ministeramtes für Franz Joseph Strauß (CSU) bewirkte, aktuell. Es blieb jedoch während der Gespräche beim vorsichtigen Abtasten, doch alleine das sie überhaupt stattfanden, bewirkte innerhalb der christlichliberalen Regierungskoalition, eine Stärkung der Position der CDU/CSU. Die FDP mußte einsehen, daß sie nicht den einzig möglichen Regierungspartner darstellte.
Nach Adenauers Rücktritt als Bundeskanzler am 15. Oktober 1963 übernahm am folgenden Tag Ludwig Erhardt (CDU) dieses Amt. Und auch bei der Bundestagswahl 1965 wurde er als Spitzenkandidat der CDU/CSU nominiert. Dank dessen Beliebtheit im Volk, denn er galt als Vater des "Wirtschaftswunders", erlangte die CDU/CSU bei dieser Wahl 47,6% der Zweitstimmen, was gleichbedeutend mit ihrem zu diesem Zeitpunkt zweitbesten Wahlergebnis war. Auch die SPD konnte Zugewinne von 3,1% (auf 39,3%) verbuchen, doch die bisherige Regierungskoalition blieb trotz der Verluste der FDP von 3,3% (auf 9,5%) an der Macht und Erhardt somit im Amt.
Im Sommer folgte dann für die CDU eine herbe Niederlage bei den Landtagswahlen in Nordrhein- Westfalen, auf die eine Schwächephase der Bonner Koalition folgte, welche in einem Streit um den Bundeshaushalt 1967 gipfelte. Zu seinem Ausgleich waren Steuererhöhungen erforderlich, gegen die sich die FDP nach Kräften wehrte. Erhardt gelang es nicht den Streit zu schlichten, worauf am 27. Oktober 1966 die vier FDP Minister von ihren Ämtern zurücktraten. Am 8. November wurde im
Bundestag ein SPD Antrag mit den Stimmen der FDP angenommen, der den Bundeskanzler aufforderte die Vertrauensfrage zu stellen. Am gleichen Tag wurde in Düsseldorf Heinz Kühn (SPD) Vorsitzender einer sozial-liberalen Koalitionsregierung.
Es kam jedoch nicht zu dem zunächst von FDP und SPD angestrebten Konstruktiven Mißtrauensvotum gegen Erhardt. Die SPD Führung ging aufgrund der geringen Mehrheit und aus Zweifel an der Geschlossenheit der FDP Fraktion nicht auf Mendes (FDP) Angebot einer gemeinsamen Regierungsbildung ein. Damit war klar, daß die CDU/CSU die führende Regierungspartei bleiben würde. Nachdem sich die Bundestagsfraktion der CDU/CSU auf den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und langjährigen außenpolitischen Sprecher der Fraktion Kurt Georg Kiesinger (CDU) als neuen Kanzlerkandidaten geeinigt hatte, führten die Koalitions- verhandlungen mit der SPD zu der Vereinbarung, eine Regierung der Großen Koalition zu bilden. Die SPD wurde erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Regierungspartei. Die FDP mußte mit ihren 49 Manda-ten gegenüber den 245 der CDU/CSU und den 202 der SPD die Rolle einer schwachen parlamentarischen Opposition übernehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
"Erhardt in der Sanduhr", Von Karl-Heinz Schoenfeld, 1966
Ludwig Erhardt ist größtenteils über innenpolitische Probleme gestürzt, denn er hatte die beginnende Rezession zu spät erkannt und konnte aufgrund der vielen Kritiker in den eigenen Reihen nur unzulängliche Maßnahmen einleiten. 1965 wuchs zum ersten Mal der Bundeshaushalt schneller als das Bruttosozialprodukt, und ein Jahr später mußte man anders als bisher über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken. Eine Einigung über diese war innerhalb der Regierungskoalition nicht durchführbar, so daß eine Weiterführung dieser unmöglich wurde. Erhardts Zeit als "Übergangskanzler" war abgelaufen, weil er nicht in der Lage war den Deutschen die negativen Folgen des "Wirtschaftswunders" vor Augen zu führen. Er trat am 30. November 1966 von seinem Amt als Kanzler zurück.
2. Die Regierungszeit
Am 1. Dezember 1966 wurde Kurt Georg Kiesinger von der CDU/CSU/SPD Koalition zum Bundeskanzler gewählt. Seinem Kabinett gehörten die großen Männer der beteiligten Parteien an, welche im einzelnen waren: Willy Brand (SPD) als Vizekanzler und Außenminister, Karl Schiller (SPD), der bisherige Außenminister Gerhard Schröder (CDU) wurde Verteidigungsminister, Franz Joseph Strauss (CSU) kehrte als Finanzminister ins Kabinett zurück, das ehemalige CDU Mitglied Gustav Heinemann (SPD) wurde Justizminister und der sogenannte "Architekt der Großen Koalition" Herbert Wehner (SPD) übernahm das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen.
Es wurden mehrere wichtige Ziele für die Zeit der Großen Koalition vereinbart, von denen die wichtigsten eine schnellstmögliche Überwindung der Rezession einschließlich ihrer politischen Begleiterscheinungen sowie eine Fortsetzung der außenpolitischen Initiative Erhardts im Sinne der von den USA geforderten Entspan- nungspolitik waren. Ein weiteres Ziel war die Einführung eines Mehr- heitswahlrechts auf Bundesebene, welches bei den nächsten Wahlen automatisch ein Ende der Koalition bedeutet hätte und zudem radikale Parteien wie die NPD aber auch kleine bürgerliche Parteien wie die FDP aus dem Bundestag verdrängt hätte. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch am Widerstand der SPD.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
"Plisch und Plum auf dem Sockel" von Wilhelm Hartung, 1967; im Volksmund war"Plisch und Plum" die Bezeichnung für das Duo Schiller und Strauß, frei nach Wilhelm Busch
Wirtschaftspolitisch war die Große Koalition von Anfang an sehr aktiv und es stellten sich auch bald die ersten Erfolge ein. Am 14. Februar 1967 trat zum ersten Mal unter der Leitung Schillers die "Konzertierte Aktion", ein unverbindlicher Gesprächskreis von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Wirtschaftswissenschaftlern und Politikern, zusammen. Am 23. Februar wurde das erste Konjunkturprogramm durch den Bundestag beschlossen, durch das u. a. die öffentliche Bautätigkeit belebt werden sollte, und schon am 10. Mai verabschiedete der Bundestag das "Stabilitätsgesetz" - genauer, das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft - und damit zugleich eine Änderung von Artikel 109 des Grundgesetzes. Im neuen Artikel 109 übernahm der Staat eine Mitverantwortung für das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht, indem es heißt, daß Bund und Länder eben dieses in ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik zu beachten hätten. Das "magische Viereck" fand sich so als gesetzlicher Auftrag formuliert.
Am 6. September 1967 stimmte der Bundestag der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes für 1967 bis 1971 zu, zwei Tage später verabschiedete er das zweite Konjunkturprogramm mit einem Volumen von 5,3 Milliarden DM. Am 8. November billigt das Bundeskabinett den "Leber-Plan", der zur Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schienen führen sollte und später in der Praxis scheiterte. Während der gesamten Zeit wurde an einer Finanzreform gearbeitet, die im Mai 1969 als Grundgesetzänderung in Kraft trat. Sie führte zu einer Neuverteilung der Steuern zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, in deren Zusammenhang auch die "Gemeinschaftsaufgaben"1 vereinbart wurden.
Damit erreichte es die Koalition die Konjunktur anzukurbeln, auch wenn das Jahr 1967 vom Ergebnis her noch Spuren der Rezession trug. 1968 kam es wieder zu einem Wirtschaftswachstum von 7,3%, während gleichzeitig die Inflation von 3,5% im Jahre 1966 auf 1,5% 1968 fiel. Anfang 1967 zählte man über 600.000 Arbeitslose, im Frühjahr 1969 waren es nur noch 243.000, denen über 700.000 offene Stellen gegenüberstanden. Auch haushaltspolitisch wirkte sich das aus: 1969 gab es im Bundeshaushalt trotz einer größeren Schuldentilgung einen Überschuß von 1,5 Milliarden DM. Schiller und Strauß genossen eine hohe Popularität und waren sich auch weithin einig in ihrer volkswirtschaftlich orientierten Finanzpolitik. Zu Schwierig Keiten kam es zwischen ihnen allerdings, als die Konjunktur wieder belebt war und man nun zu klären hatte, ob man sie noch weiter fördern oder eher sich selbst überlassen sollte. Strauß steuerte den letzteren Kurs und hatte die CDU/CSU Mehrheit im Kabinett hinter sich und er sträubte sich im letzten Koalitionsjahr gegen eine Aufwertung der DM. Daran wurden Differenzen zwischen den Koalitionspartnern offensichtlich, das änderte aber nichts am gemeinsamen Erfolg der Stabilitätspolitik, der sich vor allem auch sozialpolitisch nutzen ließ.
Die Regierung verabschiedete das Gesetz über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das Berufsbildungsgesetz und das Rentenversicherungsänderungsgesetz (alle 1969), knüpfte also das soziale Netz enger.
Eher bescheiden nahmen sich dagegen die außenpolitischen Erfolge der Großen Koalition aus, was sowohl innenpolitische Gründe hatte aber auch eine Auswirkung der fortdauernden Spannungen zwischen den Weltmächten den USA und der UdSSR war. In der Deutschland Politik bemühte sich die Regierung um einen engeren Anschluß an die Linie der amerikanischen Rußland Politik, die Präsident Johnson in einer Rede vom 7. Oktober 1966 wie folgt umrissen hatte: "Aufgabe ist es, eine Aussöhnung mit dem Osten zu erreichen - einen Übergang von der engen Konzeption der Koexistenz zu der großen Vision eines friedlichen Engagements." Bundeskanzler Kiesinger ging daher in seiner Regierungserklärung vom 13. Dezember 1966 einen Schritt über die Position seines Vorgängers hinaus, indem er die DDR in den erneuerten Vorschlag eines Austauschs von Gewaltverzichtserklärungen mit den osteuropäischen Staaten mit einbezog. Am Alleinvertretungsanspruch deutscher Interessen durch die Bundesrepublik hielt er allerdings fest.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
"Oppositionsmöglichkeit einer Großen Koalition." von Ernst Maria Lang, 1967, dargestellt Otto Graf Lambsdorff (FDP) und Helmut Schmid (SPD)
Die Bundesregierung bestätigte damit das Mißtrauen der Sowjetführung und verstärkte dies auch noch, indem man am 30. Januar 1967 die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Rumänien bekanntgab und kurz darauf die Beziehungen zu Titos Jugoslawien wieder aufnahm. Man verstand dies im Obersten Sowjet als einen Versuch der Bundesrepublik die DDR quasi diplomatisch in die Zange zu nehmen, was zu einer Verhärtung der Positionen führte.
Aber auch die DDR trieb die Abgrenzung gegenüber der Bundesrepublik weiter voran, indem sie am 20. Februar 1967 in einem Gesetz, das eine DDR Staatsbürgerschaft einführte, eine eigene DDR Staatsnation deklarierte. Auch der Abschluß - von an sich überflüssigen - speziellen Freundschafts- und Beistandsverträgen zwischen der DDR, Polen und der CSSR kurz darauf diente dazu, in diesem "eisernen Dreieck" eine absolute Gleichschaltung mit der Politik der Sowjetunion gegenüber der Bundesrepublik sicherzustellen. Dementsprechend gelang es der Bundesregierung nicht diplomatische Beziehungen zur CSSR aufzunehmen, es gelang lediglich die Einrichtung von gegenseitigen Handelsmissionen in Bonn und Prag zu vereinbaren. Im Falle Polens kam es nichtmal zur Aufnahme von Vorverhandlungen. Unter diesen Vorbedingungen stießen die am 12. April 1967 in einer Regierungserklärung vorgetragenen Empfehlungen Kiesingers, "Maßnahmen zur Erleichterung des täglichen Lebens für die Menschen in beiden Teilen Deutschlands" zu ergreifen, auf seiten der DDR Führung auf keine auch nur annähernd positive Resonanz. Es erfolgte zwar noch über einen gewissen Zeitraum ein Briefwechsel zwischen den Spitzen der beiden deutschen Staaten, doch es ergaben sich keine neuen Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit. Die Diskussion drehte sich im Kreise, womit die Ostpolitik der Großen Koalition offensichtlich an einem toten Punkt angelangte.
Alle Hoffnungen und Befürchtungen einer Beteiligung der Bundesrepublik an einer nuklearen Streitmacht wurden am 12. Juni 1968 von der UN-Vollversammlung mit Unterzeichnung des Kernwaffen-Sperrvertrages zerschlagen. Besonders in der CDU/CSU war dieser Vertrag sehr umstritten und wurde von Adenauer sogar als "verteufelte Neuauflage des Morgenthau-Plans" bezeichnet.
Innenpolitisch sorgte 1967/68 eine breite außerparlamentarische-Opposition (APO) für eine Krisenstimmung und Straßenkämpfe. Sie formierte sich ob der schwachen Lage der parlamentarische Opposition der FDP. In dieser Ausnahmesituation gelang es der Koalition sich auf eine, von den Besatzungsmächten geforderte Notstandsverfassung zu einigen, welche am 17. Juni 1968 in Kraft treten konnte.
In dieser Phase wurde der DKP eine Gründung ermöglicht, was zweifelsfrei auf Initiative der Großen Koalition geschah, wobei das Hauptziel dieser Aktion war, die steckengebliebene Ostpolitik zu beleben.
3.Das Ende der Koalition
Die Große Koalition wurde von Anfang an nur als Bündnis auf Zeit verstanden, um mit einer großen parlamentarischen Mehrheit die Wirtschaft zu stabilisieren und wichtige Entwürfe wie die Notstandsverfassung endlich zu verabschieden.
Vom Winter 1968/69 an befand sich die Bundesrepublik bereits im Zustand eines viel zu früh einsetzenden Wahlkampfes. Die Handlungsfähigkeit der Regierung, deren Grundlage schon von beiden Seiten, CDU/CSU und SPD, in Frage gestellt wurde, erschien immer begrenzter. Die Verlegenheitslösung, strittige Probleme auszuklammern, mußte von Kiesinger immer häufiger praktiziert werden. Der Rücktritt des Innenministers Lücke (CDU) am 2. April 1968 hatte bereits das Scheitern eines zunächst allseits als fundamental angesehenen Programmstücks der Regierung, der Wahlrechtsreform in Richtung eines Mehrheitswahlrechtes auf Bundesebene, markiert. Statt der 1966 erhofften Konzentration des Parteienfeldes auf zwei große Blöcke stand am Ausgang dieser Regierung eine breite Auffächerung, in die auch rechts- und linksradikale Parteien (NPD und DKP) einbezogen waren.
Nach der Bundestagswahl 1969 kam es erstmalig zu einer sozial-liberalen Koalition auf Bundesebene unter der Führung des ersten SPD Kanzlers Willy Brandt. Diese Koalition, welche sich schon in der Wahl des Bundespräsidenten Gustav Heinemann (SPD) mit Hilfe der Stimmen der FDP abzeichnete, galt als großes Wagnis. Obwohl die SPD mit 42,7% der Zweitstimmen ihr bis dahin bestes Wahlergebnis erreichte, hielt die Regierung aufgrund der Schwäche der FDP, die nur 5,8% der Stimmen erhielt, nur eine wacklige Mehrheit von sechs Abgeordneten.
4.Erkenntnisse aus der Regierungszeit der Großen Koalition
Die Große Koalition war 1966 nach Meinung führender Politiker eine logische Konsequenz der ersten Rezession der Bundesrepublik, da man die Auffassung vertrat, daßnur eine breite parlamentarische Mehrheit in der Lage sei die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Man benötigte diese vor allem um Grundgesetzänderungen , wie z. B. die des Artikels 109 oder der Notstandsverfassung, durchzu- setzen. Es wurde als sinnvoll angesehen die führenden Vertreter der beiden großen Volksparteien zusammen eine Regierung bilden zu lassen, um so den wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen zu begegnen. Die Regierung der Großen Koalition wurde allerdings von allen beteiligten nur als Übergangslösung angesehen, um die dringendsten Probleme zu beseitigen und deshalb wollte man durch eine Wahlrechtsveränderung hin zum Mehrheitswahlrecht für ein "natürliches" und unwiderrufliches Ende dieses als "unnatürlich" angesehenen Zustandes zu sorgen. Man kann feststellen, daß die an sich selbst gestellten Vorgaben der Großen Koalition hinreichend erfüllt wurde, durch aufwendige Förderprogramme wurde die wirtschaftliche Lage stabilisiert und die Arbeitslosigkeit erfolgreich bekämpft. Problematisch war allerdings die außenpolitische Arbeit der Regierung, denn in diesem Bereich unterschieden sich die Positionen der beteiligten Parteien stark, was dazu führte, daß ein Kurs nicht immer klar erkennbar war, und daß sich vor allem die deutsch- deutsche Lage verschärfte. Mit teils nicht ausreichend durchdachten Aktionen, wie der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Rumänien und Jugoslawien wurde die Angst der DDR Führung vor einer Einkesselung unnötig geschürt und durch die ständige Erwähnung strittiger Positionen (Stichwort Alleinvertretungsanspruch) wurde die Findung eines kleinsten gemeinsamen Nenners verhindert.
Innenpolitisch erwies es sich als schwierig, daß nur eine minimale parlamentarische Opposition in Form der FDP existierte, weshalb sich die APO formierte, welche in einigen ihrer Teilgruppen eine erhöhte Gewaltbereitschaft demonstrierte. Aus ihr entwickelte sich auch die RAF, die mit ihren Terroraktionen noch über Jahre für Angst und Schrecken sorgte. Um diesen Zustand einer schwachen Opposition dauerhaft zu beenden und um radikale Parteien aus dem Parlament zu verdrängen, wollte man ein Mehrheitswahlrecht nach britischem Vorbild einführen. Man kann den Verantwortlichen für dieses Vorhaben jedoch auch unterstellen, daß ihr wahres Ziel nur die Sicherung der eigenen Macht war, woran man auch die Gefahr einer solch mächtigen Regierung erkennen kann. Sie bietet nicht nur die Möglichkeit eines breiten Konsens, sondern auch die des Machmißbrauchs.
Nach der letzten Bundestagswahl 1998 bot sich erneut die Möglichkeit der Bildung einer Großen Koalition, diesmal unter der Führung der SPD, doch diese zog ein Bündnis mit den Grünen vor. Nach diversen Meinungsumfragen zu urteilen hätte jedoch eine Mehrheit der Wähler eine Große Koalition vorgezogen. Unter dem Eindruck der geringen Bereitschaft der Grünen zum Konsens und der Mehrheit der CDU im Bundesrat nach der Landtagswahl 1999 in Hessen erscheint es jedoch nicht unwahrscheinlich, daß es zu einem Koalitionswechsel noch in dieser Legislaturperiode kommt. Ein umgekehrter Patt in den Bundesparlamenten sorgte schon vor der Bundestagswahl 1998 für einen Stillstand bei der Findung wichtiger Entscheidungen.
Eine Große Koalition wäre vielleicht in der gegenwärtigen Lage auch die sinnvollste Variante, da die wirtschaftliche und soziale Lage erneut angespannt ist und auch radikale Parteien wieder verstärkt in die Parlamente drängen. Es ist vonnöten einen breiten politischen Konsens zu finden um die Situation zu bereinigen und diesen mit einer überzeugenden parlamentarischen Mehrheit durchzusetzen. Schon während der ersten Großen Koalition wurde gezeigt, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit aussehen kann und man hat durch unorthodoxe Aktionen wie z. B. die "Konzertierte Aktion" die Wirtschaft belebt. Gegenwärtig versucht die rot-grüne Regierung mit dem "Bündnis für Arbeit" ein ähnliches Projekt zu beleben, doch es wäre vermutlich erfolgversprechender, wenn es von den beiden großen Volksparteien gestützt würde. Man sollte allerdings die Arbeitszeit einer zweiten Großen Koalition erneut auf maximal eine Legislaturperiode begrenzen, da eine solche es zwangsläufig mit sich bringt, daß strittige Fragen in denen die Positionen absolut unvereinbar sind ausgeklammert werden müßten. Dies führte schon unter Kiesinger in einigen Bereichen zum Stillstand.
Quellenregister
- Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Dietrich Thränhardt, Frankfurt 1986
- Das zwanzigste Jahrhundert II - Europa nach dem Zweiten Weltkrieg 1945-1980, Reinhard Kosselleck, Frankfurt 1983
- Chronik der Menschheit, Hrsg.: Bodo Harenberg, Dortmund 1984
- Chronik 1966, Hrsg.: Bodo Harenberg, Dortmund 1985
- Chronik 1969, Hrsg.: Bodo Harenberg, Dortmund 1985
- Göttinger Tageblatt vom: 2.12.1966, 14.12.1966, 15. 2.1967, 5. 3.1969, 22. 9.1969, 4.10.1969
- Deutsche Geschichte von 1949 bis zur Gegenwart (CD-ROM), Jörg Schäfer, München 1997
Die Große Koalition 1966-1969 (Kopiervorlage)
Wichtige Positionen: Kanzler: Kurt Georg Kiesinger (CDU); Vizekanzler/Außenminister: Willy Brandt (SPD); Wirtschaftsminister: Karl Schiller (SPD); Verteidigungsminister: Gerhard Schröder (CDU); Finanzminister: Franz Joseph Strauss (CSU); Justizminister: Gustav Heinemann (SPD); Minister für gesamtdeutsche Fragen: Herbert Wehner (SPD)
Innenpolitik: · Ziele: Überwindung der Rezession; Einführung des Mehrheitswahl rechts (nicht durch ...geführt
- 23. 2.1967: Konjunkturprogramm zur Förderung der öffentlichen Bautätigkeit
- 10. 5.1967: "Stabilitätsgesetze", Art. 109 GG wird geändert, das "magische Viereck" findet Einzug ins GG
- 6. 9.1967: Mittelfristige Finanzplanung für 1967-1971 wird verabschiedet
- 8. 9.1967: 2. Konjunkturprogramm (Volumen: 5,3 Millionen DM)
- 17. 6.1968: Inkrafttreten der Notstandsverfassung, welche mit Verweis auf die anhalten Unruhen durch die APO erlassen wurden
- 1. 5.1969: Inkrafttreten der Finanzreform: Neuverteilung der Steuern zwischen Bund, Ländern und den Gemeinden
- 1969: Sozialreformen: Gesetz über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Berufsbildungsgesetz, Rentenversicherungsänderungsgesetz
- wirtschaftliche Erfolge: Wirtschaftswachstum 1968 bei 7,3%; Inflation 1968 bei 1,5% (1966 3,5%); Arbeitslosenzahl im Frühjahr 1969 bei 243.000 (Anfang 1967: 600.000); 1969 trotz Schuldentilgung ein Haushaltsüberschuß von 1,5 Milliarden DM
Außenpolitik: · Ziele: gegenüber dem Osten Entspannungspolitik im Sinne des US-Präsidenten Johnson
- 13.12.1966: Kiesinger schlägt Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR über Gewaltverzicht vor
- 30. 1.1967: Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Rumänien und Jugoslawiens (beides bestätigte das Mißtrauen der Sowjetführung)
- 20. 2.1967: Einführung der DDR Staatsbürgerschaft, Deklaration der DDR Staatsnation (Ostpolitik der Regierung Kiesinger erreicht Stillstand)
- 12. 6.1968: Unterzeichnung des Kernwaffensperrvertrages vor der UN-Vollversammlung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
© 1996/1999 by Christian Teichmann, Göttingen
Daten:
Referat im Fach Gemeinschaftskunde
Thema: Die Große Koalition 1966-1969
Von: Christian Teichmann
Edward-Schröder-Bogen 1
37077 Göttingen
cteichmann@gmx.de
Bei: Herr Gläsner
Tutor: Frau Schaefer
Schule: Theodor-Heuss-Gymnasium, Göttingen
Schuljahr: 1995/96
Jahrgang: 12.1
Ergebnis: 13 Punkte (14. 1.1996)
Überarbeitet: 21. 2.1999
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument behandelt die Große Koalition in der Bundesrepublik Deutschland von 1966 bis 1969.
Was waren die Hauptgründe für die Entstehung der Großen Koalition?
<Die Große Koalition entstand aufgrund einer Regierungskrise nach der "Spiegel-Affäre" und später aufgrund der Rezession von 1966, die durch Streitigkeiten über den Bundeshaushalt verursacht wurde, welche die bis dahin regierende christlich-liberale Koalition sprengte.
Wer waren die wichtigsten Persönlichkeiten in der Großen Koalition?
Zu den wichtigsten Persönlichkeiten gehörten Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU), Vizekanzler und Außenminister Willy Brandt (SPD), Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD), Finanzminister Franz Joseph Strauss (CSU), Verteidigungsminister Gerhard Schröder (CDU), Justizminister Gustav Heinemann (SPD), und Minister für gesamtdeutsche Fragen Herbert Wehner (SPD).
Welche Ziele verfolgte die Große Koalition?
Die Hauptziele waren die Überwindung der Rezession, die Fortsetzung der Entspannungspolitik, die Einführung eines Mehrheitswahlrechts (welches aber scheiterte) und die Verabschiedung einer Notstandsverfassung.
Welche wirtschaftlichen Erfolge konnte die Große Koalition verbuchen?
Zu den wirtschaftlichen Erfolgen zählten die Ankurbelung der Konjunktur, ein Wirtschaftswachstum von 7,3% im Jahr 1968, die Senkung der Inflation und ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit sowie ein Haushaltsüberschuss im Jahr 1969.
Welche sozialpolitischen Maßnahmen wurden während der Großen Koalition ergriffen?
Die Regierung verabschiedete das Gesetz über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das Berufsbildungsgesetz und das Rentenversicherungsänderungsgesetz.
Wie gestaltete sich die Außenpolitik der Großen Koalition?
Die Außenpolitik war geprägt von dem Bemühen um Entspannung im Osten, was zu diplomatischen Beziehungen mit Rumänien und Jugoslawien führte. Andererseits wurden die Beziehungen zur DDR durch die Einführung der DDR-Staatsbürgerschaft und die Deklaration einer DDR-Staatsnation weiter belastet.
Was führte zum Ende der Großen Koalition?
Die Große Koalition wurde von Anfang an als zeitlich begrenztes Bündnis betrachtet. Interne Streitigkeiten, insbesondere um das Wahlrecht, und der Beginn des Wahlkampfs führten schließlich zu ihrem Ende. Nach den Bundestagswahlen 1969 kam es zur Bildung einer sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt.
Welche Kritikpunkte gab es an der Großen Koalition?
Kritisiert wurden die schwache parlamentarische Opposition, die zur Bildung der Außerparlamentarischen Opposition (APO) führte, sowie die teilweise unklare Außenpolitik und die Gefahr des Machtmissbrauchs aufgrund der großen Mehrheit.
Welche Lehren wurden aus der Regierungszeit der Großen Koalition gezogen?
Es wurde festgestellt, dass eine breite parlamentarische Mehrheit zur Bewältigung von Krisen notwendig sein kann, aber auch die Gefahr des Machtmissbrauchs birgt. Eine klare politische Linie und eine starke parlamentarische Opposition sind wichtig, um eine ausgewogene Politik zu gewährleisten.
- Quote paper
- Christian Teichmann (Author), 1995, Die große Koalition 1966-1969, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94726