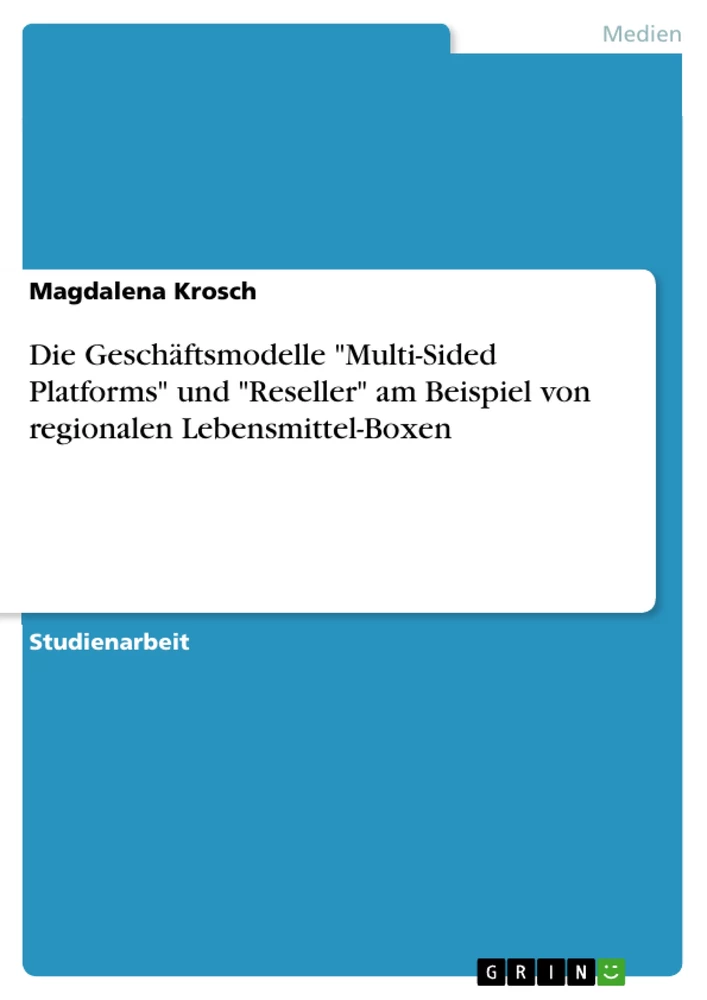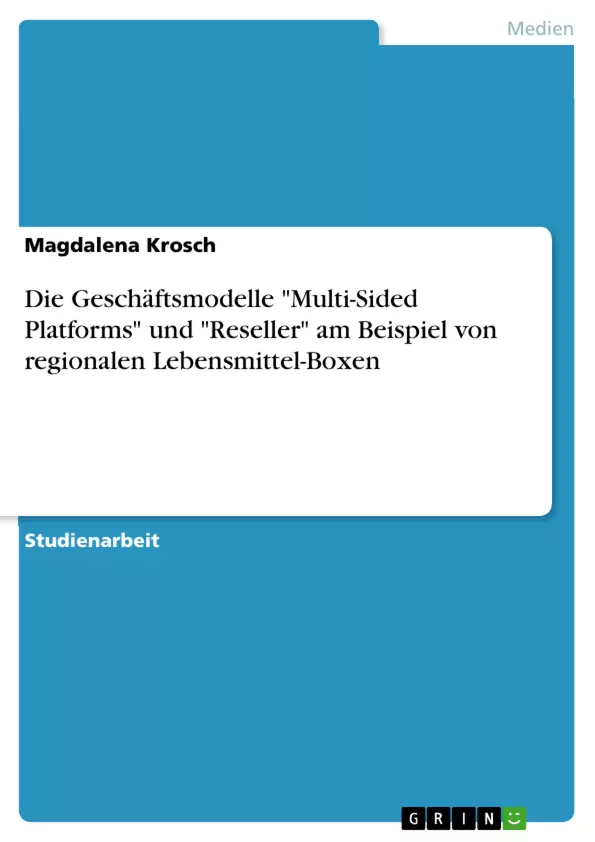Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage welches Geschäftsmodell für den wirtschaftlichen Erfolg von Lebensmittel-Boxen zielführender ist. Dafür werden das Multi-Sided Platforms (MSP) und das Reseller Geschäftsmodell analysiert.
Die Arbeit beginnt mit den theoretischen Grundlagen in Kapitel 2. Zunächst wird das Geschäftsfeld, für das die beiden Geschäftsmodelle MSP und Reseller theoretisch aufgebaut werden, definiert. Daraufhin wird das Geschäftsmodell als Mehrseitige Plattform erläutert. Ähnlich aufgebaut ist das folgende Kapitel, indem das konkrete Geschäftsfeld als Reseller-Modell evaluiert wird. In Kapitel 3 wird die Umsetzung der Geschäftsmodelle unter verschiedenen Faktoren auf Chancen und Vorteile sowie auf Nachteile und Herausforderungen herausgearbeitet. Vor dem Fazit wird in Kapitel 4 Bezug zur Nachhaltigkeit genommen. Dabei wird zwischen ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit differenziert. Schließlich stellt Kapitel 5 das Fazit dieser Arbeit dar. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel 3 wird sich für den Vertrieb der Lebensmittel-Boxen für eines der Geschäftsmodelle entschieden.
Das Internet zählt zu den grundlegendsten Medien unserer heutigen Gesellschaft. Die Informationsbandbreite, die über das Internet ausgespielt wird, ist für jeden, jederzeit und ubiquitär abrufbar. Aufgrund der digitalen Veränderungen konzentriert sich auch die Lebensmittelbranche immer mehr auf den Ausbau des Vertriebs über digitale Kanäle. Zwei Geschäftsmodelle, die dabei realisiert werden können, sind die mehrseitige Plattform und das Reseller-Modell. Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Beispielen erfolgreicher, mehrseitiger Plattformen. Zu ihnen zählen bspw. Facebook oder Amazon Marketplace. Je höher die Aufmerksamkeit rund um Mehrseitige Plattformen wird, desto mehr rücken klassische Reseller-Modelle in den Hintergrund. Jedoch gibt es auch zahlreiche erfolgreiche Reseller-Modelle. Denn auch dieses Geschäftsmodell hat gegenüber Mehrseitigen Plattformen entscheidende Vorteile. Bevor sich in einem Projekt auf ein konkretes Geschäftsmodell festgelegt wird, sollte die Umsetzung beider Geschäftsmodelle kritisch hinterfragt und überdacht werden. Aus diesem Grund beschäftigt sich die folgende Hausarbeit mit einer Erörterung der Geschäftsmodelle MSP und Reseller an einem konkreten Beispiel eines Geschäftsfeldes der Food-Branche.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage
- Vorgehensweise
- Theoretische Grundlagen
- Definition des ausgewählten Geschäftsfeldes
- Umsetzung des MSP Geschäftsmodells
- Umsetzung des Reseller Geschäftsmodells
- Gegenüberstellung der Geschäftsmodelle
- Aufbau und Kostenstruktur
- Matching
- Skaleneffekte
- Netzwerkeffekte
- Customer-Relationship-Management und Customer Experience
- Aggregationseffekte
- Kritische Bewertung der Nachhaltigkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Eignung von zwei Geschäftsmodellen – Mehrseitige Plattform (MSP) und Reseller – für den Vertrieb regionaler Lebensmittelboxen. Ziel ist es, die jeweiligen Vor- und Nachteile im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg zu analysieren und ein geeignetes Modell für landwirtschaftliche Betriebe zu empfehlen, die ihre Ernte, auch solche, die nicht den üblichen Marktstandards entsprechen, digital vertreiben möchten. Die Arbeit berücksichtigt dabei die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und die Bedeutung der Nachhaltigkeit.
- Vergleich der Geschäftsmodelle MSP und Reseller
- Wirtschaftlicher Erfolg von Lebensmittelboxen
- Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche
- Digitaler Vertrieb regionaler Produkte
- Auswirkungen der Corona-Pandemie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des digitalen Vertriebs von Lebensmitteln ein und stellt die Problemstellung dar: Landwirte haben Schwierigkeiten, ihre Ernte, insbesondere Produkte, die nicht den optischen Normen entsprechen, zu vermarkten. Die Arbeit untersucht daher, welches Geschäftsmodell (MSP oder Reseller) sich besser für den Vertrieb von regionalen Lebensmittelboxen eignet, um den wirtschaftlichen Erfolg zu steigern und die Nachhaltigkeit zu fördern. Die Forschungsfrage wird formuliert und die Vorgehensweise der Arbeit skizziert.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert zunächst das konkrete Geschäftsfeld: Regionale Lebensmittelboxen, die von Landwirten angeboten werden. Es erläutert dann die theoretischen Grundlagen der beiden Geschäftsmodelle, MSP und Reseller, im Kontext des gewählten Geschäftsfeldes. Die Definitionen legen den Fokus auf die jeweiligen Strukturen, Funktionen und Marktrollen, um einen Vergleich in den folgenden Kapiteln zu ermöglichen.
Gegenüberstellung der Geschäftsmodelle: Dieses Kapitel vergleicht die Umsetzung der beiden Geschäftsmodelle unter verschiedenen Aspekten wie Aufbau und Kostenstruktur, Matching-Prozesse, Skaleneffekte, Netzwerkeffekte, Customer-Relationship-Management (CRM), Customer Experience und Aggregationseffekte. Es analysiert die Chancen und Herausforderungen jedes Modells und bewertet deren Eignung für den Vertrieb der Lebensmittelboxen.
Kritische Bewertung der Nachhaltigkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der kritischen Bewertung der Nachhaltigkeit der beiden Geschäftsmodelle, wobei zwischen ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit unterschieden wird. Es analysiert, welches Modell besser geeignet ist, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
Schlüsselwörter
Mehrseitige Plattform (MSP), Reseller, Lebensmittelboxen, regional, Nachhaltigkeit, digitaler Vertrieb, Corona-Pandemie, Landwirte, wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, Lebensmittelverschwendung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Vergleich der Geschäftsmodelle MSP und Reseller für den Vertrieb regionaler Lebensmittelboxen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit vergleicht die Eignung von zwei Geschäftsmodellen – Mehrseitige Plattform (MSP) und Reseller – für den digitalen Vertrieb regionaler Lebensmittelboxen durch landwirtschaftliche Betriebe. Der Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Vor- und Nachteile hinsichtlich des wirtschaftlichen Erfolgs und der Nachhaltigkeit, insbesondere unter Berücksichtigung der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, welches Geschäftsmodell (MSP oder Reseller) sich besser für den Vertrieb regionaler Lebensmittelboxen eignet, um den wirtschaftlichen Erfolg zu steigern und die Nachhaltigkeit zu fördern. Die Arbeit untersucht, welches Modell Landwirten dabei hilft, ihre Ernte, auch Produkte, die nicht den üblichen Marktstandards entsprechen, erfolgreich zu vermarkten.
Welche Geschäftsmodelle werden verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht das Mehrseitige Plattform-Geschäftsmodell (MSP) und das Reseller-Geschäftsmodell. Es werden die theoretischen Grundlagen beider Modelle erläutert und im Detail gegenübergestellt.
Welche Aspekte werden im Vergleich der Geschäftsmodelle berücksichtigt?
Der Vergleich umfasst verschiedene Aspekte wie Aufbau und Kostenstruktur der Modelle, Matching-Prozesse, Skaleneffekte, Netzwerkeffekte, Customer-Relationship-Management (CRM), Customer Experience und Aggregationseffekte. Die Analyse berücksichtigt auch die Chancen und Herausforderungen jedes Modells im Kontext des Vertriebs von Lebensmittelboxen.
Wie wird die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle bewertet?
Die Nachhaltigkeit wird kritisch bewertet, wobei zwischen ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit unterschieden wird. Die Analyse zielt darauf ab, festzustellen, welches Modell besser geeignet ist, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie in der Untersuchung?
Die Arbeit berücksichtigt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den digitalen Vertrieb regionaler Lebensmittel und die damit verbundenen Herausforderungen für Landwirte.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit kommt zu einem Fazit, welches das geeignetere Geschäftsmodell für den Vertrieb regionaler Lebensmittelboxen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und nachhaltigen Aspekte empfiehlt.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage darstellt; ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen der beiden Geschäftsmodelle; ein Kapitel zum Vergleich der Geschäftsmodelle; ein Kapitel zur kritischen Bewertung der Nachhaltigkeit; und abschließend ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Thematik?
Schlüsselwörter sind: Mehrseitige Plattform (MSP), Reseller, Lebensmittelboxen, regional, Nachhaltigkeit, digitaler Vertrieb, Corona-Pandemie, Landwirte, wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, Lebensmittelverschwendung.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Die Hausarbeit ist relevant für Landwirte, die ihre Produkte digital vertreiben möchten, für Unternehmen, die im Bereich des Lebensmittelvertriebs tätig sind, und für Wissenschaftler, die sich mit Geschäftsmodellen und Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche befassen.
- Arbeit zitieren
- Magdalena Krosch (Autor:in), 2020, Die Geschäftsmodelle "Multi-Sided Platforms" und "Reseller" am Beispiel von regionalen Lebensmittel-Boxen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947540